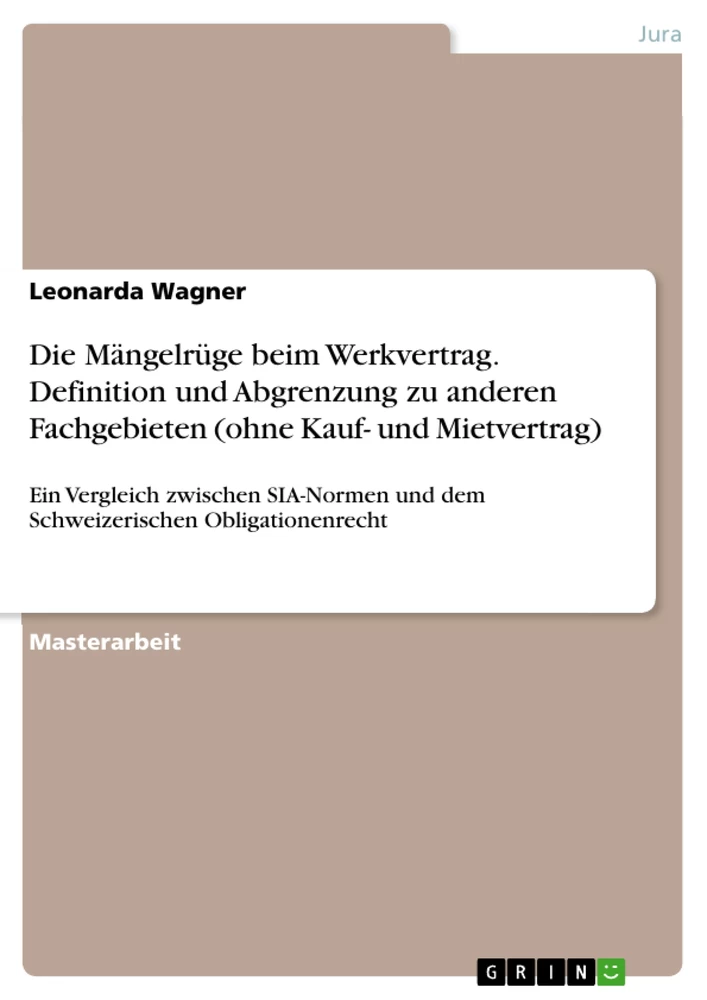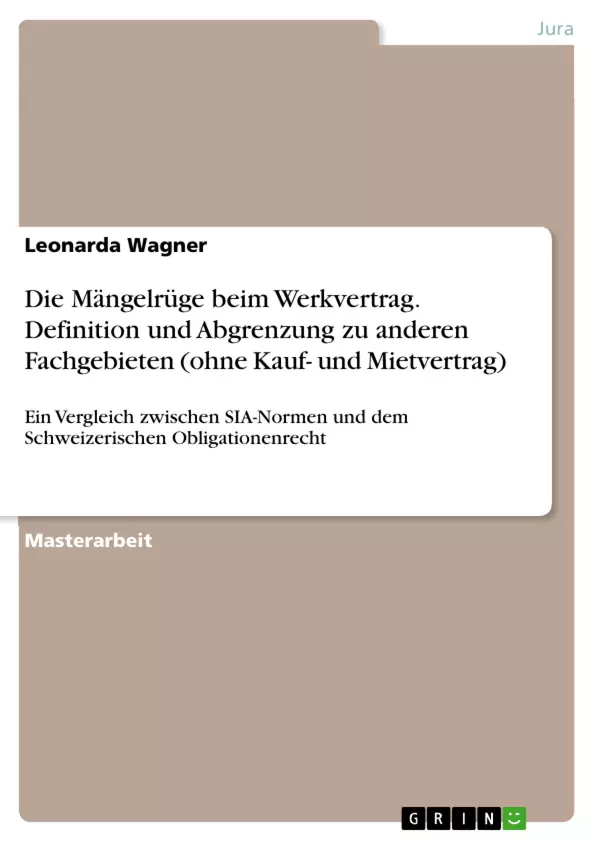Das Ziel der Arbeit ist es, eine analytische Aufarbeitung der Mängelrüge im Werkvertrag vorzunehmen. Hierbei sind die massgeblichen Aspekte zu betrachten, wie sie ihre konkrete Ausgestaltung in der Haftungsbegründung, der Prüfungsobliegenheit wie auch den Form- und Fristvorschriften findet. Im Anschluss sind die Ausarbeitungen zum Werkvertrag in einen Vergleich zu dem Kaufrecht und Mietrecht zu setzen. Hierbei ist aufzuzeigen, inwiefern sich eine Abgrenzung zum Werkvertrag aufgrund der spezifischen Eigenheiten der Vertragsarten ergeben. Die Ergebnisse der analytischen Ausarbeitung werden in Tabellen zusammengefasst und systematisiert.
Die Mängelrüge, wie sie in den synallagmatischen Rechtsverhältnissen des Kauf-, Miet-, Dienst- und auch Werkvertragsrechts anzufinden ist, dient dem Schutz des Gläubigers vor einem mangelhaften Vertragsgegenstand. Liegt ein Mangel vor, steht dem Gläubiger Anspruch auf Mangelhaftung zu. Im Kaufrecht findet diese Gewährleistung ihren Ausdruck in dem Art. 197 OR. Danach haftet der Verkäufer dem Käufer neben den zugesicherten Eigenschaften auch darauf, dass die Sache keine körperlichen oder rechtlichen Mängel aufweist, die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder erheblich mindern.
Die Vorschriften des Kaufrechts lassen sich auch auf das Werkrecht übertragen. Danach hat der Verkäufer eines Werkes nach dessen Lieferung weiterhin für die Mangelfreiheit des Werkes einzustehen. Der Werkvertrag findet seinen rechtlichen Niederschlag in den Art. 363 – 379 OR. Nach Art. 367 Abs. 1 OR ist der Besteller dazu verpflichtet, den Werkhersteller über „allfällige Mängel“ zu unterrichten. Welche Rechte und Pflichten sich auf den beiden Vertragsseiten nachvollziehen lassen, ist der Schwerpunkt der nachfolgenden Ausarbeitung. Dabei ist zwischen den Pflichten des Werkherstellers und den Obliegenheiten des Bestellers zu unterscheiden. Die Analyse der Mängelrüge in dem Werkvertragsrecht dient der Vergleichbarkeit mit anderen Rechtsverhältnissen, wie sie einleitend genannt wurden. Dazu sind vordergründig Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Mängelrüge im Werkvertrag zu dem Kauf- und Mietvertrag aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Hauptteil - Mängelrüge im Werkvertragsrecht
- I. Definition Werkvertrag und Werkmängel
- II. Definition und Rechtsnatur Mängelrüge
- III. Inhalt der Mängelrüge
- IV. Prüfungspflicht
- V. Haftungsbegründung beim Werkvertrag
- 1. Mängel
- a. Unwesentliche Mängel
- b. Wesentliche Mängel
- 2. Offenbare Mängel
- 3. Verdeckte Mängel
- 1. Mängel
- VI. Fristen und Form Mängelrüge
- 1. Fristen
- a. Werkvertrag nach OR
- b. Baurecht nach SIA-Norm 118
- 2. Form und Inhalt der Mängelrüge
- 1. Fristen
- VII. Abgrenzung der Rügepflicht zu dem Kauf- und Mietrecht
- 1. Rügepflicht im Kaufrecht
- a. Definition des Kaufvertrages und Abgrenzung zum Werkvertrag
- 2. Rügepflicht im Mietrecht
- a. Definition des Mietvertrages
- b. Rügepflicht im Mietrecht
- 3. Bedeutung Rügepflicht
- 1. Rügepflicht im Kaufrecht
- C. Schlussfolgerung
- D. Tabellenübersicht: Vergleich OR / SIA Normen
- E. Anlage 1: SIA-WERKVERTRAG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Mängelrüge im Werkvertragsrecht. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen, die Anforderungen an eine wirksame Rüge sowie die Abgrenzung zu ähnlichen Rechtsgebieten (Kauf- und Mietrecht) detailliert darzustellen.
- Definition und Rechtsnatur der Mängelrüge
- Inhaltliche Anforderungen und Rechtsfolgen einer Mängelrüge
- Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Mängeln
- Bedeutung von Fristen und Formvorschriften bei der Mängelrüge
- Abgrenzung der Mängelrüge im Werkvertragsrecht zum Kauf- und Mietrecht
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Dieses Kapitel dient als Einführung in die Thematik der Mängelrüge im Werkvertragsrecht und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit. Es bietet einen Überblick über die zentralen Fragen und Problemfelder, die im Hauptteil vertieft behandelt werden.
B. Hauptteil - Mängelrüge im Werkvertragsrecht: Der Hauptteil analysiert umfassend die Mängelrüge im Werkvertragsrecht. Er beginnt mit der Definition des Werkvertrages und von Werkmängeln und beleuchtet anschließend die Rechtsnatur der Mängelrüge. Es werden die inhaltlichen Anforderungen an eine wirksame Rüge, die Prüfungspflichten des Auftraggebers sowie die Haftungsbegründung im Werkvertragsrecht detailliert untersucht. Besonderes Augenmerk liegt auf der Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Mängeln, offenen und verdeckten Mängeln und der Beweislastverteilung. Der Abschnitt zu den Fristen und der Form der Mängelrüge vergleicht die Bestimmungen des Obligationenrechts (OR) mit den Regelungen der SIA-Norm 118. Schließlich wird die Abgrenzung der Rügepflicht im Werkvertragsrecht zum Kauf- und Mietrecht vorgenommen. Die Kapitel behandeln die jeweilige Rechtslage, Definitionen der jeweiligen Vertragstypen und die relevanten Rügepflichten.
C. Schlussfolgerung: (Ausgeschlossen gemäß Anweisung)
Schlüsselwörter
Mängelrüge, Werkvertragsrecht, Obligationenrecht (OR), SIA-Norm 118, Kaufrecht, Mietrecht, wesentliche Mängel, unwesentliche Mängel, Fristen, Form, Haftung, Prüfungspflicht, Beweislast, Rechtsnatur.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Mängelrüge im Werkvertragsrecht
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Mängelrüge im Werkvertragsrecht. Es behandelt die rechtlichen Grundlagen, Anforderungen an eine wirksame Mängelrüge und die Abgrenzung zu ähnlichen Rechtsgebieten wie Kauf- und Mietrecht.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument umfasst folgende Themen: Definition und Rechtsnatur der Mängelrüge, inhaltliche Anforderungen und Rechtsfolgen einer Mängelrüge, Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Mängeln, Bedeutung von Fristen und Formvorschriften, Abgrenzung der Mängelrüge im Werkvertragsrecht zum Kauf- und Mietrecht, Definition des Werkvertrags und Werkmängeln, Prüfungspflichten des Auftraggebers, Haftungsbegründung im Werkvertragsrecht, Beweislastverteilung, Vergleich der Bestimmungen des Obligationenrechts (OR) mit den Regelungen der SIA-Norm 118.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Einleitung (A), Hauptteil (B), Schlussfolgerung (C), Tabellenübersicht (D) und Anlage (E) gegliedert. Der Hauptteil analysiert detailliert die Mängelrüge im Werkvertragsrecht, einschliesslich Definitionen, Anforderungen, Fristen, Formvorschriften und Abgrenzungen zu anderen Rechtsgebieten.
Welche Rechtsquellen werden berücksichtigt?
Das Dokument bezieht sich auf das Obligationenrecht (OR) und die SIA-Norm 118. Es vergleicht die Bestimmungen beider Rechtsquellen im Kontext der Mängelrüge.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet das Dokument?
Es werden Zusammenfassungen der Einleitung und des Hauptteils gegeben. Die Einleitung dient als Einführung in die Thematik. Der Hauptteil beschreibt die detaillierte Analyse der Mängelrüge im Werkvertragsrecht, inkl. Definitionen, Anforderungen, Fristen, Formvorschriften und Abgrenzungen zu anderen Rechtsgebieten. Die Schlussfolgerung ist laut Anweisung ausgeschlossen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Mängelrüge, Werkvertragsrecht, Obligationenrecht (OR), SIA-Norm 118, Kaufrecht, Mietrecht, wesentliche Mängel, unwesentliche Mängel, Fristen, Form, Haftung, Prüfungspflicht, Beweislast, Rechtsnatur.
Wer ist die Zielgruppe dieses Dokuments?
Das Dokument richtet sich an Personen, die sich akademisch mit dem Thema Mängelrüge im Werkvertragsrecht auseinandersetzen möchten. Es ist für eine strukturierte und professionelle Themenanalyse gedacht.
Welche Anlagen enthält das Dokument?
Das Dokument enthält eine Anlage (Anlage 1: SIA-WERKVERTRAG).
- Citation du texte
- Leonarda Wagner (Auteur), 2017, Die Mängelrüge beim Werkvertrag. Definition und Abgrenzung zu anderen Fachgebieten (ohne Kauf- und Mietvertrag), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375184