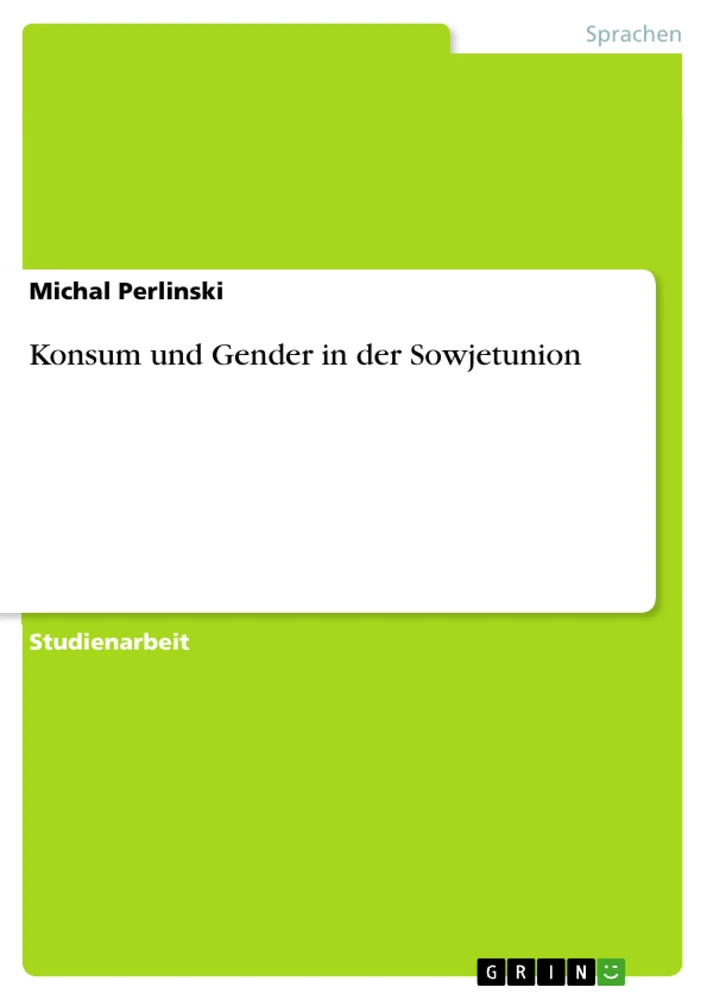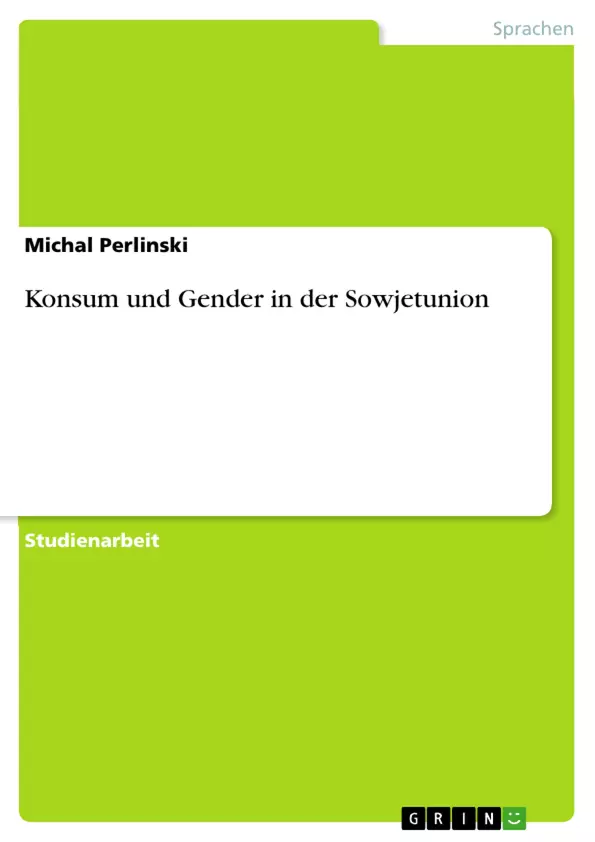Die vorliegende Seminararbeit soll folgenden wissenschaftlichen Leitfragen nachgehen: Wie genau lässt sich der Begriff Konsum definieren? Wie lässt sich der Konsum beziehungsweise das Konsumverhalten aus volks- und kulturwissenschaftlicher Sicht in den Kontext der Sowjetunion einbinden? Inwiefern lässt sich die volkswirtschaftliche Lage in der Sowjetunion im Zeitraum 1917-1989 in Epochen unterteilen und wie unterscheiden sich diese in ihrer Entwicklung voneinander? Wie stellt sich die Rolle der Frau in der Sowjetunion im genannten Zeitraum dar und wie lassen sich vor diesem Hintergrund Konsum und Gender einordnen? Im Vordergrund soll zudem die sowjetische Tragikomödie Služebnyj roman von Ėl’dar Aleksandrovič Rjazanov und Ėmil’ Beniaminovič Braginskij aus dem Jahr 1977 stehen. Anhand ausgewählter relevanter Filmszenen soll eine Gegenüberstellung mit dem Forschungsstand der in der vorliegenden Seminararbeit verwendeten Literatur erfolgen, die die Arbeit abrundet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Epoche des Kalten Krieges in der Sowjetunion
- Kurzer historischer Überblick
- Die 1970er Jahre und der Fünfjahresplan
- Sowjetischer Konsum
- Definition des Begriffs Konsum
- Konsumideologie
- Staat und Konsum in der Zentralverwaltungswirtschaft
- Luxus im Sozialismus
- Konsum und Gender
- Definition des Begriffs Gender
- Konsum und Geschlechterverhältnisse
- Die Rolle der Frau in der Sowjetunion
- Der Film Služebnyj roman (1977)
- Handlung des Films
- Vorstellung relevanter Schlüsselszenen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Konsumkultur in der Sowjetunion während des Kalten Krieges und analysiert den Einfluss dieser auf die Geschlechterverhältnisse. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie der Begriff „Konsum“ im Kontext der Sowjetunion zu verstehen ist und wie sich das Konsumverhalten vor dem Hintergrund der politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten entwickelte. Die Arbeit analysiert die Rolle der Frau in der Sowjetunion und untersucht, inwieweit Konsum und Gender in den gesellschaftlichen Kontext eingebunden waren.
- Konsumkultur im Kalten Krieg
- Konsum und Gender in der Sowjetunion
- Rolle der Frau in der Sowjetunion
- Einfluss von Politik und Wirtschaft auf das Konsumverhalten
- Analyse des Films „Služebnyj roman“
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des Themas Konsum und Gender in der Sowjetunion und stellt die Forschungslücke im wissenschaftlichen Diskurs fest. Sie benennt die Leitfragen der Arbeit und erläutert die Vorgehensweise.
- Die Epoche des Kalten Krieges in der Sowjetunion: Dieses Kapitel beschreibt die politische Situation in der Sowjetunion nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Es behandelt die sowjetische Integration von Interessengebieten nach dem Hitler-Stalin-Pakt, die Epoche des Stalinismus und die Entwicklung des Kalten Krieges.
- Sowjetischer Konsum: Dieses Kapitel analysiert den Begriff „Konsum“ in der Sowjetunion und stellt die Konsumideologie im Kontext der Zentralverwaltungswirtschaft dar. Es beleuchtet die Rolle von Luxus im Sozialismus und die Bedeutung der staatlichen Lenkung des Konsums.
- Konsum und Gender: In diesem Kapitel wird der Begriff „Gender“ definiert und die Verknüpfung von Konsum und Geschlechterverhältnissen in der Sowjetunion erörtert. Es wird die Rolle der Frau in der Sowjetunion im Kontext von Konsum und Gender untersucht.
- Der Film Služebnyj roman (1977): Dieser Abschnitt stellt die Handlung des Films „Služebnyj roman“ von Ėl'dar Aleksandrovič Rjazanov und Ėmil Beniaminovič Braginskij aus dem Jahr 1977 vor und präsentiert relevante Schlüsselszenen. Die Analyse des Films soll den Forschungsstand der Seminararbeit ergänzen.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit fokussiert auf die Themenfelder Konsum, Gender, Kalter Krieg, Sowjetunion, Zentralverwaltungswirtschaft, Film „Služebnyj roman“, Rolle der Frau, Konsumideologie, Luxus im Sozialismus, Geschlechterverhältnisse, volkswirtschaftliche Lage und historische Entwicklungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Konsum in der Sowjetunion definiert?
Die Arbeit untersucht Konsum aus volks- und kulturwissenschaftlicher Sicht im Kontext einer Zentralverwaltungswirtschaft.
Welche Rolle spielte Gender beim sowjetischen Konsum?
Die Arbeit analysiert die spezifische Rolle der Frau und wie Geschlechterverhältnisse das Konsumverhalten und die Konsumideologie beeinflussten.
Was war die Konsumideologie im Sozialismus?
Es wird untersucht, wie der Staat Konsum lenkte und welche Rolle „Luxus“ in einer Gesellschaft spielen konnte, die offiziell auf Gleichheit basierte.
Welcher Film dient als Grundlage für die Analyse?
Die Tragikomödie „Služebnyj roman“ (1977) von Rjazanov und Braginskij wird anhand relevanter Schlüsselszenen ausgewertet.
Welcher Zeitraum wird in der Arbeit betrachtet?
Die Untersuchung umfasst die Jahre 1917 bis 1989, mit einem besonderen Fokus auf die Ära des Kalten Krieges und die 1970er Jahre.
- Citation du texte
- Michal Perlinski (Auteur), 2014, Konsum und Gender in der Sowjetunion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375231