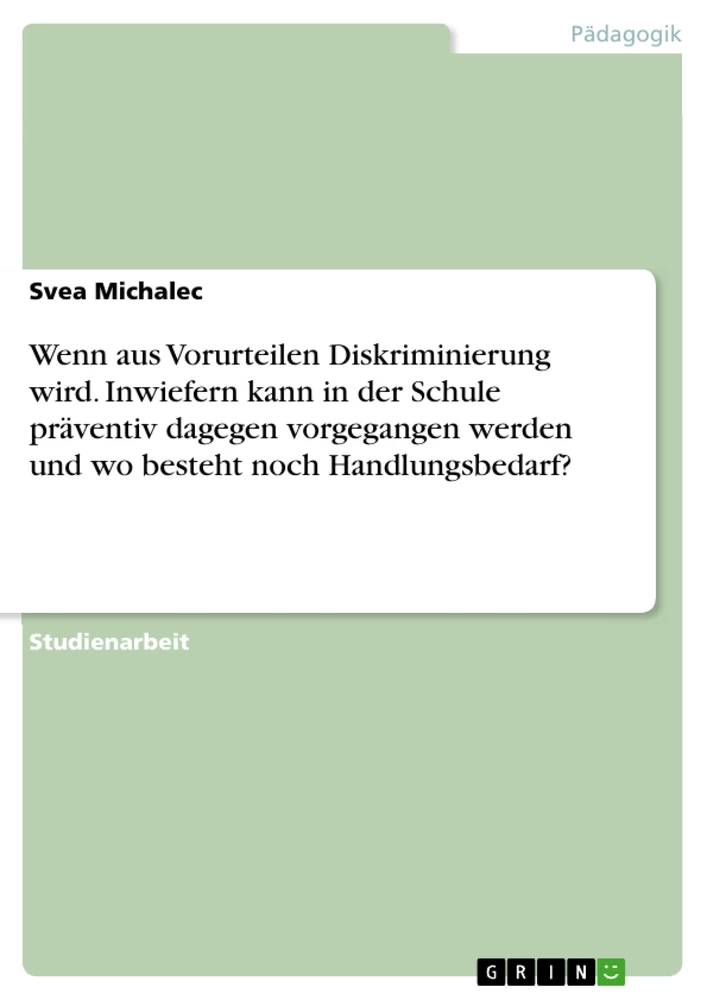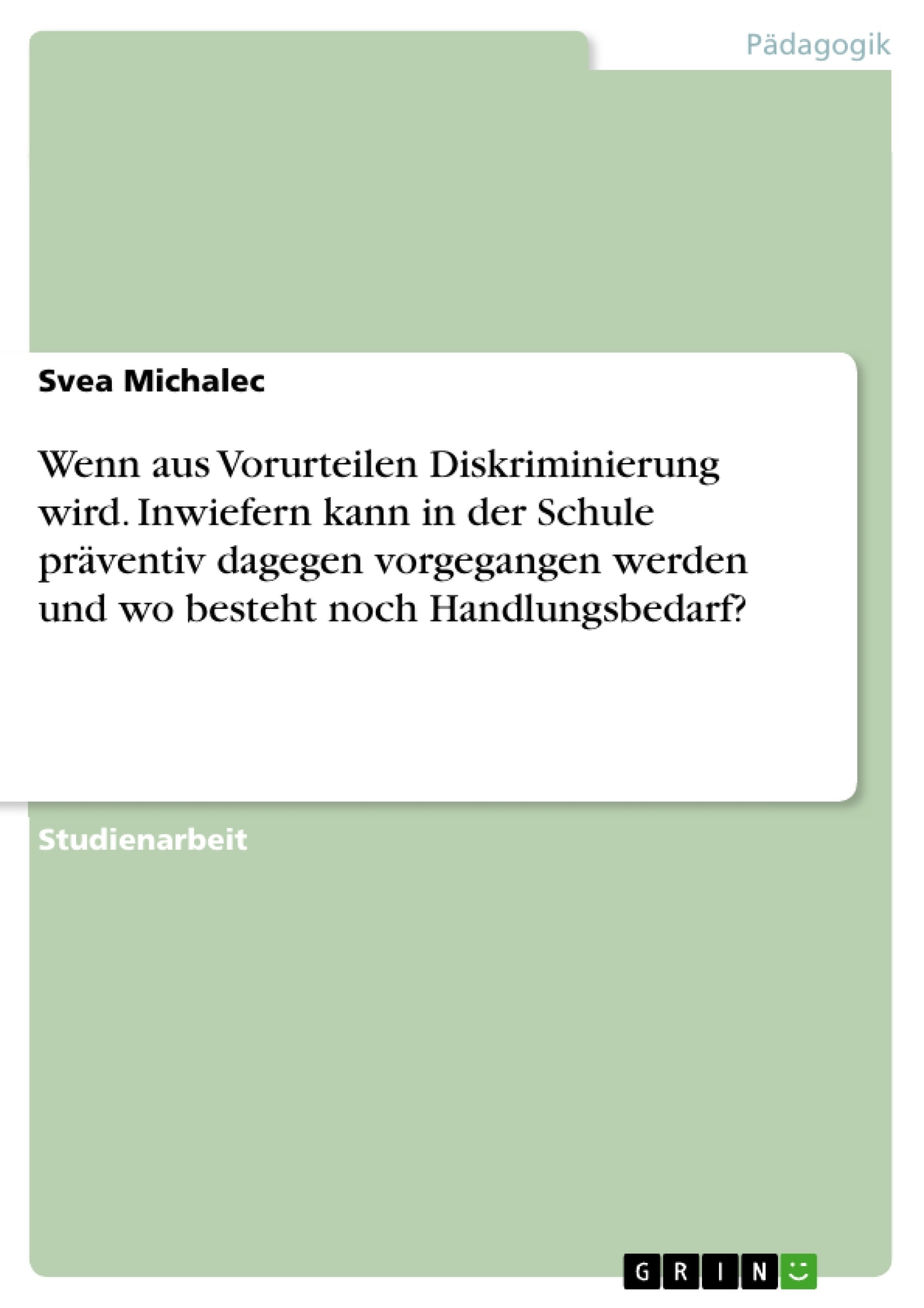Diese Arbeit widmet sich der Problematik von Vorurteilen und der damit verbundenen Ausgrenzung und Diskriminierung. Sie hat einerseits das Verständnis über das komplexe Phänomen der Diskriminierung, andererseits den Einblick in die Möglichkeiten einer Prävention im Bereich der Schule zum Ziel.
Drei Fragestellungen sind hier von Bedeutung: Was versteht man unter dem Begriff Diskriminierung? Was sind Ursachen von Diskriminierung? Welche Möglichkeiten zur Prävention von Diskriminierung gibt es und wo besteht noch Handlungsbedarf? Entsprechend den drei zu behandelten Fragestellungen ist die Arbeit wie folgt gegliedert: In einem einleitenden Kapitel werden relevante Begrifflichkeiten aufgearbeitet, verschiedene Formen einer Diskriminierung erläutert und mögliche Anhaltspunkte für eine Ungleichbehandlung aufgezeigt. Damit wird eine theoretische Grundlage für die weiteren Ausführungen geschaffen. Darauf aufbauend werden mögliche Ursachen und Folgen einer Diskriminierung betrachtet. Mit diesem Teil kommt es zur Klärung der ersten beiden Fragestellungen. Im Anschluss daran wird der Frage nachgegangen, welche Möglichkeiten zur Prävention von Diskriminierung bereits bestehen. Dazu wird es einen Einblick in den Umgang mit Diskriminierung in Bildungsinstitutionen geben. Verschiedene Präventions- bzw. Interventionsmöglichkeiten werden dazu erörtert und der Handlungsbedarf der aus unserer Sicht noch besteht, diskutiert. In der abschließenden Diskussion werden die wichtigsten Schlussfolgerungen dieser Arbeit resümiert.
Unsere Umwelt ist vielfältig und extrem komplex, dennoch bringen wir es innerhalb kurzer Zeit fertig, handlungsfähig zu sein. Dazu muss eine gewisse Einordnung der uns umgebenden Personen und Dinge erfolgen, indem bestimmte Gruppen gebildet und ähnliche Dinge zusammengefasst werden. Nicht nur Gegenstände, sondern auch soziale Objekte werden klassifiziert. So werden Stühle und Tische Möbeln zugeordnet; Fußballspielerinnen und Spieler, Schwimmerinnen und Schwimmer zu Sportlern zusammengefasst. Dieses „Schubladendenken“ ist aufgrund unserer begrenzten kognitiven Kapazitäten unvermeidlich. Dem Gehirn gelingt es nicht, jeden einzelnen Reiz der Umwelt individuell aufzunehmen und zu verarbeiten: Vorurteile haben jedoch eine problematische Kehrseite: Befangene Meinungen verfälschen den Blick auf die Wirklichkeit und können bequeme Pauschalurteile zur Folge haben. Dies kann gefährlich werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Begriffsklärung
- Diskriminierungsformen
- Diskriminierungsdimensionen
- Funktionen und Ursachen von Diskriminierung
- Die vorurteilsbehaftete Persönlichkeit
- Theorie des realistischen Gruppenkonflikts
- Bloße Kategorisierung
- Theorien der sozialen Identität
- Folgen und Wirkungen von Diskriminierung
- Konfliktverringerung zwischen sozialen Gruppen
- Kontakthypothese
- Das Modell der Dekategorisierung
- Das Modell der gemeinsamen Eigengruppenidentität
- Das Modell der wechselseitigen Distinktheit
- Kontakthypothese
- Prävention im schulischen Kontext
- Anti-Bias: Ein Ansatz der antidiskriminierenden Bildungsarbeit
- Was ist das eigentlich?
- Zielsetzung
- Praxisbezug – Beispiele für vorurteilsbewusste Lernumgebungen
- Anti-Bias: Ein Ansatz der antidiskriminierenden Bildungsarbeit
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem komplexen Phänomen der Diskriminierung und analysiert die Ursachen, Folgen und Möglichkeiten der Prävention im schulischen Kontext. Ziel ist es, ein tiefergehendes Verständnis für die Ursachen und Auswirkungen von Diskriminierung zu entwickeln und konkrete Handlungsansätze für einen antidiskriminierenden Umgang in Bildungseinrichtungen aufzuzeigen.
- Begriffliche Klärung und Abgrenzung verschiedener Formen von Diskriminierung
- Analyse sozialpsychologischer Theorien zur Erklärung von Diskriminierung
- Bewertung der Folgen von Diskriminierung für Betroffene und die Gesellschaft
- Vorstellung und kritische Betrachtung verschiedener Ansätze zur Konfliktverringerung und Prävention von Diskriminierung
- Entwicklung von konkreten Handlungsempfehlungen für die antidiskriminierende Bildungsarbeit in Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Diskriminierung anhand von aktuellen Beispielen und Statistiken vor und leitet zu den zentralen Fragestellungen der Arbeit über. In den theoretischen Grundlagen werden zunächst der Begriff der Diskriminierung geklärt, verschiedene Formen und Dimensionen der Diskriminierung dargestellt sowie die rechtliche Grundlage für die Bekämpfung von Diskriminierung erläutert.
Im Anschluss wird auf die Ursachen von Diskriminierung eingegangen, wobei verschiedene sozialpsychologische Theorien beleuchtet werden, die das Phänomen der Diskriminierung aus unterschiedlichen Perspektiven erklären. Die Folgen und Wirkungen von Diskriminierung werden ebenfalls betrachtet, wobei die Auswirkungen auf die Betroffenen sowie die Gesellschaft im Fokus stehen.
Um dem Problem der Diskriminierung entgegenzuwirken, wird im nächsten Abschnitt die Kontakthypothese und verschiedene Modelle zur Konfliktverringerung zwischen sozialen Gruppen vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Möglichkeiten, intergruppen Beziehungen positiv zu beeinflussen und Vorurteile abzubauen.
Im Hinblick auf die Prävention von Diskriminierung in Bildungseinrichtungen wird der Ansatz des Anti-Bias im Detail vorgestellt und diskutiert. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von vorurteilsbewussten Lernumgebungen, die den Bedürfnissen aller Schüler gerecht werden und Diskriminierung vorbeugen.
Schlüsselwörter
Diskriminierung, Vorurteile, soziale Ungleichheit, intergruppen Beziehungen, Kontakthypothese, Anti-Bias, Bildungsarbeit, Prävention, Schule, Lernumgebungen, Diversität, Inklusion, Integration, Menschenrechte, Gleichstellung, Chancengleichheit
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Vorurteil und Diskriminierung?
Vorurteile sind befangene Meinungen oder Einstellungen; Diskriminierung ist die daraus resultierende Handlung der Benachteiligung oder Ausgrenzung von Personen.
Warum neigen Menschen zum "Schubladendenken"?
Aufgrund begrenzter kognitiver Kapazitäten kategorisiert das Gehirn Informationen und Personen, um die komplexe Umwelt schnell einzuordnen und handlungsfähig zu bleiben.
Was ist der "Anti-Bias"-Ansatz in der Schule?
Anti-Bias ist ein pädagogischer Ansatz zur vorurteilsbewussten Bildung, der darauf abzielt, Diskriminierung in Lernumgebungen aktiv abzubauen und Vielfalt zu fördern.
Was besagt die Kontakthypothese?
Die Hypothese besagt, dass Vorurteile zwischen Gruppen durch direkten Kontakt unter bestimmten Bedingungen (z. B. gemeinsame Ziele, Gleichrangigkeit) verringert werden können.
Welche Folgen hat Diskriminierung für die Betroffenen?
Diskriminierung kann zu psychischen Belastungen, vermindertem Selbstwertgefühl, sozialer Isolation und schlechteren Bildungs- oder Berufschancen führen.
- Citar trabajo
- Svea Michalec (Autor), 2015, Wenn aus Vorurteilen Diskriminierung wird. Inwiefern kann in der Schule präventiv dagegen vorgegangen werden und wo besteht noch Handlungsbedarf?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375304