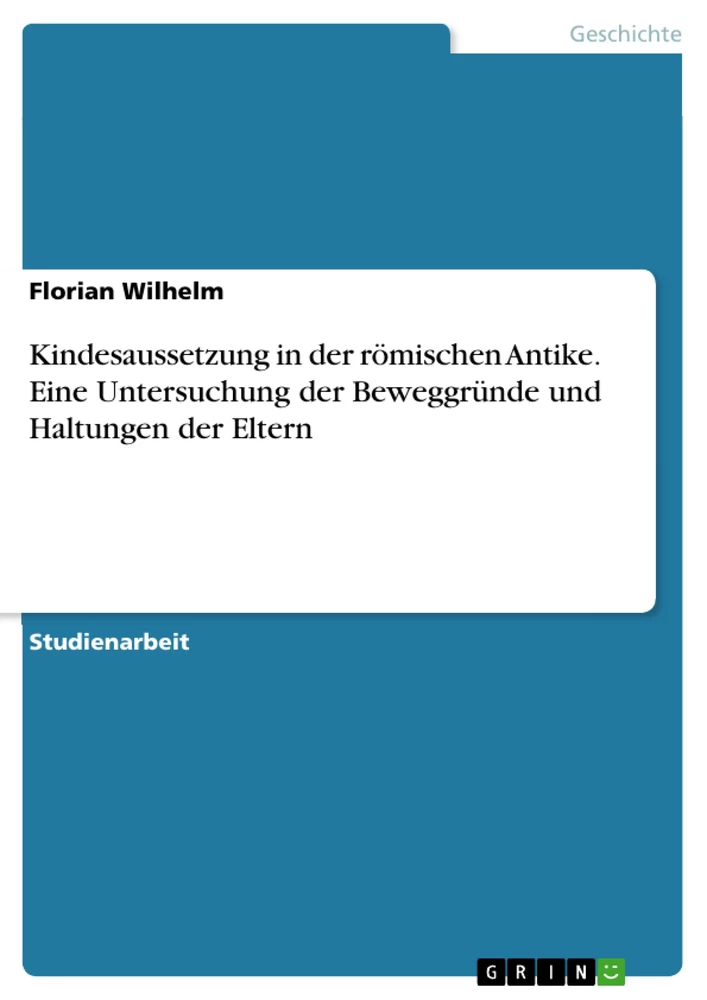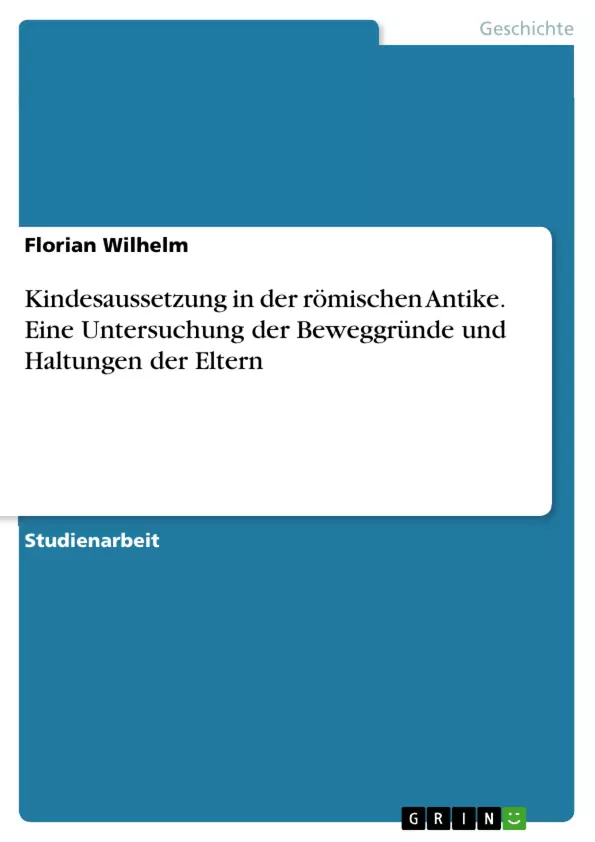Kann Kindesaussetzung in der römischen Antike per se mit Emotionslosigkeit der Eltern in Verbindung gebracht werden und kann dieses Phänomen trotz unserer heutigen moralischen Vorstellungen nachvollzogen werden?
In der Forschung wird vermehrt die Häufigkeit des Zurückgreifens auf die Kindesaussetzung kontrovers diskutiert. Manche Forscher erachten die Kindestötung als eine kaum bedeutsame Größe8 oder begründen deren geringes Vorkommen damit, dass bei einer hohen Anzahl an Kindesaussetzungen auch die Bevölkerungszahl hätte abnehmen müssen. Auf der anderen Seite sprechen sich unter anderem Harris und Boswell für eine weite Verbreitung der Kindesaussetzung aus. Corbier beschreibt die Kindesausaussetzung als ein Phänomen, welches auch nach dessen Verbot weiterhin praktiziert wurde, wenngleich das Ausmaß nicht genau beziffert werden könne. Auch in der neueren Forschung wird die Kindesaussetzung als ein verbreitetes Phänomen angesehen.
Die Frage des Vorhandenseins von Emotionen seitens der aussetzenden Eltern und deren Einstellung zum Kind wird jedoch oftmals nicht ausführlich diskutiert oder lediglich am Rande erwähnt. Aufgrund dessen sollen mit dieser Untersuchung Beweggründe und Umstände der Kindesaussetzung herausgearbeitet werden, um anhand dieser auf die emotionale Gefühlslage der aussetzenden Eltern zu schließen.
Darüber hinaus werden die Schriften bedeutender antiker Autoren sowie Gesetzestexte quellenkritisch betrachtet und diskutiert, um Erkenntnisse zur moralischen Haltung gegenüber der Kindesaussetzung zu gewinnen.
Die Untersuchung endet mit einem Fazit, in dem die herausgearbeiteten Erkenntnisse zusammengefasst, zueinander in Bezug gesetzt und hinsichtlich der Fragestellung diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Familienplanung in der römischen Antike
- Beweggründe für die Kindesaussetzung
- Gesellschaftliche und individuelle Haltungen zur Kindesaussetzung
- Diskussion über die Beweggründe und über die Haltungen zur Kindesaussetzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht, ob die Kindesaussetzung im Römischen Reich per se mit Emotionslosigkeit der Eltern gegenüber ihren Kindern verbunden werden kann. Dabei wird die Frage beleuchtet, ob dieses Phänomen trotz unserer heutigen moralischen Vorstellungen nachvollzogen werden kann.
- Familienplanung in der römischen Antike: Staatliche versus familiäre Interessen
- Beweggründe für die Kindesaussetzung: Armut, Behinderung, Aberglaube
- Gesellschaftliche Haltungen zur Kindesaussetzung: Moralische Verwerfung versus Akzeptanz
- Individuelle Haltungen der Eltern: Emotionale Betroffenheit und Motivationen
- Kontroversen in der Forschung: Häufigkeit und Bedeutung der Kindesaussetzung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Problematik der Kindesaussetzung in der römischen Antike im Vergleich zu unserer heutigen moralischen Vorstellung dar. Es wird auf die hohe Sterblichkeitsrate von Kleinkindern zu dieser Zeit hingewiesen und die Frage nach der emotionalen Haltung der Eltern gestellt.
- Familienplanung in der römischen Antike: Dieser Abschnitt beleuchtet die Familienplanung in der römischen Antike und unterscheidet zwischen den Interessen des Staates und der Familien. Während der Staat eine hohe Geburtenrate anstrebte, setzten Familien eher auf Familienbegrenzung. Die Kindesaussetzung stellt in diesem Kontext eine mögliche Strategie der Familienbegrenzung dar.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Kindesaussetzung, Familienplanung, moralische Haltungen, emotionale Befindlichkeit, römische Antike, Bevölkerungsentwicklung, Staatsinteressen, familiäre Interessen, Quellenkritik, antike Autoren.
- Citar trabajo
- Florian Wilhelm (Autor), 2016, Kindesaussetzung in der römischen Antike. Eine Untersuchung der Beweggründe und Haltungen der Eltern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375642