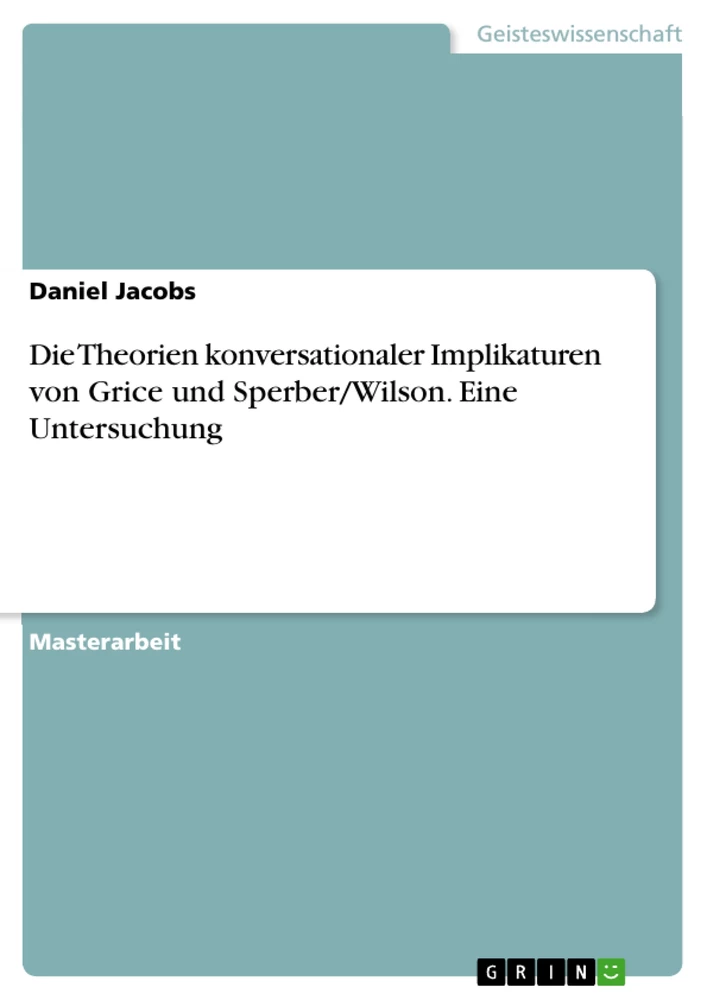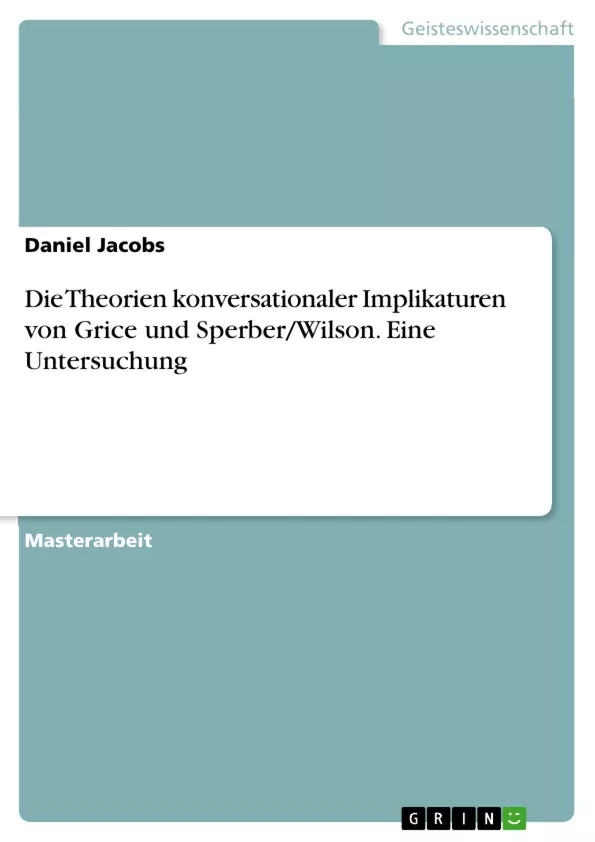Speziell die Analyse und Reflexion des Untersuchungsgegenstands „Sprache“ mittels Sprache kennzeichnet das Verhältnis von Sprache und philosophischer Tätigkeit, da nicht zuletzt auch Aussagen und Urteile über etwas, spezifisch-sprachliche Entitäten darstellen und daher in besonderer Weise an Sprache gebunden sind. Wahres und Falsches besitzen im Gegensatz zu Fakten oder Ereignissen die Eigenschaft der Propositionalität und werden in verschiedener Gestalt als Gedanken, Begriffe, Vorstellungen, Aussagen, Urteile usw. gekennzeichnet. Es besteht offenbar daher auch ein Zusammenhang zwischen Sachverhalten und der diese beschreibenden Sprache. Verstehen im Allgemeinen scheint demnach auch immer sprachliches Verstehen zu implizieren oder vorauszusetzen. So prägte einer der bekanntesten Philosophen der Neuzeit – Ludwig Wittgenstein – in seinem Werk „Tractatus logico-philosophicus“ den Satz „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ Diese wirklichkeitserschließende Kraft von Sprache sollte auch die gesamte Geschichte der Sprachphilosophie als eine zentrale sprachreflektierende Tätigkeit prägen.
Mit fortschreitender Zeit wurde demnach das Bedingungsverhältnis zwischen Sprache, Denken und Wirklichkeit in den Fokus der Untersuchung sprachphilosophischer Bemühungen gestellt. Hierbei wurden im Laufe zahlreicher Sprachanalysen verschiedene Sprachauffassungen mit entsprechend unterschiedlichen Schwerpunkten, Relationen und Gewichtungen dieser drei Begriffe entwickelt, verfasst und begründet. Die Benennungs- und Bedeutungsproblematik sowie die damit verbundene Funktionsweise von Sprache wurden hierbei mit fortschreitender Zeit zu dominierenden Themen und stellen auch das Thema dieser Arbeit. So bildete sich im Laufe neuzeitlicher Denkweisen der weite Bereich der Philosophie der idealen Sprache heraus, der seinen eigentlichen Ausgangspunkt in Gottlob Freges Sprachphilosophie fand. Für diese Sprachauffassung maßgeblich wurde die Annahme, dass der Alltagssprache eine gewisse Unschärfe oder Ungenauigkeit anhaftet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grices Theorie konversationaler Implikaturen
- 2.1 Pragmatisches Programm, Kooperationsprinzip und Gesprächsmaximen
- 2.2 Konversationale Implikaturen
- 2.3 Probleme
- 3 Sperber/Wilsons Relevanztheorie
- 3.1 Kritik an Grice
- 3.2 Relevanzansatz
- 3.3 Probleme
- 4 Kritische Diskussion
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit setzt sich zum Ziel, die Theorien konversationaler Implikaturen von Grice und Sperber/Wilson zu untersuchen und zu vergleichen. Dabei werden sowohl die zentralen Annahmen beider Theorien als auch ihre Stärken und Schwächen beleuchtet.
- Die Rolle von Sprache in der Kommunikation und Erkenntnis
- Die Bedeutung von pragmatischen Prinzipien für das Verständnis von Sprache
- Der Vergleich von Grice's Theorie konversationaler Implikaturen und Sperber/Wilsons Relevanztheorie
- Die Rolle von konversationalen Implikaturen in der Kommunikation
- Die Anwendung der Theorien auf konkrete Sprachbeispiele
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der konversationalen Implikaturen ein und erläutert die Bedeutung von Sprache für die Kommunikation und Erkenntnis. Es werden die zentralen Fragen der Arbeit vorgestellt, die in den folgenden Kapiteln behandelt werden.
- Kapitel 2: Grices Theorie konversationaler Implikaturen: Dieses Kapitel stellt Grices Theorie konversationaler Implikaturen vor. Es werden das pragmatische Programm, das Kooperationsprinzip, die Gesprächsmaximen und der Begriff der konversationalen Implikatur erläutert. Außerdem werden einige Kritikpunkte an Grices Theorie diskutiert.
- Kapitel 3: Sperber/Wilsons Relevanztheorie: Dieses Kapitel präsentiert Sperber/Wilsons Relevanztheorie als eine Alternative zu Grices Theorie. Es werden die Kritikpunkte an Grice sowie die zentralen Annahmen der Relevanztheorie erläutert. Auch die Probleme der Relevanztheorie werden diskutiert.
- Kapitel 4: Kritische Diskussion: In diesem Kapitel werden die beiden Theorien von Grice und Sperber/Wilson kritisch miteinander verglichen und gegenübergestellt. Die Stärken und Schwächen beider Ansätze werden diskutiert und es wird versucht, ein umfassendes Bild der jeweiligen Theorie zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen und Themen der Pragmatik, insbesondere mit konversationalen Implikaturen und deren Bedeutung für das Verständnis sprachlicher Kommunikation. Zu den wichtigsten Schlüsselwörtern gehören: Pragmatik, Konversationelle Implikaturen, Kooperationsprinzip, Gesprächsmaximen, Relevanztheorie, Relevanz, Implikatur, Kommunikation.
- Quote paper
- Daniel Jacobs (Author), 2017, Die Theorien konversationaler Implikaturen von Grice und Sperber/Wilson. Eine Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375649