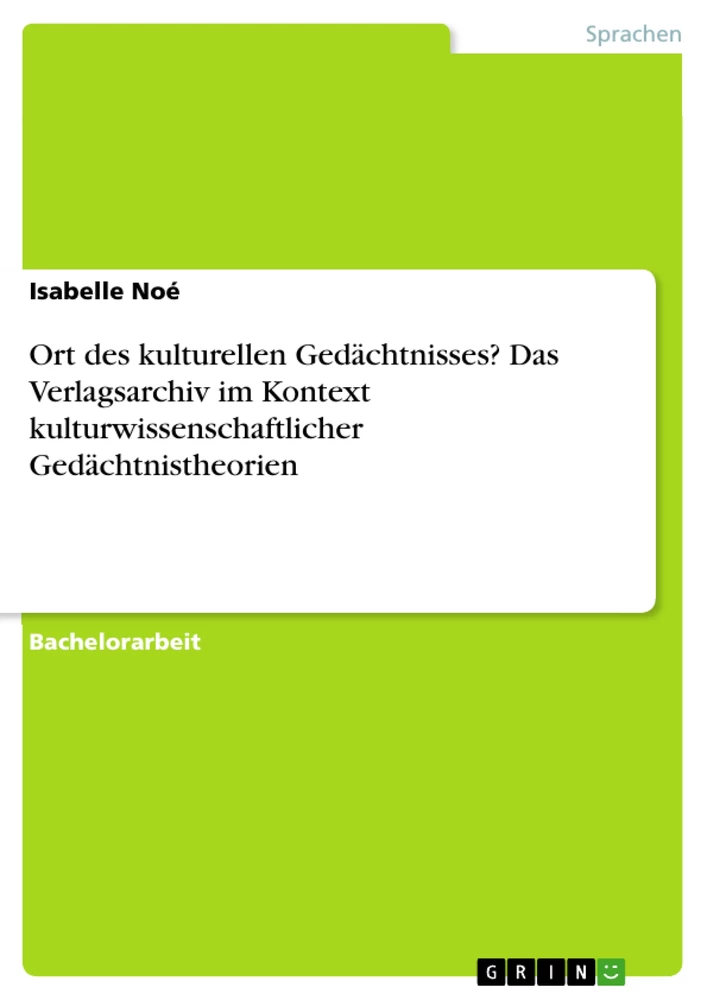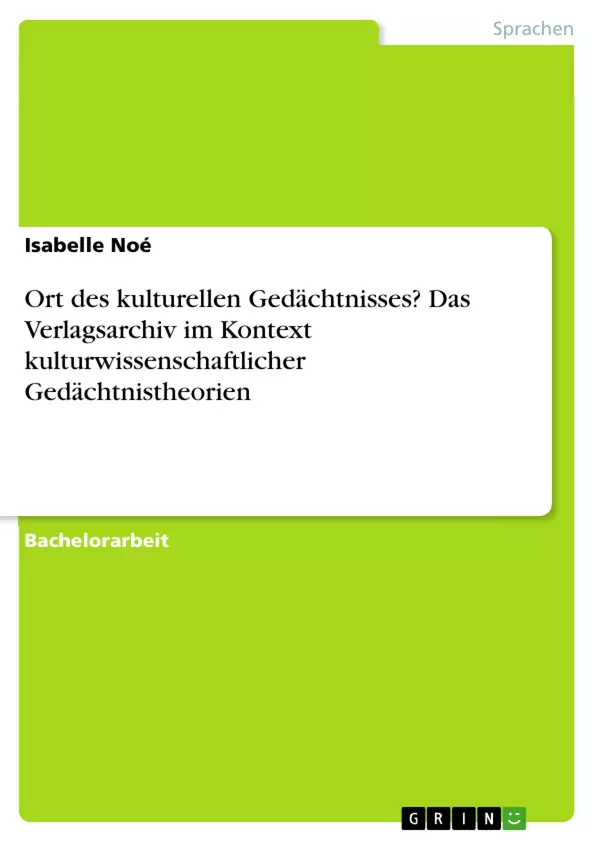Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage nach der Bedeutung von Verlagsarchiven für die Etablierung des kulturellen Gedächtnisses. Verlagsarchive nehmen durch ihren hybriden Charakter eine besondere Stellung ein; sie sind zugleich Firmen- bzw. Wirtschaftsarchiv und Kulturgut, da sie auf der Verlagsarbeit beruhen die ebenso eine ökonomische wie kulturelle Rolle einnimmt. Der Begriff des Archivs unterliegt einer Bedeutungsvielfalt und einem ständigen Wandel und Aktualisierung, so dass keine allgemeingültige Definition getroffen werden kann. Der Archivbegriff ist im Folgendem als ein Ort der Ansammlung zu verstehen, der Aufbewahrungs-, Ordnungs- und Erschließungsfunktionen übernimmt und dadurch Wissen zur Bewertung, Interpretation und Aufbereitung bereitstellt. Da Kollektive kein Gedächtnis „besitzen“, müssen sie, anhand von kulturellen Überlieferungen, ein Gedächtnis entwickeln, um Erinnerungen zu bewahren. Bislang fehlt ein gefestigtes Bewusstsein für den angemessenen Umgang mit Verlagsarchiven und ihren Wert für die geistes- und kulturwissenschaftliche sowie wirtschafts- und wissenschaftsgeschichtliche Forschung.
In der vorliegenden Arbeit wird die These verfolgt, dass Verlagsarchive einen entscheidenden Einfluss auf die kultur- und buchhistorische Forschung haben und dadurch das kollektive Gedächtnis prägen und verändern können. Ziel der Arbeit ist es, im Kontext von drei grundlegenden kulturwissenschaftlichen Gedächtnistheorien zur Entwicklung und Verortung kollektiver Erinnerungen, die Bedeutung von Verlagsarchiven herauszustellen.
Anhand der ausgewählten kulturwissenschaftlichen Gedächtnistheorien wird der Untersuchungsrahmen gebildet an dem das Verlagsarchiv zunächst hinsichtlich seiner Leistung untersucht wird. Um der Bedeutung von Verlagsarchiven für das kulturelle Gedächtnis nachzugehen wird erläutert welche Funktionen Verlagsarchive erfüllen und welchen Nutzen, abhängig von der jeweiligen Benutzerperspektive, aus der Erschließung und Erhaltung eines Verlagsarchivs gezogen werden kann und wo diese im Kontext des kollektiven Gedächtnisses einzuordnen sind. Des Weiteren wird auf die Verantwortung und die Macht von Verlagsarchiven, durch die Selektion des Archivguts, aufmerksam gemacht und dargestellt welche Folgen dies für die Etablierung des kulturellen Gedächtnisses hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien
- Das kollektive Gedächtnis
- Konzept der „lieux de mémoire”
- Das kulturelle Gedächtnis
- Was leisten Verlagsarchive?
- Funktionen und Nutzen
- Selektion des Archivguts: Verantwortung und Macht
- Das Verlagsarchiv Gebauer und Schwetschke
- Etablierung kollektiver Erinnerungen durch das Verlagsarchiv
- Verortung des Verlagsgedächtnisses
- Das Verlagsarchiv als Speichergedächtnis: Auswirkungen und Nutzen
- Zur Bedeutung von Verlagsarchiven für das kulturelle Gedächtnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung von Verlagsarchiven für die Etablierung des kulturellen Gedächtnisses. Sie argumentiert, dass Verlagsarchive einen entscheidenden Einfluss auf die kultur- und buchhistorische Forschung haben und dadurch das kollektive Gedächtnis prägen und verändern können.
- Die Bedeutung von Verlagsarchiven für die kultur- und buchhistorische Forschung.
- Die Rolle von Verlagsarchiven bei der Etablierung des kollektiven Gedächtnisses.
- Die Untersuchung des Verlagsarchivs Gebauer und Schwetschke als Fallbeispiel.
- Die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Verlagsarchiv und das kulturelle Gedächtnis.
- Die Relevanz von Verlagsarchiven für interdisziplinäre Forschung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die Relevanz von Verlagsarchiven für das kulturelle Gedächtnis, ausgehend von einem Aufruf zur Sicherung und Aufbewahrung von Verlagsunterlagen. Es wird auf die hybride Natur von Verlagsarchiven als Firmen- und Kulturgut sowie auf die Bedeutung des Archivbegriffs als Ort der Ansammlung und Wissensproduktion hingewiesen.
- Kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Theorien des kollektiven Gedächtnisses, wie das Konzept des "lieux de mémoire" und das kulturelle Gedächtnis, die den theoretischen Rahmen für die Untersuchung von Verlagsarchiven bilden.
- Was leisten Verlagsarchive?: Es werden die Funktionen und der Nutzen von Verlagsarchiven beleuchtet, die je nach Benutzerperspektive unterschiedlich sind. Des Weiteren wird die Verantwortung und die Macht von Verlagsarchiven hinsichtlich der Selektion des Archivguts und ihren Auswirkungen auf die Etablierung des kulturellen Gedächtnisses hervorgehoben.
- Das Verlagsarchiv Gebauer und Schwetschke: Dieses Kapitel stellt das Verlagsarchiv Gebauer und Schwetschke als Fallbeispiel vor und zeigt auf, welche Erinnerungen anhand des Archivguts rekonstruiert und dargestellt werden können. Es werden die Auswirkungen des Archivs auf das kulturelle Gedächtnis und dessen Einfluss auf die gegenwärtige Gesellschaft beleuchtet. Die Verortung des Verlagsgedächtnisses im Kontext der Digitalisierung wird ebenfalls untersucht.
- Zur Bedeutung von Verlagsarchiven für das kulturelle Gedächtnis: Dieses Kapitel betrachtet die Rolle von Verlagsarchiven in der Forschung und für die Etablierung des kollektiven Gedächtnisses. Es wird deutlich, dass Verlagsarchive einen wichtigen Beitrag zur interdisziplinären Forschung in verschiedenen Bereichen leisten.
Schlüsselwörter
Verlagsarchive, kulturelles Gedächtnis, kollektives Gedächtnis, „lieux de mémoire”, Buchgeschichte, Verlagsgeschichte, Digitalisierung, interdisziplinäre Forschung, Gebauer und Schwetschke, Archivgut, Erinnerungskultur.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Verlagsarchive für das kulturelle Gedächtnis wichtig?
Verlagsarchive dokumentieren nicht nur Wirtschaftsgeschichte, sondern auch die Entstehung von Kulturgut und den intellektuellen Diskurs einer Epoche.
Was bedeutet der "hybride Charakter" eines Verlagsarchivs?
Sie sind gleichzeitig Firmenarchive (ökonomische Daten) und Kulturarchive (Korrespondenzen mit Autoren, Manuskripte), was sie für verschiedene Forschungsdisziplinen wertvoll macht.
Welche Rolle spielt die Selektion des Archivguts?
Archivare besitzen die "Macht", zu entscheiden, was aufbewahrt wird. Diese Selektion bestimmt maßgeblich, welche Informationen für zukünftige Interpretationen der Geschichte zur Verfügung stehen.
Was sind "Lieux de mémoire" im Kontext von Verlagen?
Das Konzept der "Erinnerungsorte" nach Pierre Nora lässt sich auf Verlage anwenden, die als Kristallisationspunkte kollektiver Identität und kultureller Überlieferung fungieren.
Wie beeinflusst die Digitalisierung das Verlagsgedächtnis?
Die Digitalisierung ermöglicht einen leichteren Zugang zu Archivbeständen, stellt aber auch neue Herausforderungen an die Langzeitarchivierung digitaler Korrespondenzen und Daten.
- Citation du texte
- Isabelle Noé (Auteur), 2017, Ort des kulturellen Gedächtnisses? Das Verlagsarchiv im Kontext kulturwissenschaftlicher Gedächtnistheorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376384