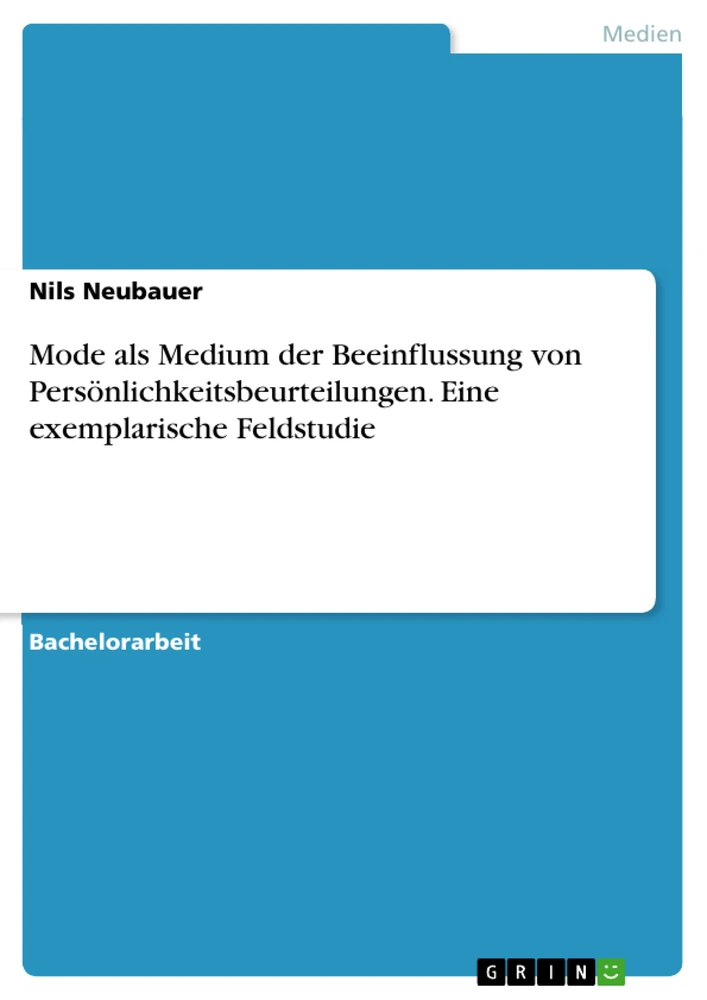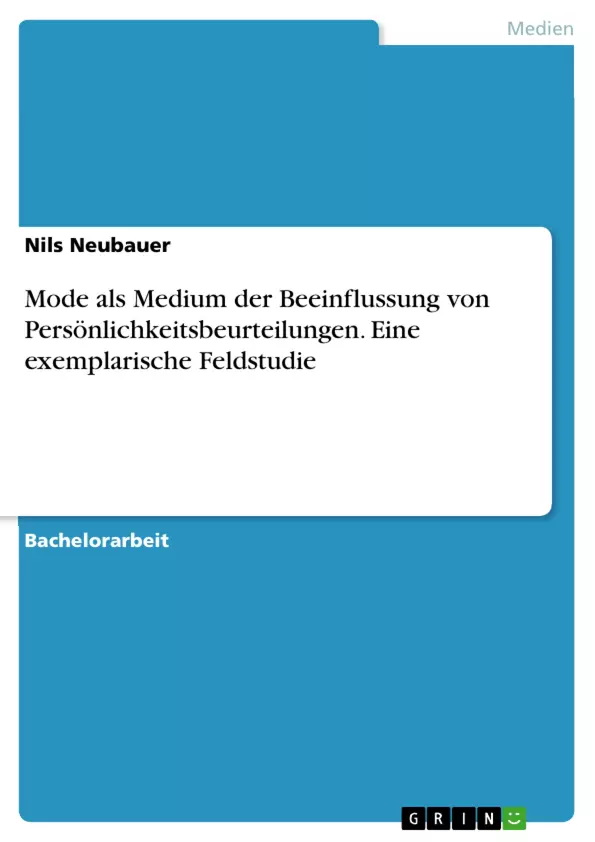Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Studie ist, inwieweit die Kleidung eines Individuums dessen Außenwirkung beeinflusst. Die diesbezüglich konstruierte Hypothese lautet, dass modisch gekleideten Personen, im Vergleich mit unmodisch gekleideten, qualitativ andere Attribute und Eigenschaften zugeschrieben werden. Von dieser Annahme ist aufgrund des ersten kommunikationstheoretischen Axioms von Paul Watzlawick - "Man kann nicht nicht kommunizieren" - und den Auswirkungen des Halo-Effekts auszugehen.
Um die Hypothese zu prüfen, wurde ein Online-Fragebogen entworfen. Dieselbe Person wurde hierfür einmal modisch und einmal unmodisch gekleidet fotografiert. Die Probanden wurden in zwei Experimentalgruppen unterteilt und hatten jeweils lediglich Zugang zu einem der beiden Bilder. Um die Abbildungen wurde derselbe Fragebogen mit Charaktereigenschaften konstruiert, die der Person zugeordnet werden mussten.
Repräsentativ wurden die Datensätze von 132 Probanden im Alter zwischen 18 und 54 Jahren ausgewertet. Die aufgestellte Hypothese konnte durch die erhobenen Ergebnisse bestätigt werden. Darüberhinaus wurde die modisch gekleidete Person, im Vergleich mit der unmodisch gekleideten, meist positiver bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- >>Man kann nicht nicht kommunizieren<<
-
Theoretischer Hintergrund
-
Terminologische Klärungen
- Kommunikation
- Medium
- Mode
- Theoretische Bezüge: Halo-Effekt
-
Terminologische Klärungen
-
Methode
- Stichprobe
- Daten
- Versuchsdurchführung
- Ergebnisse
- Diskussion
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die Kleidung eines Individuums dessen Außenwirkung beeinflusst. Die zentrale Hypothese besagt, dass modisch gekleideten Personen im Vergleich zu unmodisch gekleideten Personen qualitativ andere Attribute und Eigenschaften zugeschrieben werden. Diese Hypothese basiert auf dem ersten Axiom der Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick (1996), »Man kann nicht nicht kommunizieren« (S. 53), sowie auf den Auswirkungen des Halo-Effekts.
- Die Rolle von Kleidung als Kommunikationsmedium
- Der Einfluss von Mode auf die Wahrnehmung von Personen
- Die Untersuchung des Halo-Effekts im Zusammenhang mit Kleidung
- Empirische Analyse von Persönlichkeitsbeurteilungen anhand von Kleidung
- Die Bedeutung von Kommunikation in der Mode
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das erste Axiom der Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick (1996) – »Man kann nicht nicht kommunizieren« – und dessen Relevanz für die Mode. Es stellt die Forschungsfrage in den Kontext der Kommunikationstheorie und thematisiert die Annahme, dass Kleidung eine Art von Kommunikation darstellt.
Kapitel 2 befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund der Arbeit. Es werden die Begriffe Kommunikation, Medium und Mode terminologisch geklärt. Der Halo-Effekt, ein psychologischer Effekt, der beschreibt, wie ein einzelnes Merkmal die Wahrnehmung anderer Eigenschaften beeinflusst, wird als theoretischer Bezugspunkt eingeführt.
Kapitel 3 beschreibt die Methodik der Studie. Es werden die Stichprobe, die Daten und die Versuchsdurchführung detailliert dargestellt.
Die Ergebnisse der Studie werden in Kapitel 4 präsentiert. Es wird analysiert, ob sich die Hypothese bestätigen lässt, dass die Kleidung eines Individuums dessen Außenwirkung beeinflusst. Die Ergebnisse werden anhand von Daten und Statistiken illustriert.
Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse der Studie im Detail. Die Hypothese wird anhand der gewonnenen Erkenntnisse bewertet und mögliche Erklärungen für die Ergebnisse werden erörtert.
Schlüsselwörter
Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Themenfeld der Mode als Kommunikationsmedium und deren Einfluss auf die Persönlichkeitsbeurteilung. Sie beleuchtet das Konzept des Halo-Effekts und analysiert die Ergebnisse einer empirischen Feldstudie, die die Auswirkungen von modischer und unmodischer Kleidung auf die Wahrnehmung von Personen untersucht.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Kleidung die Wahrnehmung einer Person?
Kleidung fungiert als Kommunikationsmedium. Die Studie zeigt, dass modisch gekleideten Personen positivere Eigenschaften zugeschrieben werden als unmodisch gekleideten.
Was besagt das erste Axiom von Paul Watzlawick?
Es besagt: „Man kann nicht nicht kommunizieren“. Auch durch das bloße Erscheinen und die Wahl der Kleidung sendet ein Individuum ständig Signale an seine Umwelt.
Was ist der Halo-Effekt im Kontext der Mode?
Der Halo-Effekt beschreibt ein psychologisches Phänomen, bei dem ein positives Merkmal (z.B. modische Kleidung) die Wahrnehmung anderer Charaktereigenschaften "überstrahlt" und diese ebenfalls positiver erscheinen lässt.
Wie wurde die Feldstudie durchgeführt?
Es wurde ein Online-Fragebogen mit 132 Probanden genutzt, denen Fotos derselben Person in modischer und unmodischer Kleidung zur Beurteilung vorgelegt wurden.
Zu welchem Ergebnis kam die Untersuchung?
Die Hypothese wurde bestätigt: Die Kleidung beeinflusst die Außenwirkung massiv, wobei modische Kleidung meist zu einer signifikant positiveren Bewertung führt.
- Quote paper
- Nils Neubauer (Author), 2017, Mode als Medium der Beeinflussung von Persönlichkeitsbeurteilungen. Eine exemplarische Feldstudie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377033