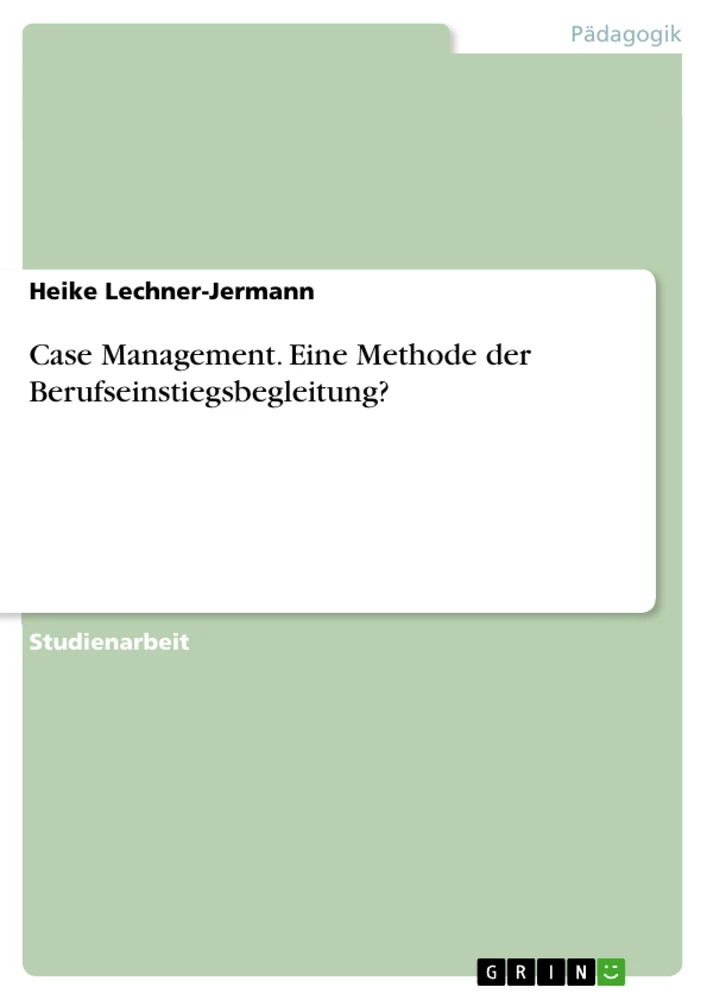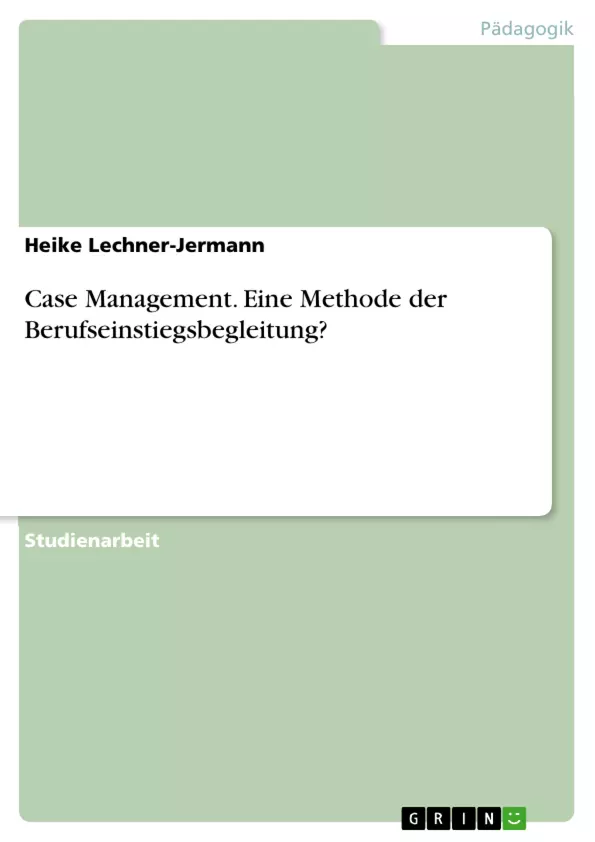Übergänge- von der Schule in eine Ausbildung, von der Ausbildung in den Beruf oder in die verschiedenen Maßnahmen, die dazwischen liegen können – gelingen für die Mehrheit der Jugendlichen gut. Hier öffnen sich ihnen Wege in die Zukunft. Laut den Befunden des DJI-Übergangspanel 2004, eine Längsschnittuntersuchung des deutschen Jugendinstituts, sind die Wege Jugendlicher mit Hauptschulabschluss und insbesondere Jugendlicher ohne Hauptschabschluss in die Berufsausbildung aber komplizierter und vielfältiger geworden. Um zu anerkannten Ausbildungsabschlüssen und zu marktfähigen Qualifikationen zu gelangen, müssen diese Jugendlichen vor dem Beginn einer Berufsausbildung längere Abfolgen von Qualifizierungsschritten absolvieren. Oft müssen sie dabei mehrfach und unter unklaren Rahmenbedingungen Entscheidungen über ihre nächsten Schritte treffen. Hierbei kann das Gelingen der beruflichen Integration durch Umwege, Abbrüche und Sackgassen enorm gefährdet werden. Dies tritt ein, wenn es den Jugendlichen nicht gelingt, in diesem konfusen System von Bildungsinstitutionen und –angeboten, passende, an ihren Voraussetzungen, Zielen und Lebenslagen anknüpfende Anschlüsse zu finden.
Die Ergebnisse des DJI – Übergangspanels belegen, dass Jugendliche, die eine besondere Unterstützung benötigen, bereits innerhalb der Schule identifiziert werden müssen, damit Hilfe nicht erst einsetzt, wenn es zu spät ist. Aus dieser Erkenntnis heraus wurde 2009 das Programm der „Berufseinstiegsbegleitung“ initiiert. Zuerst mit einer Erprobung im Rahmen des alten Dritten Sozialgesetzbuches (§ 421s, SGB III), seit 2012 jedoch als ein Regelinstrument (§49, Drittes Sozialgesetzbuch) und somit ein zentrales Begleitinstrument für den Übergang von Schüler/innen mit besonderem Unterstützungsbedarf. Diese Schüler benötigen je nach ihrer persönlichen und familiären Situation, ihrer ethnischen Herkunft oder ihren schulischen Leistungen, unterschiedliche Arten von Unterstützung. Als Metapher für die Berufseinstiegsbegleiter, also die Personen, die die Schüler in dieser schwierigen Phase des Übergangs begleiten, bietet sich das Bild des Lotsen bzw. der Lotsin an, indem sie die Schüler/innen auf das Verlassen der Schule vorbereiten und ihnen Orientierung vermitteln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Case Management
- Ziele und Zielgruppen des Case Managements und der Vergleich zur Berufseinstiegsbegleitung
- Konzeption und Funktion von Case Management und der Vergleich zur Berufseinstiegsbegleitung
- Verfahren und Methoden von Case Management und der Vergleich zur Berufseinstiegsbegleitung
- Access, Case Finding, Intaking (Klärungsphase)
- Assessment (Einschätzung, Abklärung)
- Planing (Planung)
- Intervention (Durchführung)
- Montoring (Kontrolle)
- Evaluation (Bewertung)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Frage, ob Case Management eine Methode der Berufseinstiegsbegleitung ist. Hierzu wird zunächst der Begriff des Case Managements definiert. In den darauffolgenden Kapiteln werden Ziele, Zielgruppen, Konzeptionen und Funktionen sowie Verfahren und Methoden von Case Management mit der Berufseinstiegsbegleitung verglichen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Ansätze herauszustellen und die Anwendbarkeit des Case Managements in der Berufseinstiegsbegleitung zu beurteilen.
- Definition und Funktionsweise von Case Management
- Ziele und Zielgruppen der Berufseinstiegsbegleitung im Vergleich zu Case Management
- Konzeptionelle und methodische Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Ansätze
- Anwendbarkeit von Case Management in der Berufseinstiegsbegleitung
- Bewertung des Potenzials von Case Management als Methode der Berufseinstiegsbegleitung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Berufseinstiegsbegleitung ein und stellt die Relevanz der Untersuchung dar. Der Fokus liegt dabei auf der besonderen Situation von Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss, die bei ihrem Übergang in die Berufsausbildung besondere Unterstützung benötigen.
Kapitel 2 definiert den Begriff des Case Managements als ein Verfahren, das einzelfallorientiertes Vorgehen mit sozialer Netzwerkarbeit vereint. Es werden die Kernmerkmale des Case Managements, wie beispielsweise die Mobilisierung, Organisation und Koordination von Ressourcen, sowie die Gründung und Aufrechterhaltung eines Unterstützungsnetzwerkes für den Klienten, beleuchtet.
Kapitel 3 stellt den Vergleich zwischen den Zielen und Zielgruppen des Case Managements und der Berufseinstiegsbegleitung an. Beide Ansätze zielen darauf ab, Menschen, die Unterstützung benötigen, zu einem individuell zugeschnittenen Angebot an Dienstleistungen und Ressourcen zu verhelfen. Der Fokus liegt dabei auf dem Nutzer-Empowerment und der Förderung der Selbstbestimmung und Problemlösefähigkeit der Klienten.
Schlüsselwörter
Case Management, Berufseinstiegsbegleitung, Jugendberufshilfe, Integration, Übergang, Ressourcen, Netzwerkarbeit, Zielgruppen, Methoden, Konzeption, Vergleich, Empowerment, Selbstbestimmung, Problemlösefähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Case Management?
Case Management ist ein einzelfallorientiertes Verfahren, das soziale Netzwerkarbeit nutzt, um Ressourcen für Klienten zu mobilisieren, zu organisieren und zu koordinieren.
Was ist das Ziel der Berufseinstiegsbegleitung?
Sie dient als „Lotse“, um Schülern mit besonderem Unterstützungsbedarf den Übergang von der Schule in die Ausbildung zu erleichtern und Abbrüche zu vermeiden.
Welche Phasen umfasst das Case Management?
Der Prozess besteht aus Klärungsphase (Access/Intake), Einschätzung (Assessment), Planung, Durchführung (Intervention), Kontrolle (Monitoring) und Bewertung (Evaluation).
Für wen ist die Berufseinstiegsbegleitung gedacht?
Die Zielgruppe sind vor allem Jugendliche mit Hauptschulabschluss oder ohne Abschluss, die aufgrund ihrer persönlichen oder schulischen Situation besondere Hilfe benötigen.
Was bedeutet Empowerment in diesem Kontext?
Empowerment zielt darauf ab, die Selbstbestimmung und Problemlösefähigkeit der Jugendlichen zu fördern, damit sie ihren Weg eigenständig gehen können.
- Quote paper
- Heike Lechner-Jermann (Author), 2015, Case Management. Eine Methode der Berufseinstiegsbegleitung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377431