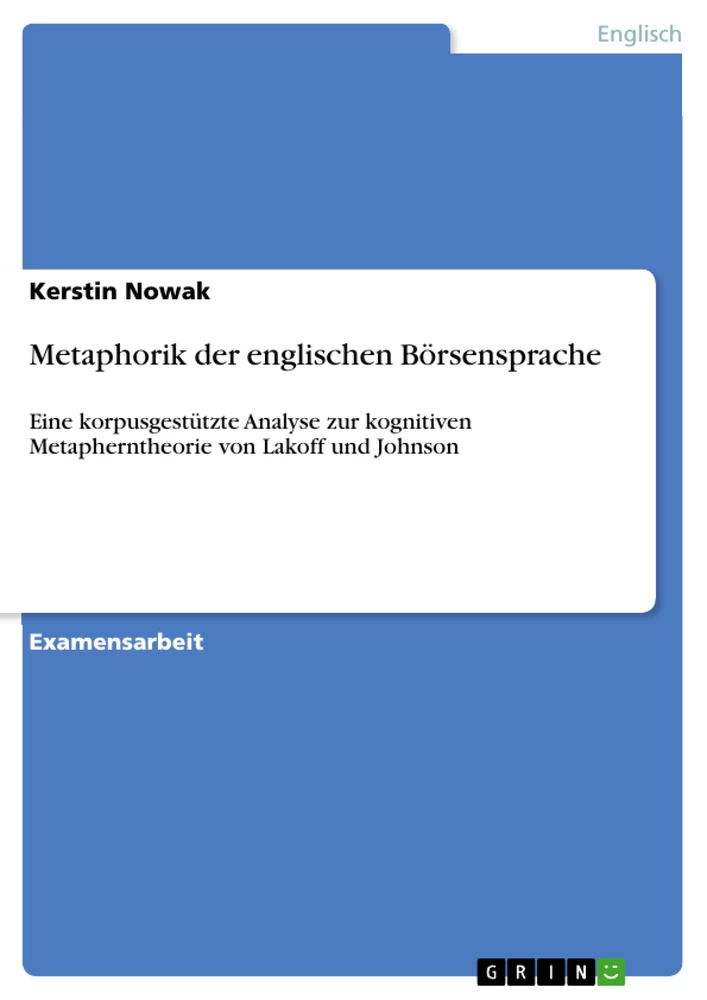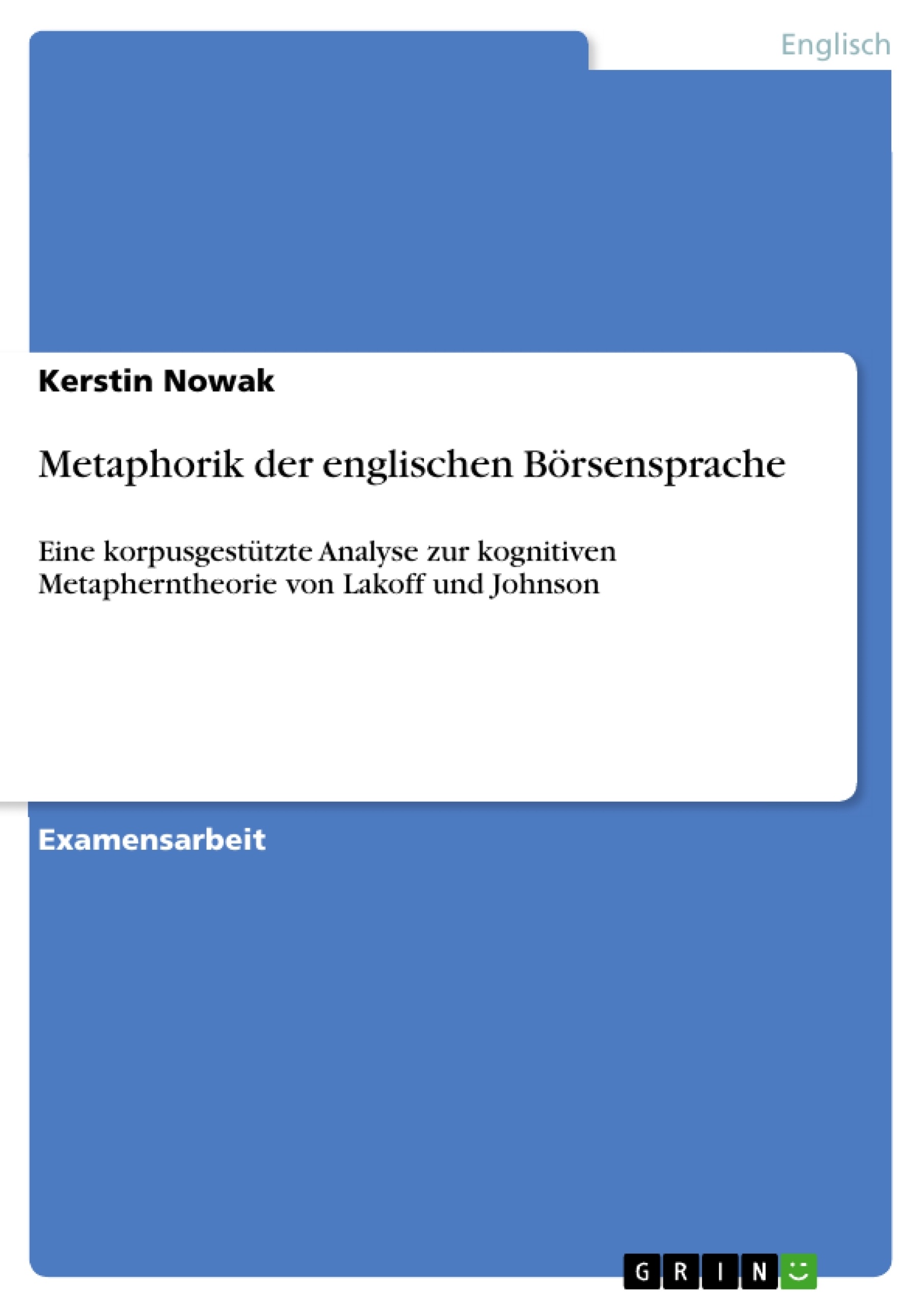1980 wurde eine Theorie präsentiert, die die Rolle, die der Metapher in unserer Sprache zugeschrieben wird, grundlegend veränderte. Die Kernaussage dieser von George Lakoff und Mark Johnson erarbeiteten Position besagt, dass Metaphern ihren Ursprung in unserem Denken haben und dieses somit großteils metaphorisch strukturiert ist. Mit dieser Feststellung kommt der Metapher freilich eine ungleich wichtigere Bedeutung zu, als nur die eines oberflächlichen Stilmittels: Sie ist wichtiger Bestandteil alltäglicher Kommunikation. Aus dieser Alltäglichkeit erwächst das wichtigste Postulat der kognitiven Metapherntheorie von Lakoff und Johnson. Es behauptet, dass Metaphern nicht nur unsere Sprache, sondern ebenso unser Denken und deshalb auch unser Handeln beeinflussen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Metaphern genau unter diesen Vorzeichen. Ihr Ziel ist es, das eben vorgestellte Postulat empirisch zu überprüfen. Hierfür wird die kognitive Theorie auf authentisches Sprachmaterial angewandt, welches exemplarisch einem Teilbereich der Alltagssprache entnommen wurde: der Börsensprache. Anhand der Analyse des zusammengetragenen Textkorpus aus diesem Bereich wird beurteilt werden, ob die Metaphern der englischen Börsensprache wirklich das sind, was Lakoff und Johnson mit dem Titel ihres revolutionären Buches von 1980 behaupten: Metaphors We Live By ‚Metaphern, nach denen wir leben’.
Begonnen werden soll vorab mit einer simpel scheinenden Frage: Was ist eigentlich eine Metapher? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, liegt es nahe, zunächst einmal das Oxford English Dictionary (OED) zu konsultieren: “A figure of speech in which a name or descriptive word or phrase is transferred to an object or action different from, but analogous to, that to which it is literally applicable” (s.v.). Auf den ersten Blick scheint hier eine treffende Definition angeboten zu werden, die auch weitgehend dem allgemeinen, ‚landläufigen’ Verständnis einer Metapher entspricht. Wendet man sich in einem zweiten Schritt den verschiedenen Theorien zu, die sich mit Metaphern beschäftigen, sind zwei Dinge besonders auffallend: Zum Einen haben sich seit der Antike ausnehmend viele Personen, darunter einige der größten Denker der Geschichte, immer wieder mit dem Phänomen der Metapher beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
- Metaphernverständnis im Wandel
- Life metaphors - who lives by them?
- Zielsetzung und Aufbau dieser Arbeit
- Die Metapher, bevor sie unser Leben bestimmte…
- Substitutions-/Vergleichstheorie
- Interaktionstheorie
- Die Fundamente der Theorie bei I.A. Richards
- Ausbau durch Max Black
- Vorläufer einer kognitiven Theorie
- Die kognitive Theorie nach Lakoff und Johnson
- Philosophische und psychologische Grundlagen
- Objektivismus
- Erfahrungsrealismus
- Grundlagen
- Der Gestaltbegriff
- Der Begriff der image schemata von Mark Johnson
- Der Begriff Idealized Cognitive Model (ICM) von George Lakoff
- Die kognitive Charakterisierung der Metapher
- Highlighting and Hiding
- Das Invarianzprinzip
- Typologie
- Unidirektionalität
- Entailment relations und zwischenmetaphorische Kohärenz
- Strukturmetaphern
- Orientierungsmetaphern
- Ontologische Metaphern
- Kritische Würdigung dieser Typologie
- Metapherneuschöpfungen
- Lebensmetaphern
- Methodologische Überlegungen zur Korpusanalyse
- Zum der Untersuchung zugrunde gelegten Verständnis der konventionellen Metapher
- Zum Korpus
- Zur Untersuchung
- Korpusanalyse
- Die Orientierungsmetapher der vertikalen Bewegung
- Die Personifizierung
- Der Ursprungsbereich des Kampfes
- Die ontologische Behältermetaphorik
- Der Ursprungsbereich des Sportes
- Sind Börsenmetaphern Lebensmetaphern? – Der Vergleich mit den Ergebnissen von Axel Hübler
- Die Kriterien der Kohärenz, Konventionalität und fundamentalen Erfahrung
- Das Kriterium des handlungsstrukturierenden Potentials
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Metaphorik der englischen Börsensprache und untersucht, ob die dort verwendeten Metaphern als Lebensmetaphern im Sinne von Lakoff und Johnson verstanden werden können.
- Die kognitive Metapherntheorie von Lakoff und Johnson
- Die Analyse von Metaphern in der englischen Börsensprache
- Die Frage, ob diese Metaphern als Lebensmetaphern im Sinne von Lakoff und Johnson gelten können
- Die Anwendung von korpusbasierten Methoden zur Analyse von Metaphern
- Der Vergleich der Ergebnisse mit früheren Studien zur Metaphorik der Börsensprache
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die historische Entwicklung des Metaphernverständnisses und stellt die kognitive Metapherntheorie von Lakoff und Johnson vor. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die methodischen Grundlagen der Korpusanalyse und die Auswahl des Korpus. In Kapitel drei werden die Ergebnisse der Korpusanalyse präsentiert, wobei verschiedene Metaphernkategorien wie die Orientierungsmetapher, die Personifizierung und die ontologische Metaphorik analysiert werden. Das vierte Kapitel vergleicht die Ergebnisse der Analyse mit den Kriterien von Lebensmetaphern nach Lakoff und Johnson.
Schlüsselwörter
Kognitive Metapherntheorie, Lakoff und Johnson, Börsensprache, Lebensmetaphern, Korpusanalyse, Orientierungsmetapher, Personifizierung, ontologische Metaphorik, konventionelle Metapher, Kohärenz, Konventionalität, handlungsstrukturierendes Potenzial.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die kognitive Metapherntheorie von Lakoff und Johnson?
Sie behauptet, dass Metaphern nicht nur Stilmittel sind, sondern unser Denken und Handeln grundlegend strukturieren („Metaphors We Live By“).
Warum wurde die Börsensprache für diese Untersuchung gewählt?
Die Börsensprache ist reich an Metaphern (z.B. Kampf- oder Sportmetaphorik), was sie zum idealen Korpus macht, um den Einfluss von Metaphern auf das Handeln empirisch zu prüfen.
Was sind Orientierungsmetaphern in der Börsensprache?
Das sind Metaphern, die räumliche Konzepte nutzen, wie etwa die „vertikale Bewegung“ (Kurse steigen oder fallen), um komplexe wirtschaftliche Vorgänge begreifbar zu machen.
Was versteht man unter „Highlighting and Hiding“?
Durch eine Metapher werden bestimmte Aspekte eines Konzepts hervorgehoben (highlighted), während andere wichtige Merkmale verborgen (hidden) bleiben.
Sind Börsenmetaphern tatsächlich „Lebensmetaphern“?
Die Arbeit analysiert anhand von Kriterien wie Kohärenz und handlungsstrukturierendem Potenzial, ob wir nach diesen Metaphern wirklich leben oder ob sie konventionelle Sprachmuster sind.
- Quote paper
- Kerstin Nowak (Author), 2008, Metaphorik der englischen Börsensprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377967