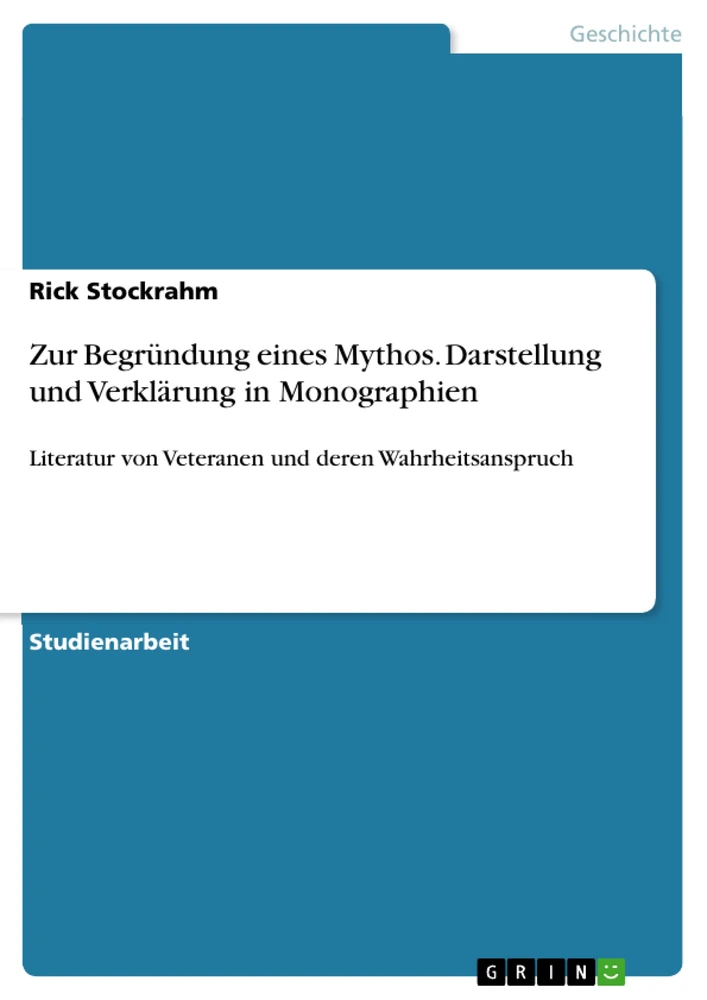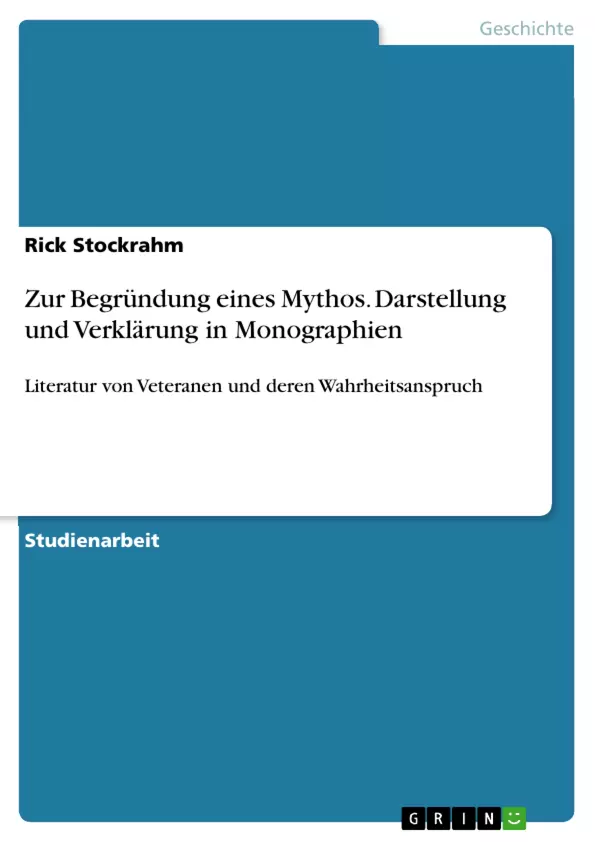Die Welt hat es geschafft, dass Tatsachen in den Hintergrund rücken und Gefühle bzw. Wissen um eine Sache wichtiger sind als die Sache selbst. Im postfaktischen Zeitalter gilt es nicht mehr rein argumentativ zu diskutieren. Verschwörungstheoretiker schaffen es, herrschende Meinungen als Lüge hinzustellen. Dazwischen nimmt der Mythos seinen Platz. Keine grundsätzliche Lüge aber auch keine reine Wahrheitsanführung. In der Geschichte sind leider nicht in Gänze alle Vorgänge aus objektiven Quellen rekonstruierbar und man hat sich auf das Wenige, was vorhanden ist, zu verlassen. Die unbefriedigende Aktensituation zur Freikorpsbewegung zwingt die Geschichtswissenschaft subjektive Darstellungen in Form von Monographien der verschiedenen Freikorpsveteranen als Quelle zu nutzen. Dieser Zugang ist problematisch, denn er ist nicht objektiv. Die Monographien sind anzuzweifeln, aber nützlich um den lang nachwirkenden Mythos der verschiedenen Freikorpsbewegungen zu analysieren.
Ziel ist es zu untersuchen, wie in Literatur von Veteranen des Baltikum-Freikorps und der Marine- Brigade Ehrhardt der eigene Mythos des heldenhaften Landsknechts konstruiert und an welche Traditionen angeknüpft wurde. Die Verklärung des wahren Wesens in den Darstellungen wird genauer Anhand der Autoren, der Darstellung der Truppe, des Feindes und des Tods untersucht. Dafür werden die Romane vom späteren NSDAP Mitglied Manfred von Killinger: „Ernstes und Heiteres aus dem Putschleben“, sowie des Freikorpsführers Rüdiger von der Goltz: „Meine Sendung in Finnland und im Baltikum“, wobei der Abschnitt im Baltikum der bedeutende ist, untersucht. Bernhard Sauer stellte bereits fest, dass die Freikorps im Baltikum „eher den Landsknechthaufen des Dreißigjährigen Krieges als einer regulären Armee“ glichen. Das allein reicht jedoch nicht aus um den Mythos zu begründen. Zuletzt befasste sich Matthias Sprenger mit der Mythosbildung über die Erinnerungsliteratur von Freikorpsveteranen. Zu den Standardwerken der Freikorpsforschung zählen „Freikorps und Republik 1918-1920“ von Hagen Schulze und „Der deutsche Bürgerkrieg“ von Hannsjoachim W. Koch. Weitere Forschungsliteratur bieten Boris Barth, Matthias Sprenger und Ingo Korzetz. Im Hinblick auf die Entstehung politisch stereotypischer Feindbilder und nachfolgend entstandener Mythen ist das Unternehmen der deutschen Freikorps im Baltikum der bedeutendste Abschnitt der Revolutionszeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Freikorps
- 2. Mythos
- 2.1. Allgemeine Begriffsklärung
- 2.2. Politischer Mythos
- 3. Autoren
- 4. Truppe
- 5. Tod
- 6. Deutschland und die deutsche Regierung
- 7. Feinde und Freunde
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Konstruktion des Mythos vom heldenhaften Landsknecht in der Literatur von Veteranen des Baltikum-Freikorps und der Marine-Brigade Ehrhardt. Dabei werden die Darstellungen der Autoren, die Darstellung der Truppe, des Feindes und des Todes genauer analysiert.
- Verklärung der Freikorps in der Erinnerungsliteratur
- Analyse der Konstruktion des Mythos vom heldenhaften Landsknecht
- Untersuchung der Darstellung der Truppe, des Feindes und des Todes
- Bedeutung der Freikorps für die deutsche Geschichte der Zwischenkriegszeit
- Zusammenhang zwischen Mythosbildung und politischer Ideologie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert den Kontext der Mythosbildung im postfaktischen Zeitalter. Sie stellt die Problematik der subjektiven Darstellungen in Monographien von Freikorpsveteranen dar und erläutert die Forschungsziele und Methoden.
- 1. Freikorps: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung der Freikorps in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Es geht auf die verschiedenen Motive und Ziele der Freikorps ein und beleuchtet deren heterogene Zusammensetzung und ihren Umgang mit Gewalt und Kriminalität.
- 2. Mythos: Dieses Kapitel widmet sich dem Begriff des Mythos und seiner Bedeutung im historischen Kontext. Es analysiert die Entstehung und Verbreitung des Mythos vom heldenhaften Landsknecht und untersucht seine politische Funktion im Kontext der Zeit.
- 3. Autoren: Dieses Kapitel stellt die Autoren der untersuchten Romane, Manfred von Killinger und Rüdiger von der Goltz, vor und analysiert ihre Lebensläufe sowie ihre Motivationen zur Schriftverfassung.
- 4. Truppe: Dieses Kapitel untersucht die Darstellung der Freikorps in den untersuchten Romanen. Es beleuchtet die Heldenhaftigkeit, die Kameradschaft, den Mut und die Tapferkeit, die in den Texten hervorgehoben werden und die zur Verklärung des wahren Wesens der Freikorps beitragen.
- 5. Tod: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des Todes in den untersuchten Romanen und zeigt auf, wie die Autoren den Tod in den Vordergrund stellen und den Mythos vom heldenhaften Landsknecht mit diesem Aspekt verknüpfen.
- 6. Deutschland und die deutsche Regierung: Dieses Kapitel beleuchtet die Darstellung der deutschen Regierung und des Landes in den untersuchten Romanen. Es zeigt auf, wie die Autoren die deutsche Regierung und das Land als Opfer der Umstände darstellen und die Freikorps als Verteidiger des Vaterlandes glorifizieren.
- 7. Feinde und Freunde: Dieses Kapitel untersucht die Darstellung der Feinde und Freunde der Freikorps in den untersuchten Romanen. Es analysiert, wie die Autoren die Feinde der Freikorps dämonisieren und den Mythos vom Kampf gegen den Bolschewismus und das "Rote Gespenst" konstruieren.
Schlüsselwörter
Freikorps, Mythos, Heldenhaftigkeit, Landsknecht, Erinnerungsliteratur, Verklärung, Baltikum, Marine-Brigade Ehrhardt, Manfred von Killinger, Rüdiger von der Goltz, politische Ideologie, Feindbild, Bolschewismus, "Rotes Gespenst", Weimarer Republik, Zwischenkriegszeit.
Häufig gestellte Fragen
Welches Ziel verfolgt die Untersuchung der Freikorps-Literatur?
Ziel ist es zu untersuchen, wie Veteranen des Baltikum-Freikorps und der Marine-Brigade Ehrhardt den Mythos des heldenhaften Landsknechts konstruierten und an welche Traditionen sie dabei anknüpften.
Warum ist die Nutzung von Monographien als Quelle problematisch?
Da objektive Quellen zur Freikorpsbewegung oft fehlen, muss auf subjektive Monographien zurückgegriffen werden. Diese sind nicht objektiv und dienen eher der Verklärung als der faktenbasierten Rekonstruktion.
Welche Autoren werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert Werke von Manfred von Killinger („Ernstes und Heiteres aus dem Putschleben“) und Rüdiger von der Goltz („Meine Sendung in Finnland und im Baltikum“).
Wie wird der Tod in der untersuchten Literatur dargestellt?
Der Tod wird in den Vordergrund gestellt und eng mit dem Mythos des heldenhaften Landsknechts verknüpft, um die Truppe zu glorifizieren.
Welche Rolle spielt das Feindbild des Bolschewismus?
Die Autoren dämonisieren ihre Gegner und konstruieren den Mythos eines heroischen Kampfes gegen das „Rote Gespenst“, um ihre Handlungen politisch zu legitimieren.
Was versteht man unter dem Begriff des Mythos in diesem Kontext?
Ein Mythos ist hier keine reine Lüge, aber auch keine objektive Wahrheit; er dient im postfaktischen Zeitalter dazu, Gefühle über Tatsachen zu stellen und herrschende Meinungen zu beeinflussen.
- Citar trabajo
- Rick Stockrahm (Autor), 2017, Zur Begründung eines Mythos. Darstellung und Verklärung in Monographien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377997