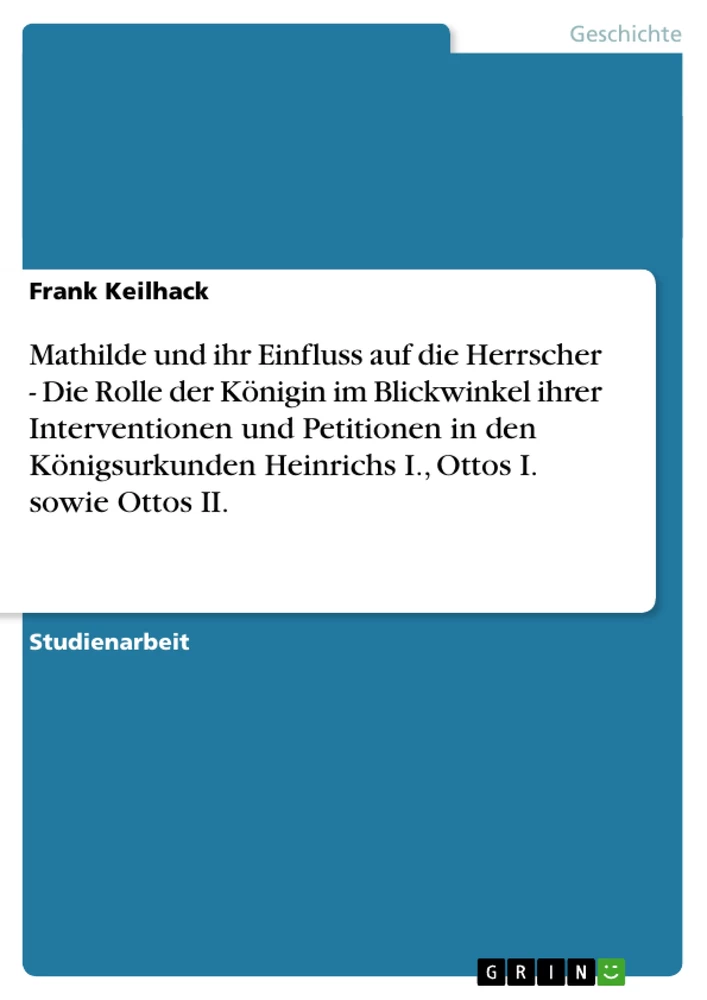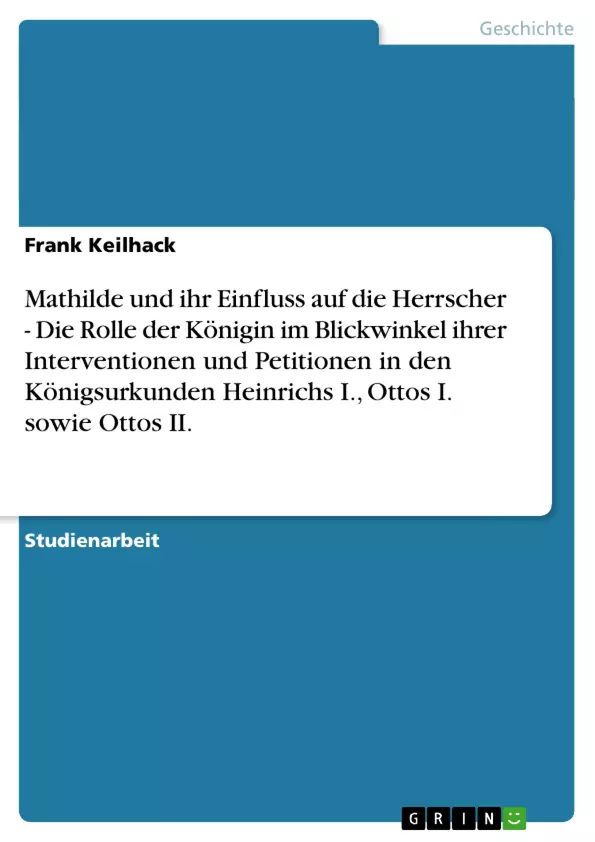Nach einem „Perspektivwechsel in der Mediävistik“ rückten auch die Gemahlinnen der Könige und Kaiser des frühen und hohen Mittelalters in den Blickwinkel der Mittelalterforschung. Infolgedessen wurden unter anderem deren Rolle bei der Herrschaftsausübung, ihre Stellung im Gefüge des Reiches, ihre Einflussmöglichkeiten oder ihre Verbindungen zu Geistlichen und Großen untersucht, wobei festgestellt wurde, dass vor allem seit den ottonischen Königinnen eine starke Stellung der Monarchin zu konstatieren ist. Allerdings wird betont, dass dieser Befund erst für die zweite Hälfte des zehnten Jahrhunderts und danach festzustellen ist, namentlich beginnend mit Adelheid, der zweiten Frau Ottos des Großen.
Demnach war die Rolle Mathildes, der ersten Königin des ostfränkischen Reiches und Frau Heinrichs I., eine noch nicht so wichtige und ausschlaggebende, ihr Einfluss war scheinbar gering. Dem widersprechen allerdings zwei historiographische Zeugnisse: Hrotsvit von Gandersheim bezeichnete Mathilde als „conregnans“, Liutprand von Cremona als „regni consors“. Da diese Terminologie nun auf eine Teilhabe an der Herrschaft hindeutet, wirft sich die Frage auf, welche Stellung Königin Mathilde nun hatte. Dieser Frage wird in dieser Arbeit nachgegangen. Dabei soll herausgefunden werden, ob Mathilde Einfluss auf die Herrscher gehabt hat, und wie sie diesen nutzte. Darüber hinaus soll aufgezeigt werden, ob und welche Verbindungen Mathilde zu Geistlichen und/oder Großen des Reiches hatte.
Wie schon erwähnt, bescheinigte Liutprand der Königin Mathilde hervorragende Memoriapflege. Überhaupt wird der Aufbau der ottonischen Memoria und deren Pflege Mathilde zugute gehalten, wobei der Eindruck entsteht, dass dieses Gebiet das einzige gewesen wäre, auf welchem Mathilde agierte. Deshalb soll zusätzlich noch der Frage nachgegangen werden, ob sich dieser Befund erhärten lässt, oder ob Mathilde auch in anderen Bereichen eine wichtige Rolle spielte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Hinleitung zum Thema
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Vorbetrachtungen
- 2.1 Interventionen und Petitionen der Königin in den Herrscherdiplomen und deren Bedeutung
- 2.2 Mathilde
- 3. Interventionen und Petitionen Mathildes in den Königsurkunden Heinrichs I., Ottos I. und Ottos II.
- 3.1 Auflistung der betreffenden Königsurkunden
- 3.2 Adressaten der betreffenden Königsurkunden und (Mit-)Intervenienten
- 3.2.1 Quedlinburg
- 3.2.2 Herford
- 3.2.3 Osnabrück
- 3.2.4 Corvey
- 3.2.5 St. Maximin
- 3.2.6 Neuenheerse
- 3.2.7 Enger
- 3.2.8 Chur
- 3.2.9 Moritzkloster Magdeburg
- 3.2.10 Hadmersleben
- 3.2.11 Ergebnis
- 4. Weitere Aspekte
- 5. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Königin Mathilde auf die Herrschaft Heinrichs I., Ottos I. und Ottos II. Ziel ist es, ihre Rolle über die bisherige Forschung hinaus zu beleuchten und zu klären, inwieweit sie Einfluss auf die Herrscher ausübte und welche Beziehungen sie zu Geistlichen und Großen des Reiches pflegte. Dabei wird insbesondere auf ihre Interventionen und Petitionen in den Königsurkunden eingegangen.
- Mathildes Rolle als Königin im ostfränkischen Reich
- Analyse der Interventionen und Petitionen Mathildes in königlichen Urkunden
- Beziehungen Mathildes zu Geistlichen und Großen des Reiches
- Bewertung der bisherigen Forschung zu Mathilde und ihrer Bedeutung
- Auswertung von Königsurkunden als primäre Quelle zur Erforschung von Mathildes Einfluss
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert den Perspektivwechsel in der Mediävistik, der auch die Rolle der Königinnen in den Fokus rückte. Sie stellt die Forschungsfrage nach Mathildes Einfluss auf die Herrschaft und ihre Beziehungen zu Geistlichen und Großen. Die Arbeit widerlegt die bisherige Annahme eines geringen Einflusses Mathildes, gestützt auf die Bezeichnung als „conregnans“ und „regni consors“ durch zeitgenössische Historiographen. Die Methodik der Arbeit, die sich auf die Analyse von Königsurkunden konzentriert, wird ebenfalls vorgestellt.
2. Vorbetrachtungen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Interventionen und Petitionen der Königin in Herrscherdiplomen und deren Bedeutung für die historische Forschung. Es setzt sich im zweiten Teil mit der Person Mathildes auseinander, bereitet die im Hauptteil folgende Analyse der Königsurkunden vor und unterstreicht die Bedeutung der Königsurkunden als authentische Quelle für die Rekonstruktion von Mathildes Aktivitäten.
3. Interventionen und Petitionen Mathildes in den Königsurkunden Heinrichs I., Ottos I. und Ottos II.: Der Hauptteil der Arbeit analysiert systematisch die Interventionen und Petitionen Mathildes in den Königsurkunden der drei genannten Herrscher. Es werden die Urkunden aufgelistet, ihre Adressaten und die beteiligten Personen untersucht. Die Analyse zielt darauf ab, die Reichweite von Mathildes Einfluss zu dokumentieren und ein umfassendes Bild ihrer politischen Aktivität zu zeichnen. Einzelne Abschnitte untersuchen die beteiligten Klöster und Institutionen, um die politischen und religiösen Netzwerke Mathildes zu rekonstruieren.
4. Weitere Aspekte: Dieses Kapitel wird voraussichtlich weitere Aspekte von Mathildes Wirken beleuchten, die über die Analyse der Urkunden hinausgehen und einen tieferen Einblick in ihre Rolle und ihren Einfluss geben.
Schlüsselwörter
Königin Mathilde, ottonische Kaiserzeit, Königsurkunden, Interventionen, Petitionen, Herrschaftsausübung, Memoria, Geistliche, Große des Reiches, mittelalterliche Geschichte, Quellenkritik, Historiographie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Interventionen und Petitionen der Königin Mathilde in den Königsurkunden Heinrichs I., Ottos I. und Ottos II.
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Einfluss von Königin Mathilde auf die Herrschaft der ostfränkischen Könige Heinrich I., Otto I. und Otto II. Der Fokus liegt auf der Analyse ihrer Interventionen und Petitionen in den erhaltenen Königsurkunden, um ihre Rolle und ihren Einfluss über den bisherigen Forschungsstand hinaus zu beleuchten.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit geht der Frage nach, inwieweit Königin Mathilde Einfluss auf die Herrscher ausübte und welche Beziehungen sie zu Geistlichen und Großen des Reiches pflegte. Sie hinterfragt die bisherige Annahme eines geringen Einflusses Mathildes und untersucht ihre Aktivitäten anhand der Königsurkunden als primäre Quelle.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle dieser Arbeit sind die Königsurkunden Heinrichs I., Ottos I. und Ottos II. Diese Urkunden werden systematisch analysiert, um Interventionen und Petitionen Mathildes zu identifizieren und zu interpretieren. Die Arbeit bezieht sich auch auf die bestehende Historiographie und Forschung zu Mathilde und der ottonischen Kaiserzeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, die das Thema einführt und die Forschungsmethodik beschreibt; Vorbetrachtungen, die den Begriff der Interventionen und Petitionen klären und Mathilde als Person vorstellt; den Hauptteil, der die Interventionen und Petitionen Mathildes in den Königsurkunden analysiert und die Adressaten und beteiligten Personen untersucht; ein Kapitel zu weiteren Aspekten von Mathildes Wirken; und abschließend eine Zusammenfassung und ein Fazit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Mathildes Rolle als Königin im ostfränkischen Reich, die Analyse ihrer Interventionen und Petitionen in königlichen Urkunden, ihre Beziehungen zu Geistlichen und Großen des Reiches, eine kritische Auseinandersetzung mit der bisherigen Forschung zu Mathilde und die Auswertung von Königsurkunden als primäre Quelle.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassenderes Bild von Mathildes politischer Aktivität und ihrem Einfluss auf die Herrschaft Heinrichs I., Ottos I. und Ottos II. zu zeichnen. Sie soll die Reichweite ihres Einflusses dokumentieren und ihre politischen und religiösen Netzwerke rekonstruieren, die bisherige Forschung ergänzen und die Bedeutung von Königsurkunden als Quelle zur Erforschung der Rolle von Königinnen im Mittelalter aufzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Königin Mathilde, ottonische Kaiserzeit, Königsurkunden, Interventionen, Petitionen, Herrschaftsausübung, Memoria, Geistliche, Große des Reiches, mittelalterliche Geschichte, Quellenkritik, Historiographie.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine quellenkritische Methode, die sich auf die systematische Analyse von Königsurkunden konzentriert. Die Urkunden werden auf Interventionen und Petitionen Mathildes untersucht, um ihren Einfluss und ihre Beziehungen zu anderen Akteuren zu rekonstruieren. Die Ergebnisse werden im Kontext der bestehenden Forschung diskutiert.
- Quote paper
- Frank Keilhack (Author), 2004, Mathilde und ihr Einfluss auf die Herrscher - Die Rolle der Königin im Blickwinkel ihrer Interventionen und Petitionen in den Königsurkunden Heinrichs I., Ottos I. sowie Ottos II., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37932