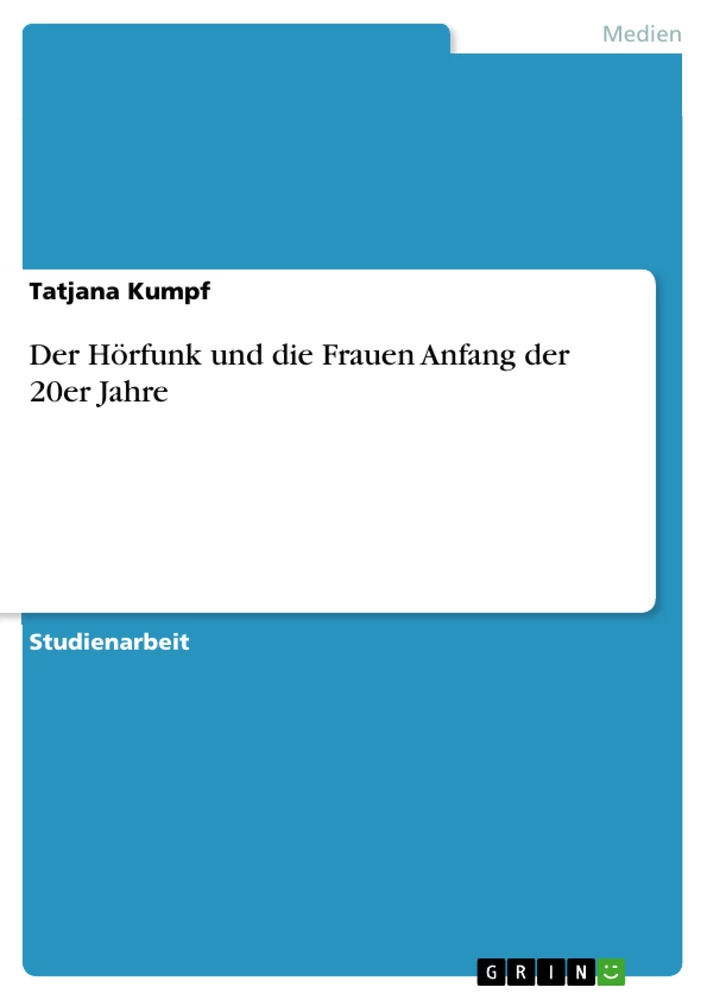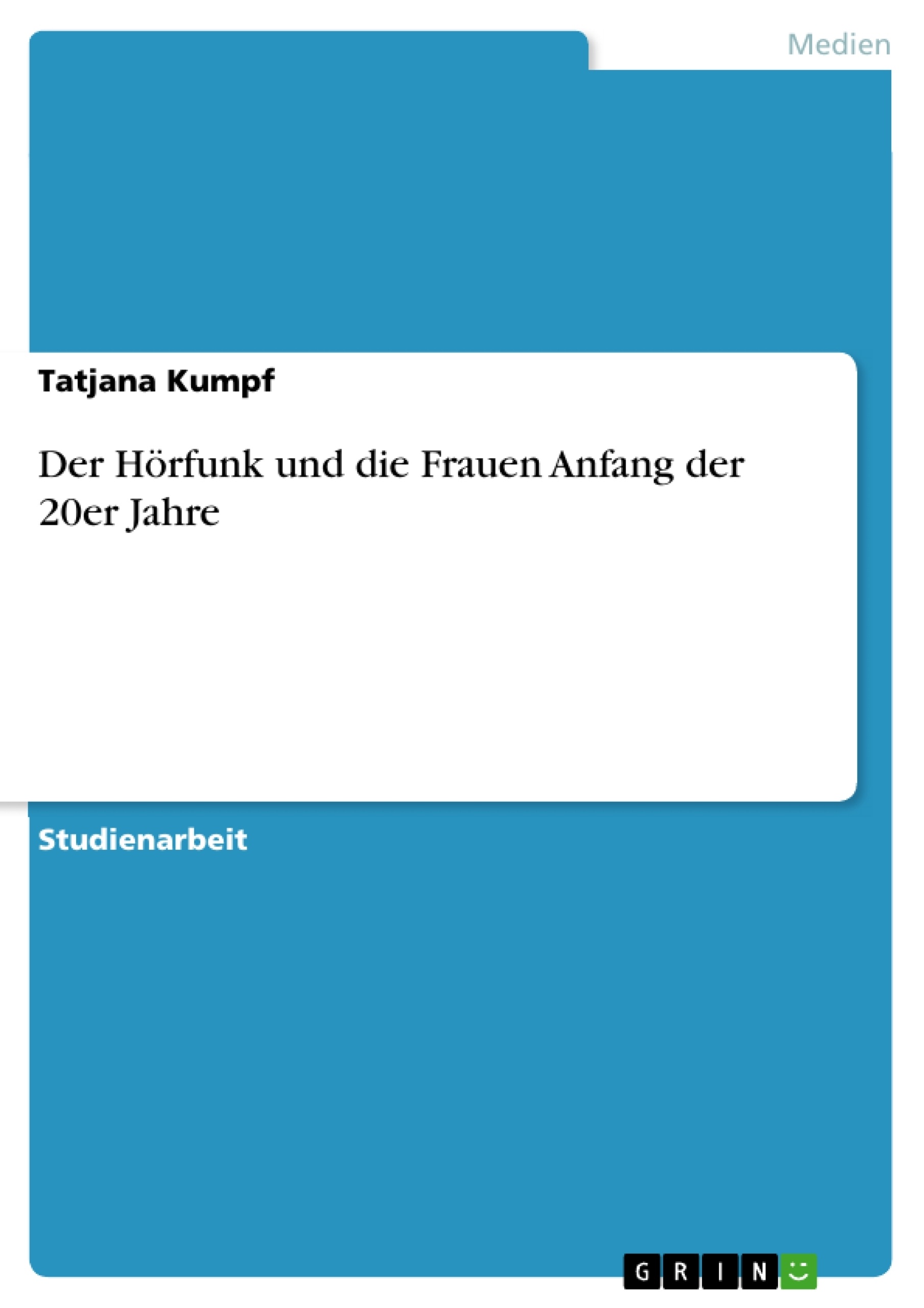Aktuell arbeiten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nur 28% Frauen. Im Vergleich dazu sind es im privaten Hörfunk 38% Frauen und in Zeitschriften gibt es sogar einen Anteil von 41,3% weiblichen Angestellten (Keil, 2000). Es wird deutlich, dass es unterdurchschnittlich wenig weibliche Arbeiternehmer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Aber warum ist das so? Schon um 1930 wurden Frauen im Hörfunk zunehmend kritisiert. Ihre Stimmen wurden als unpassend eingestuft und als nicht mächtig genug betitelt. Keine Frau vermochte es, bei einem Radiosender als Ansagerin eingestellt zu werden. Dabei war es unwichtig, wie gut sie sprechen konnte.
In dieser Hausarbeit soll am Beispiel von Gales Barrett und Margarete Wolf gezeigt werden, wie der Versuch aussieht, Ansagerin im Hörfunk zu werden, trotz der vielen Kritik. Dabei sollen vor allem auf die offiziellen und die vermutlich wahren Gründe der Abweisung von Frauen als Ansagerinnen eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Einfluss des Hörfunks auf Frauen
- 2.1. Sozialer Einfluss
- 2.1.1. Positive Faktoren
- 2.1.2. Negative Faktoren
- 2.2. Ästhetischer Einfluss
- 3. Hörfunk für Frauen
- 3.1. Programm
- 3.2. Funktion
- 4. Kritik
- 5. Frauen im Hörfunk
- 5.1. Gründe gegen Frauen im Hörfunk
- 5.2. Giles Barrett
- 5.3. Margarete Wolf
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Rolle der Frau im Hörfunk der frühen 1920er Jahre. Sie beleuchtet den Einfluss des Hörfunks auf Frauen, sowohl sozial als auch ästhetisch, und analysiert die Gründe für die damalige Unterrepräsentation von Frauen in der Branche. Ein besonderer Fokus liegt auf den Erfahrungen von Giles Barrett und Margarete Wolf als Beispiele für den Kampf um eine Ansagerposition.
- Der soziale Einfluss des Hörfunks auf Frauen (positive und negative Aspekte).
- Die ästhetische Wahrnehmung des Hörfunkgeräts und seine Integration in den Haushalt.
- Die Gründe für die Ausgrenzung von Frauen im Hörfunk.
- Die Rolle der Hausfrau als Hauptzielgruppe der Hörfunkwerbung.
- Der Stellenwert des Hörfunks im familiären Alltag.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die aktuelle Unterrepräsentation von Frauen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk fest und führt als Ausgangspunkt die Kritik an Frauen im Hörfunk um 1930 an. Die Arbeit untersucht anhand von Beispielen, wie Frauen versuchten, Ansagerinnen zu werden, und beleuchtet die offiziellen und tatsächlichen Gründe für ihre Abweisung. Weiterhin wird der Stellenwert des Hörfunks im Alltag der Hausfrau, insbesondere zu Beginn des Hörfunks, als wichtiger Forschungsfokus genannt, da Hausfrauen einen Großteil des Publikums ausmachten und somit die Hauptansprechpartner für Werbung waren.
2. Der Einfluss des Hörfunks auf Frauen: Dieses Kapitel analysiert die anfängliche Misstrauen der Frauen gegenüber dem neuen Medium Hörfunk und die Faktoren, die letztendlich dazu führten, dass insbesondere Hausfrauen zu regelmäßigen Hörerinnen wurden. Es werden sowohl soziale als auch ästhetische Einflüsse diskutiert.
2.1. Sozialer Einfluss: Dieser Abschnitt beschreibt die anfängliche Wahrnehmung des Radios als Eindringling, entwickelt sich das Radiohören aber zu einem festen Bestandteil der Freizeit und des Alltags. Positive Aspekte umfassen die Stärkung sozialer Beziehungen durch gemeinsames Hören und die Aufwertung der Familie als Mittelpunkt. Negative Aspekte entstehen durch die technische Distanz der Frauen zum Gerät und die Gefahrenquelle der Akkumulatoren.
Häufig gestellte Fragen: Die Rolle der Frau im Hörfunk der frühen 1920er Jahre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Rolle der Frau im Hörfunk der frühen 1920er Jahre. Sie beleuchtet den Einfluss des Hörfunks auf Frauen (sowohl sozial als auch ästhetisch) und analysiert die Gründe für die damalige Unterrepräsentation von Frauen in der Branche. Ein besonderer Fokus liegt auf den Erfahrungen von Giles Barrett und Margarete Wolf als Beispiele für den Kampf um eine Ansagerposition.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den sozialen Einfluss des Hörfunks auf Frauen (positive und negative Aspekte), die ästhetische Wahrnehmung des Hörfunkgeräts und seine Integration in den Haushalt, die Gründe für die Ausgrenzung von Frauen im Hörfunk, die Rolle der Hausfrau als Hauptzielgruppe der Hörfunkwerbung und den Stellenwert des Hörfunks im familiären Alltag.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung: Stellt die aktuelle und damalige Unterrepräsentation von Frauen im Rundfunk fest und führt die Kritik an Frauen im Hörfunk um 1930 als Ausgangspunkt an. Untersucht anhand von Beispielen, wie Frauen versuchten, Ansagerinnen zu werden, und beleuchtet die Gründe für ihre Abweisung. Nutzt den Stellenwert des Hörfunks im Alltag der Hausfrau als wichtigen Forschungsfokus. 2. Der Einfluss des Hörfunks auf Frauen: Analysiert die anfängliche Misstrauen der Frauen gegenüber dem neuen Medium und die Faktoren, die zu regelmäßigen Hörerinnen führten. Diskutiert soziale und ästhetische Einflüsse. 2.1. Sozialer Einfluss: Beschreibt die anfängliche Wahrnehmung des Radios und die Entwicklung zum festen Bestandteil der Freizeit und des Alltags. Behandelt positive (Stärkung sozialer Beziehungen) und negative Aspekte (technische Distanz, Gefahrenquelle Akkumulatoren). 3. Hörfunk für Frauen: Untersucht Programme und Funktionen des Hörfunks speziell für Frauen. 4. Kritik: Analysiert die Kritik am Hörfunk und seiner Darstellung von Frauen. 5. Frauen im Hörfunk: Untersucht die Gründe gegen Frauen im Hörfunk und beleuchtet die Erfahrungen von Giles Barrett und Margarete Wolf. 6. Fazit: Zusammenfassende Schlussfolgerungen der Arbeit.
Wer waren Giles Barrett und Margarete Wolf?
Giles Barrett und Margarete Wolf werden als Beispiele für Frauen genannt, die versuchten, im Hörfunk als Ansagerinnen zu arbeiten, und deren Erfahrungen beleuchtet werden, um den Kampf um eine Ansagerposition zu veranschaulichen.
Welche Rolle spielte die Hausfrau im Kontext des Hörfunks?
Die Hausfrau wird als Hauptzielgruppe der Hörfunkwerbung identifiziert und ihr Stellenwert im familiären Alltag und ihre Bedeutung als Hauptanteil der Hörerschaft werden als wichtiger Forschungsfokus der Arbeit genannt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Rolle der Frau im Hörfunk der frühen 1920er Jahre, zum Einfluss des Mediums auf Frauen und zu den Gründen für die damalige Unterrepräsentation von Frauen in der Branche. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Fazit des Textes zusammengefasst.
- Quote paper
- Tatjana Kumpf (Author), 2013, Der Hörfunk und die Frauen Anfang der 20er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379370