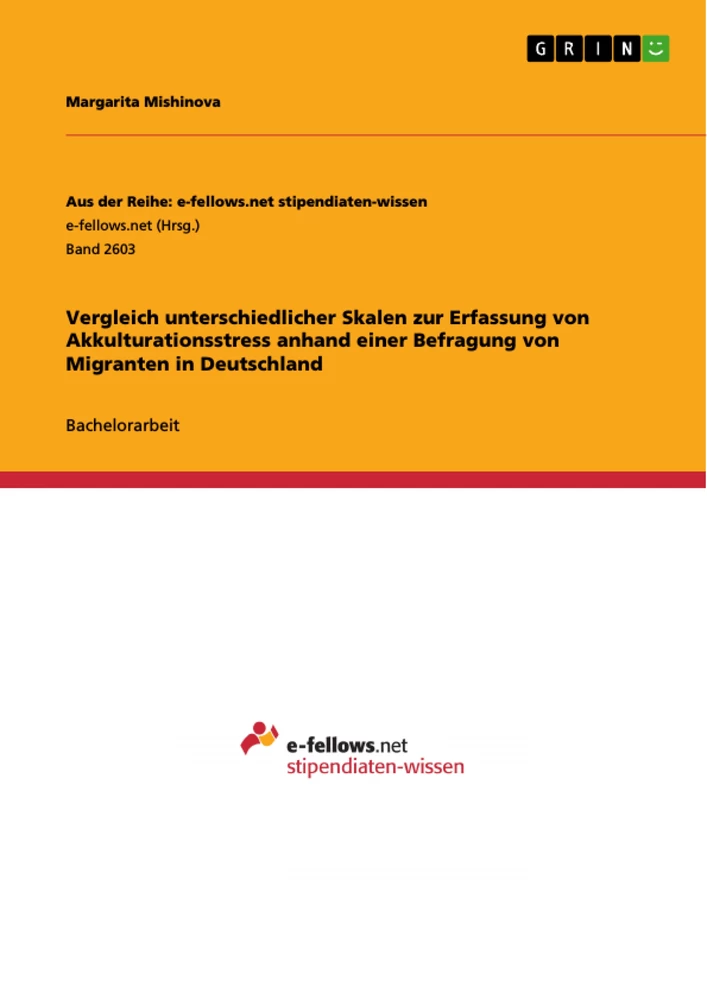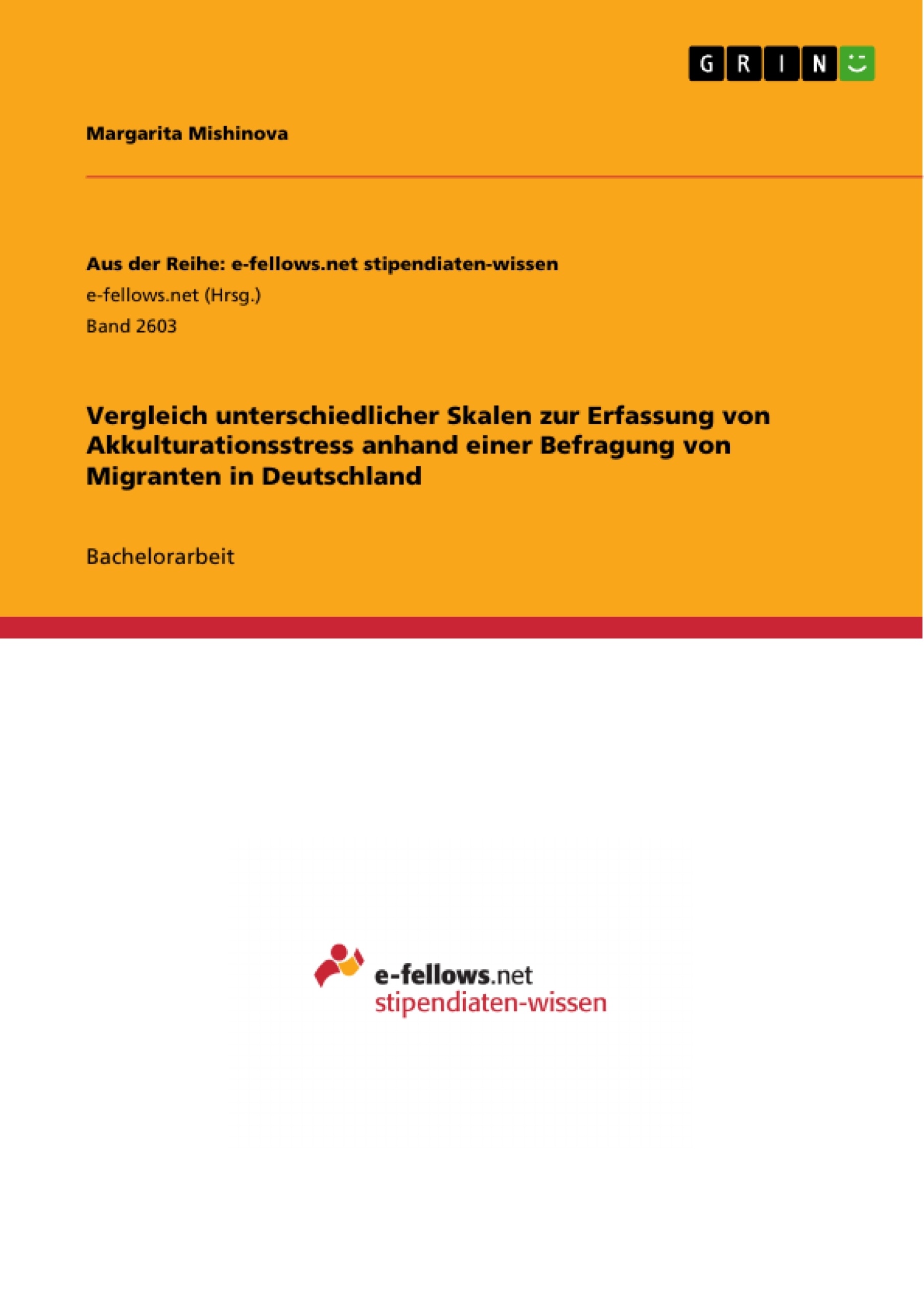Der Prozess, im Zuge dessen Gruppen und Individuen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aufeinandertreffen und sich gegenseitig beeinflussen, wird in der Forschung Akkulturation genannt. Akkulturationsprozesse können sowohl auf Gruppenebene als auch auf individueller Ebene stattfinden. In dieser Arbeit werden sie empirisch auf der individuellen Ebene untersucht. Ziele sind einerseits, vier verschiedene diagnostische Verfahren auf ihre Gültigkeit und Reliabilität in Deutschland zu testen, und andererseits, die Zusammenhänge zwischen der individuellen Akkulturationsstrategie, sowie der Orientierung an der Aufnahme-/Herkunftskultur und dem erlebten Akkulturationsstress sowie der Rolle verschiedener Moderatorvariablen (wie Alter, Geschlecht, Rolle der Partnerschaft, Besitz des deutschen Passes, sowie Aufenthaltsdauer und Migrationsalter) zu untersuchen. Im Rahmen dieser Arbeit kommen vier Messinstrumente zum Einsatz: die Frankfurt Acculturation Scale (FRAKK; Bongard et al., 2007), die Social, Attitudinal, Familial, and Environmental Acculturation Stress Scale (SAFE; Mena, Padilla & Maldonado, 1987), der Perceived Ethnic Discrimination Questionnaire (PEDQ; Contrada et al., 2001) und das Riverside Acculturation Stress Inventory (RASI; Miller, Kim & Benet-Martinez, 2011).
Die Umfrage wurde von 219 Probanden vollständig absolviert. Die vier benutzten diagnostischen Instrumente weisen gute Reliabilität auf. Die erhöhte Orientierung an der Aufnahmekultur, gemessen mithilfe des FRAKK, geht mit einem niedrigeren Akkulturationsstress (AKS) einher, wenn man sich an die Gesamtscores von SAFE, RASI und PEDQ orientiert. Zwischen der Orientierung an der Herkunftskultur und AKS besteht zwar eine positive Korrelation, diese ist aber deutlich niedriger als bei der Orientierung an der Aufnahmekultur. Bei allen drei AKSMessinstrumente klärt die Orientierung an der Aufnahmekultur den größten Teil der Varianz auf. Ein zusätzlicher Prädiktor bei SAFE und RASI ist die Orientierung an der Herkunftskultur. Neben der Orientierung an der Aufnahmekultur sind auch die Aufenthaltsdauer und der Besitz des deutschen Passes weitere Prädiktoren für Akkulturationsstress bei PEDQ. Die Befunde stimmen mit dem theoretischen Modell der Akkulturation von Berry (1997) überein, bestätigen frühere Studienergebnisse und heben neue wichtige Faktoren wie die Rolle der Partnerschaft hervor.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1. Definition von Akkulturation
- 2.2. Das Rahmenmodell der Akkulturation nach J.W. Berry
- 2.3 Die vier Akkulturationsstrategien
- 2.4 Akkulturationsstress (AKS)
- 2.5 Zusammenhang AKS und Akkulturationsstrategien
- 2.6 Wissenschaftliche Fragestellung und Hypothesen
- 3 Methode
- 3.1 Erhebungsinstrumente
- 3.1.1 FRAKK
- 3.1.2 SAFE
- 3.1.3 RASI
- 3.1.4 PEDQ
- 3.2 Weitere Variablen (soziodemographische Daten)
- 3.3 Durchführung
- 3.4 Teilnahmevoraussetzungen
- 3.5 Untersuchungsdesign
- 3.6 Datenaufbereitung
- 3.7 Beschreibung der Stichprobe
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Deskriptive Statistik der eingesetzten diagnostischen Instrumente
- 4.1.1 Reliabilität
- 4.1.2 Prüfung auf Normalverteilung
- 4.1.3 Korrelationen zwischen den Subskalen der einzelnen Instrumente
- 4.2 Zusammenhänge zwischen den drei AKS-Messinstrumente
- 4.3 Zusammenhang AKS und Orientierung an der Herkunfts- und die Aufnahmekultur
- 4.3.1 Statistische Herangehensweise
- 4.3.2 Zusammenhang AKS und Orientierung an der Aufnahmekultur
- 4.3.3 Zusammenhang zwischen der Orientierung an der Herkunftskultur und AKS
- 4.3.4 Multiple Regressionsanalyse
- 4.4 Zusammenhang AKS und Akkulturationsstrategien
- 4.4.1 Errechnung der Strategien
- 4.4.2 Prüfung auf Normalverteilung und Varianzhomogenität
- 4.4.3 Ergebnisse
- 4.5 Hypothesenprüfung weiterer Variablen
- 4.5.1 Zusammenhang AKS und Geschlecht
- 4.5.2 Zusammenhang AKS und Besitz des deutschen Passes
- 4.5.3 Zusammenhang AKS und Beziehungsstatus
- 4.5.4 Zusammenhang AKS und Migrationsgeneration
- 4.5.5 Zusammenhang AKS und Alter bei der Auswanderung
- 5 Diskussion
- 5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5.2 Interpretation und Einordnung der Ergebnisse in die theoretischen Modelle der Akkulturation
- 5.3 Limitationen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der empirischen Untersuchung von Akkulturationsprozessen auf individueller Ebene in Deutschland. Das Ziel der Arbeit ist es, die Gültigkeit und Reliabilität von vier verschiedenen diagnostischen Verfahren zur Erfassung von Akkulturationsstress zu überprüfen und die Zusammenhänge zwischen individueller Akkulturationsstrategie, Orientierung an der Aufnahme- und Herkunftskultur sowie dem erlebten Akkulturationsstress zu untersuchen.
- Untersuchung der Gültigkeit und Reliabilität verschiedener diagnostischer Verfahren zur Erfassung von Akkulturationsstress
- Analyse der Zusammenhänge zwischen individueller Akkulturationsstrategie und erlebtem Akkulturationsstress
- Bewertung des Einflusses der Orientierung an der Aufnahme- und Herkunftskultur auf den Akkulturationsstress
- Untersuchung der Rolle von Moderatorvariablen wie Alter, Geschlecht, Partnerschaftsstatus und Migrationshintergrund auf den Akkulturationsstress
- Beziehung zwischen Akkulturationsstress und wahrgenommener Diskriminierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Einleitung in das Thema Akkulturation, Darstellung der Relevanz des Themas in Deutschland und Vorstellung der Forschungsfragen.
- Kapitel 2: Theoretischer Hintergrund: Definition von Akkulturation, Beschreibung des Rahmenmodells der Akkulturation nach Berry, Vorstellung der vier Akkulturationsstrategien, Erläuterung des Konzepts Akkulturationsstress (AKS) und Darstellung des Zusammenhangs zwischen AKS und Akkulturationsstrategien.
- Kapitel 3: Methode: Beschreibung der verwendeten Erhebungsinstrumente (FRAKK, SAFE, RASI, PEDQ) und weiterer Variablen (soziodemographische Daten), Erläuterung des Untersuchungsdesigns und der Datenaufbereitung sowie Darstellung der Stichprobe.
- Kapitel 4: Ergebnisse: Deskriptive Statistik der eingesetzten diagnostischen Instrumente, Analyse der Zusammenhänge zwischen den drei AKS-Messinstrumenten, Untersuchung des Zusammenhangs zwischen AKS und Orientierung an der Herkunfts- und Aufnahmekultur, sowie Analyse des Zusammenhangs zwischen AKS und den Akkulturationsstrategien. Zusätzlich werden die Hypothesen zu weiteren Variablen wie Geschlecht, Besitz des deutschen Passes, Beziehungsstatus, Migrationsgeneration und Alter bei der Auswanderung überprüft.
Schlüsselwörter
Akkulturation, Akkulturationsstress, Migrationshintergrund, diagnostische Verfahren, FRAKK, SAFE, RASI, PEDQ, Orientierung an der Aufnahmekultur, Orientierung an der Herkunftskultur, Akkulturationsstrategien, Moderatorvariablen, Diskriminierung
- Quote paper
- Margarita Mishinova (Author), 2017, Vergleich unterschiedlicher Skalen zur Erfassung von Akkulturationsstress anhand einer Befragung von Migranten in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379406