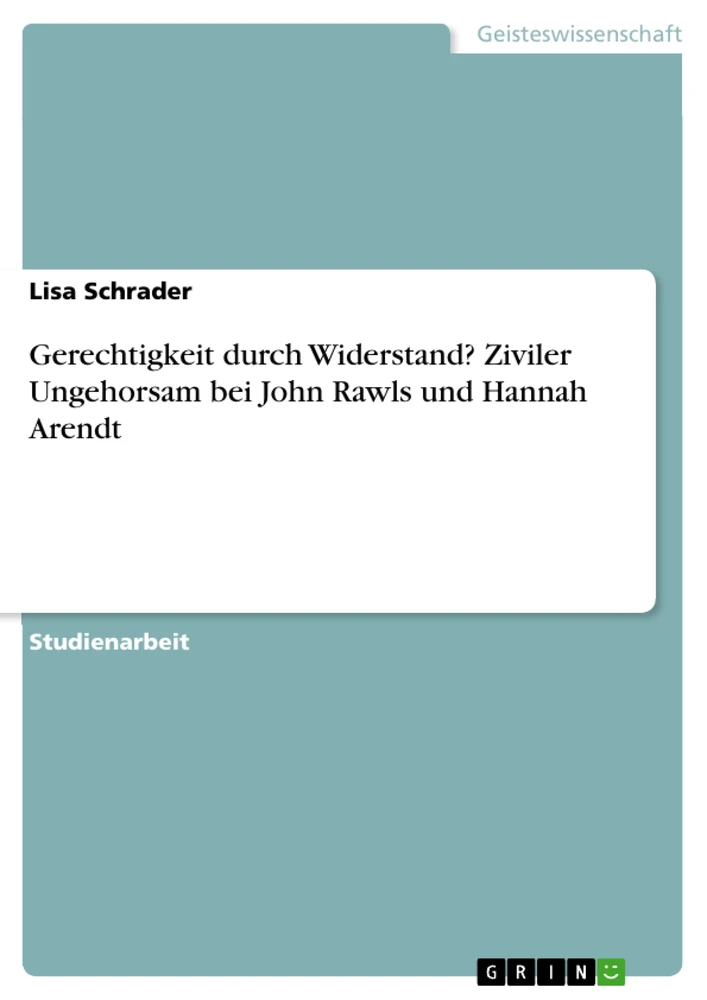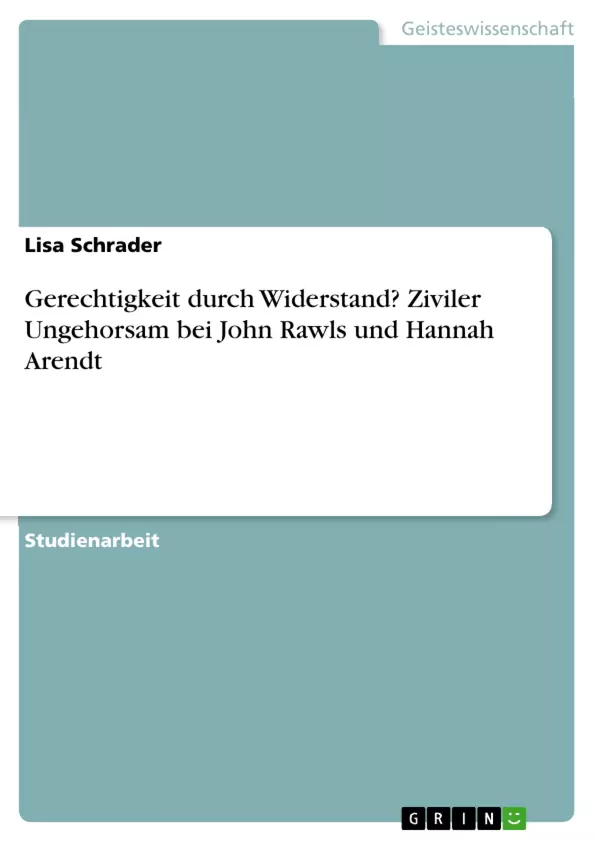Diese Arbeit stellt Rawls Verständnis von zivilem Ungehorsam dem von Arendt gegenüber. Welche Argumente sprechen für begrenzte Einsatzmöglichkeiten von zivilem Ungehorsam, welche für umfangreiche? Welche definitorischen Grenzen sind möglicherweise zu eng gefasst, welche zu weit? Kapitel 2 erörtert die Grundüberlegungen von John Rawls zu seiner Theorie der Gerechtigkeit, sowie seine Definition von zivilen Ungehorsam und dessen Einsatzmöglichkeiten. Kapitel 3 beschreibt Hannah Arendts Überlegungen zu Voraussetzungen und gesellschaftlicher Bedeutung des zivilen Ungehorsams. Im darauffolgenden vierten Kapitel werden ausgewählte Positionen beider Autoren gegenübergestellt und diskutiert, ehe im fünften Kapitel ein abschließendes Fazit gezogen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziviler Ungehorsam bei John Rawls
- Grundlagen der Gerechtigkeitstheorie
- Definition und Rechtfertigung des zivilen Ungehorsams
- Rolle des zivilen Ungehorsams in der Gesellschaft
- Ziviler Ungehorsam bei Hannah Arendt
- Definition und Rechtfertigung des zivilen Ungehorsams
- Institutionalisierung des zivilen Ungehorsams
- Kritik und Diskussion
- Voraussetzungen für zivilen Ungehorsam - Zustand einer Gesellschaft
- Grundlage des zivilen Ungehorsams – Meinung, Gewissen und Intuition
- Rolle des zivilen Ungehorsams – Ausnahme oder Regel?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem zivilen Ungehorsam und stellt die Konzepte von John Rawls und Hannah Arendt gegenüber. Ziel ist es, die unterschiedlichen Ansätze zur Rechtfertigung und zum Einsatz von zivilen Ungehorsam zu analysieren und die jeweiligen Argumente zu diskutieren.
- Definition und Rechtfertigung des zivilen Ungehorsams
- Rolle des zivilen Ungehorsams in der Gesellschaft
- Voraussetzungen und Grenzen für zivilen Ungehorsam
- Institutionalisierung des zivilen Ungehorsams
- Die Bedeutung von Meinung, Gewissen und Intuition für zivilen Ungehorsam
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 stellt die Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls vor und beleuchtet seine Argumentation zum zivilen Ungehorsam. Es werden die Grundlagen der Gerechtigkeitstheorie erläutert, seine Definition des zivilen Ungehorsams dargestellt und seine Überlegungen zu dessen rechtmäßigem Einsatz in der Gesellschaft beleuchtet.
Kapitel 3 konzentriert sich auf Hannah Arendts Verständnis von zivilen Ungehorsam. Es werden ihre Definition und Rechtfertigung des zivilen Ungehorsams, sowie ihre Überlegungen zur Institutionalisierung desselben in der Gesellschaft dargelegt.
Kapitel 4 stellt ausgewählte Positionen von Rawls und Arendt gegenüber und diskutiert die unterschiedlichen Ansätze zum zivilen Ungehorsam. Dabei werden die Voraussetzungen für zivilen Ungehorsam, die Rolle des zivilen Ungehorsams in der Gesellschaft und die Bedeutung von Meinung, Gewissen und Intuition für zivilen Ungehorsam thematisiert.
Schlüsselwörter
Ziviler Ungehorsam, Gerechtigkeitstheorie, John Rawls, Hannah Arendt, Konstitutionelle Demokratie, Gesellschaftsvertrag, Gerechtigkeitsgrundsätze, Urzustand, Schleier des Nichtwissens, Grundfreiheiten, natürliche Pflichten, Meinung, Gewissen, Intuition.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ziviler Ungehorsam laut John Rawls?
Für Rawls ist ziviler Ungehorsam eine öffentliche, gewaltlose und gewissensbestimmte gesetzwidrige Handlung, die darauf abzielt, eine Änderung der Gesetze oder der Regierungspolitik herbeizuführen, innerhalb eines fast gerechten Staates.
Wie unterscheidet sich Hannah Arendts Sichtweise davon?
Arendt sieht zivilen Ungehorsam weniger als individuelle Gewissensentscheidung, sondern als kollektives politisches Handeln. Sie schlägt sogar eine Institutionalisierung vor, um den Ungehorsam als Teil der demokratischen Praxis zu integrieren.
Wann ist ziviler Ungehorsam bei Rawls gerechtfertigt?
Er ist gerechtfertigt bei schwerwiegenden Verletzungen des Gerechtigkeitsgrundsatzes (z.B. Verletzung der Grundfreiheiten) und wenn alle legalen Mittel zur Änderung bereits ausgeschöpft wurden.
Was bedeutet der „Schleier des Nichtwissens“?
Es ist ein Gedankenexperiment von Rawls: Um faire Gerechtigkeitsgrundsätze zu finden, stellen wir uns vor, wir wüssten nicht, welche Position (reich, arm, begabt etc.) wir in der künftigen Gesellschaft einnehmen werden.
Warum ist Gewaltlosigkeit ein zentrales Merkmal?
Gewaltlosigkeit unterstreicht den Appell an den Gerechtigkeitssinn der Mehrheit und zeigt, dass der Handelnde das Rechtssystem grundsätzlich respektiert, auch wenn er gegen ein spezifisches Gesetz protestiert.
- Citation du texte
- Lisa Schrader (Auteur), 2017, Gerechtigkeit durch Widerstand? Ziviler Ungehorsam bei John Rawls und Hannah Arendt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380327