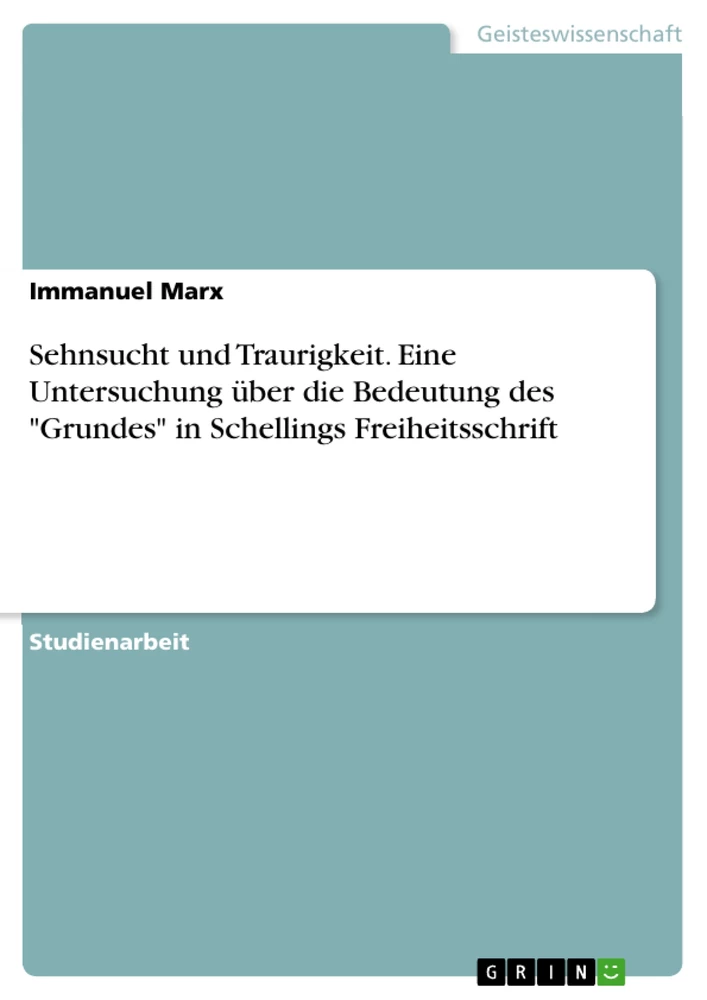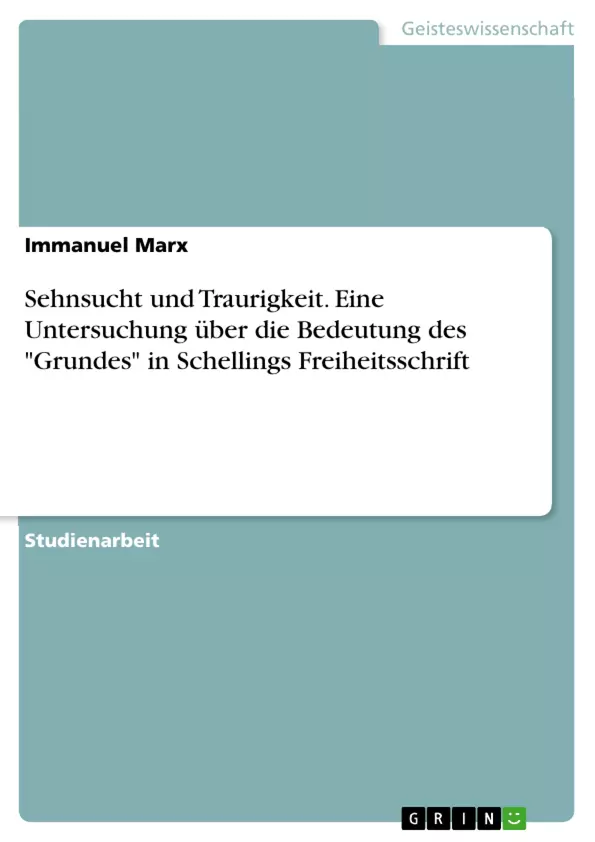„Eines zu sein mit allem, das ist Leben der Gottheit, das ist der Himmel des Menschen.“, schreibt Hölderlin im „Hyperion“. Man kann diesen Satz auffassen als einen Ausdruck tiefer Sehnsucht Hyperions gegenüber einer Welt, welche in unüberwindbarer Distanz ihre Schönheit dem leidenden Betrachter entzieht. Was Hyperion verlangt, ist die kühle Schönheit der ihn umgebenden Natur festzuhalten. Weil er aber um seine eigene Vergänglichkeit weiß, wird er sich der Vergeblichkeit all seiner Bemühungen, diesen Spalt, an dem zugrunde zu gehen er droht, zu überwinden, bewusst; indem er das allumfassende Sein, die universale Einheit aber beschwört, erhofft er sich die ersehnte Einheit zu erreichen, eins zu sein mit der Welt. In Gott indessen sei Einheit verwirklicht, weil er nicht als ein außerhalb der Schöpfung agierender Intellekt verstanden wird, sondern als vereinigende Kraft gedacht wird, welche den Hiatus zwischen Subjekt und Objekt, Betrachter und Natur aufhebt. Somit würden die Kategorien von Subjekt und Objekt, Innerem und Äußerem, welche die Sprache und somit auch das Denken strukturieren als Illusionen entlarvt. Die Sehnsucht, eins zu sein mit Allem, stellt in der Folge eine metaphysische Herausforderung dar, weil sie verlangt, das Objekt der Sehnsucht – das Naturschöne – ihrer Fremdheit zu berauben, um es integrieren zu können in ein allumfassendes Sein. Sobald aber dieses allumfassende Sein erreicht worden ist, löst es sich auf, weil mit der Überwindung des Anderen zugleich das sehnende Subjekt sich ausgelöscht hat. Dieses Problem erregte die Motivation der Philosophen nach Kant, die Vorstellung eines Allumfassenden, Absoluten aufrechtzuerhalten ohne sich in innere Widersprüche zu verwickeln. Hinter all diesem Bestreben aber steht das Verlangen, welches im eingangs erwähnten Zitat von Hölderlins „Hyperion“ zum Ausdruck kommt: Eines zu sein mit Allem! [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: 'Ev кαι лαv..
- II. Jenseits der Sprache....
- III. Die Existenz und deren Grund.....
- IV. Sehnsucht und Traurigkeit..
- V. Die All-Einheit der Liebe..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung des „Grundes“ in Schellings Freiheitsschrift und untersucht dabei die Rolle von Sehnsucht und Traurigkeit in diesem Zusammenhang.
- Die Beziehung zwischen Sehnsucht und dem „Grund“ der Existenz.
- Die Rolle der Liebe als verbindendes Element und Ausdruck des „Grundes“.
- Die transzendentale Natur des „Grundes“ und die Grenzen der Sprache.
- Die Herausforderungen der philosophischen Konstruktion einer allumfassenden Einheit.
- Die Bedeutung von Sehnsucht und Traurigkeit im Kontext der Liebe und Einheit.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Ev KHI TTQV
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: die Bedeutung des „Grundes“ in Schellings Freiheitsschrift im Kontext von Sehnsucht und Traurigkeit. Sie beleuchtet Hyperions Sehnsucht nach Einheit mit der Welt und die damit verbundene Problematik der Fremdheit des Anderen. Die Liebe als „höchstes“ Prinzip und die Rolle des „Grundes“ in der Entstehung der Welt werden kurz dargestellt.
II. Jenseits der Sprache
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Problematik, das „Absolute“ sprachlich zu fassen. Schellings Konzeption eines Seins, das jenseits der Subjekt-Objekt-Relation existiert, führt zu der paradoxen Situation, dass Sein und Nichts identisch sind, da Sprache zur Beschreibung des Absoluten versagt.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Schelling unter dem Begriff des „Grundes“?
Der „Grund“ ist in Schellings Freiheitsschrift ein zentrales Konzept, das die Basis der Existenz beschreibt und eine notwendige Voraussetzung für die Entstehung der Welt und die menschliche Freiheit darstellt.
Welche Bedeutung haben Sehnsucht und Traurigkeit in dieser Philosophie?
Sie werden als metaphysische Zustände interpretiert, die das Verlangen nach der Aufhebung der Trennung zwischen Subjekt und Objekt sowie das Streben nach einer allumfassenden Einheit ausdrücken.
Warum stößt die Sprache bei der Beschreibung des Absoluten an ihre Grenzen?
Da Sprache durch die Unterscheidung von Subjekt und Objekt strukturiert ist, kann sie ein Sein, das jenseits dieser Relationen existiert, nur paradox oder unzureichend erfassen.
Welchen Bezug nimmt die Arbeit auf Hölderlins „Hyperion“?
Hyperions Sehnsucht, „eins zu sein mit Allem“, dient als Ausgangspunkt, um die philosophische Herausforderung der Überwindung von Fremdheit und Distanz zu illustrieren.
Welche Rolle spielt die Liebe in Schellings System?
Die Liebe wird als das höchste vereinigernde Prinzip gedacht, das den Hiatus zwischen Betrachter und Natur aufhebt und die „All-Einheit“ ermöglicht.
- Citar trabajo
- Immanuel Marx (Autor), 2017, Sehnsucht und Traurigkeit. Eine Untersuchung über die Bedeutung des "Grundes" in Schellings Freiheitsschrift, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/381042