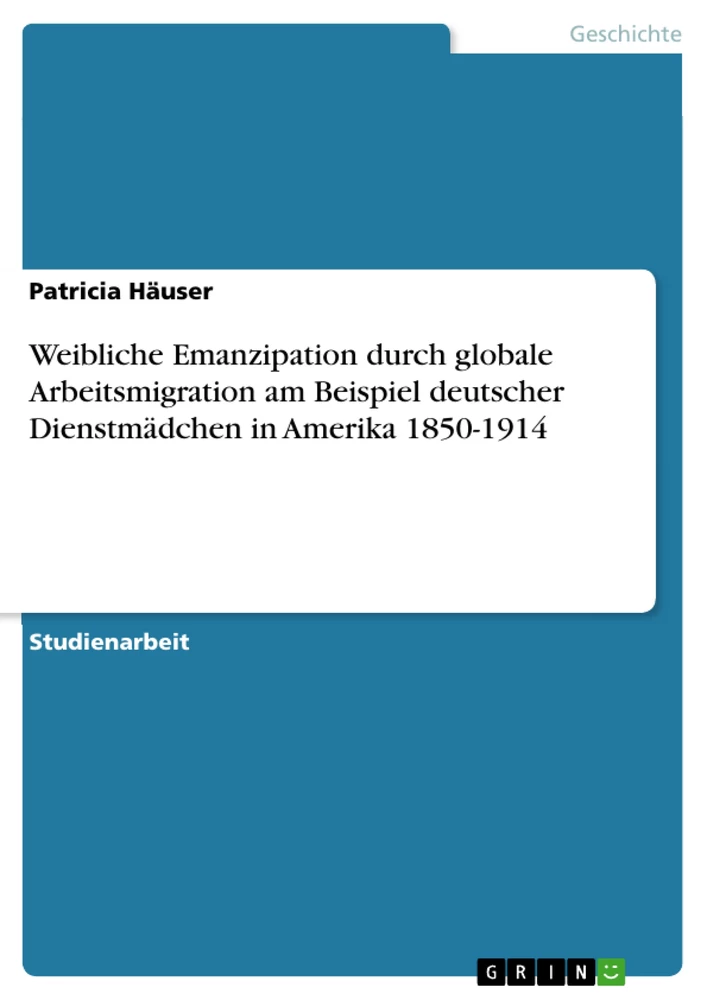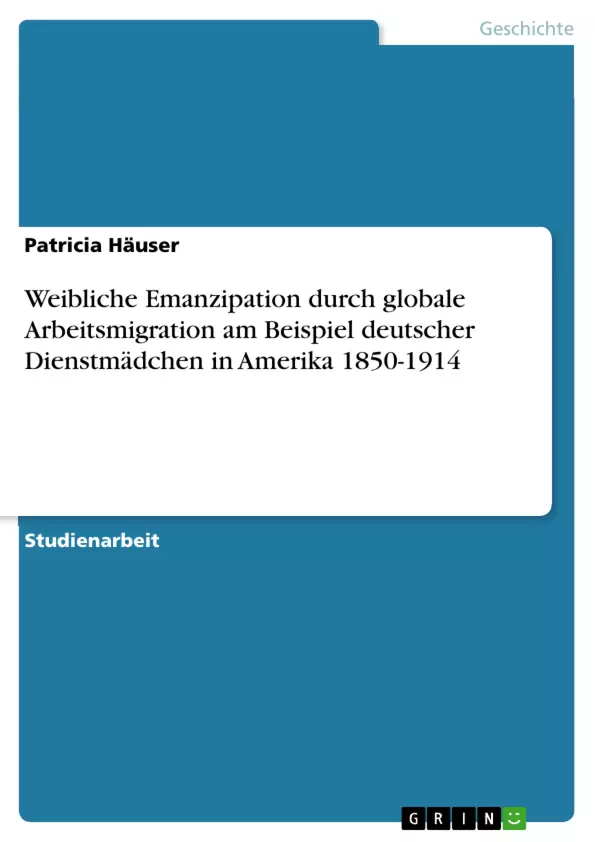Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die freiwillige Arbeitsmigration von Frauen im 19. Jahrhundert zu ihrer Emanzipation beitrug. Im Fokus der Abhandlung stehen der Emanzipationsbegriff selbst, sowie die Veränderung der Lebensumstände und der Selbstwahrnehmung jener Auswanderinnen unter Berücksichtigung des damaligen weiblichen Rollenbildes. Exemplarisch wurden hierfür die deutschen Dienstmädchen betrachtet, welche aus dem deutschen Kaiserreich nach Amerika auswanderten.
Ausgangspunkt der Abhandlung ist das Werk von Silke Wehner-Franco „Deutsche Dienstmädchen in Amerika: 1850-1914“. Auszüge aus Briefen von ausgewanderten Dienstmädchen aus ebendiesem Werk, sowie Interviews von Zeitzeuginnen aus Dorothee Wierlings „Mädchen für alles“ und Autobiographien deutscher Dienstmädchen aus Karin Paulweits „Dienstmädchen um die Jahrhundertwende“ dienen als Quellenmaterial.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Emanzipation: Begriff und Definition
- 2.2 Historischer Kontext: Dienstbotenfrage und „servant problem“
- 3 Motivation deutscher Frauen
- 3.1 Gründe Dienstmädchen zu werden
- 3.2 Migrationsgründe
- 4 Vergleich Deutschland / Amerika
- 4.1 Arbeitsbedingungen
- 4.1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 4.1.2 Arbeitszeiten
- 4.1.3 Lohn
- 4.2 Gesellschaftliches
- 4.2.1 Beziehung zur Herrschaft
- 4.2.2 Freizeitgestaltung
- 4.2.3 Fremdwahrnehmung
- 4.2.4 Rollenbild der Frau
- 4.1 Arbeitsbedingungen
- 5 Entwicklung der Dienstmädchen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, inwieweit die freiwillige Arbeitsmigration von Frauen im 19. Jahrhundert zu ihrer Emanzipation beitrug. Dabei stehen der Emanzipationsbegriff selbst, die Veränderung der Lebensumstände und der Selbstwahrnehmung von Auswanderinnen sowie das damalige weibliche Rollenbild im Fokus.
- Der Emanzipationsbegriff und seine Bedeutung für Frauen im 19. Jahrhundert
- Die Situation der Dienstmädchen im Deutschen Kaiserreich und in Amerika
- Die Motivation von deutschen Frauen, als Dienstmädchen nach Amerika auszuwandern
- Die Arbeitsbedingungen und das gesellschaftliche Umfeld von Dienstmädchen in Amerika
- Die Entwicklung der Selbstwahrnehmung und der Rolle von Dienstmädchen im Laufe des 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit, die deutsche Dienstmädchenmigration nach Amerika im 19. Jahrhundert, vor. Sie erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der Emanzipationsgeschichte und der Bedeutung von Arbeitsmigration für die Lebensbedingungen und Selbstwahrnehmung von Frauen.
Das Kapitel 2.1 behandelt den Begriff der Emanzipation und seine historischen Entwicklungen. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf den Begriff und seine vielfältigen Bedeutungen im Kontext der Selbstbefreiung von gesellschaftlichen Normen und Strukturen.
Kapitel 2.2 befasst sich mit dem historischen Kontext der Dienstbotenfrage und dem „servant problem“ in Deutschland und Amerika. Es analysiert die Ursachen für den Mangel an Dienstboten im 19. Jahrhundert und die Rolle von Arbeitsmigration in diesem Zusammenhang.
Kapitel 3 beleuchtet die Gründe, warum deutsche Frauen Dienstmädchen wurden und nach Amerika auswanderten. Es betrachtet die individuellen Lebensumstände und die sozialen und ökonomischen Faktoren, die diese Entscheidungen beeinflussten.
Kapitel 4 vergleicht die Arbeitsbedingungen und das gesellschaftliche Umfeld von deutschen Dienstmädchen in Deutschland und Amerika. Es analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, Arbeitszeiten, Löhne und die Beziehungen zwischen Dienstmädchen und Herrschaften in beiden Ländern.
Kapitel 5 untersucht die Entwicklung der Dienstmädchen im Laufe des 19. Jahrhunderts. Es analysiert die Veränderungen in ihrer Selbstwahrnehmung und in ihrer Rolle in der Gesellschaft, die durch die Arbeitsmigration und die neuen Lebensumstände in Amerika entstanden sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der weiblichen Emanzipation im Kontext von Arbeitsmigration, der Rolle von Dienstmädchen in Deutschland und Amerika im 19. Jahrhundert, der Geschichte der Dienstbotenfrage, dem „servant problem“, den Arbeitsbedingungen und dem gesellschaftlichen Umfeld von Dienstmädchen, den Migrationsgründen und der Selbstwahrnehmung von Frauen in einer neuen Kultur. Sie analysiert den Einfluss der Arbeitsmigration auf die Emanzipation von Frauen und die Veränderung ihrer Lebensumstände und ihrer Rolle in der Gesellschaft. Die Arbeit stützt sich auf Quellen aus der Zeit, wie Briefe von Dienstmädchen, Interviews mit Zeitzeuginnen und Autobiografien. Wichtige Konzepte sind der Emanzipationsbegriff, der Begriff der Selbstermächtigung, die Veränderung des Rollenbildes der Frau und die Rolle der Arbeitsmigration in der Geschichte der Frauenemanzipation.
- Citation du texte
- Patricia Häuser (Auteur), 2017, Weibliche Emanzipation durch globale Arbeitsmigration am Beispiel deutscher Dienstmädchen in Amerika 1850-1914, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/381262