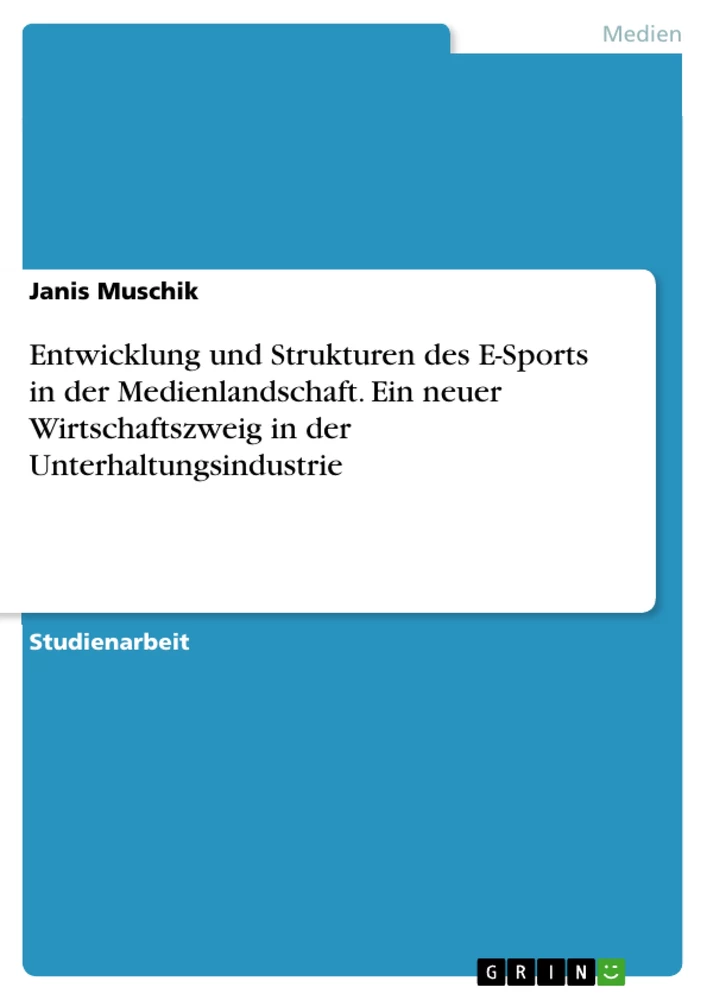Computer- und Videospiele begeistern die Menschheit seit ihrem Aufkommen vor circa 50 Jahren. Von anfänglichen technischen Versuchen in Universitäten entwickelten sie sich zu einer der einflussreichsten Freizeitbeschäftigungen unseres Jahrhunderts. Doch damit sind die Videospiele noch längst nicht an ihrem Zenit angekommen. In den letzten Jahren wuchs der Trend, Videospiele in riesigen Hallen, vor tausenden Zuschauern zu spielen. Enorme Preisgelder sind dabei keine Seltenheit mehr. Die Rede ist hierbei vom E-Sport, also dem Spielen von Videospielen in einem sportlichen Wettkampf.
Diese Arbeit veranschaulicht die komplexen Strukturen des E-Sports und untersucht, ob von einem Sport im herkömmlichen Sinne gesprochen werden kann, oder der Begriff lediglich eine Rechtfertigung für das Spielen von Videospielen darstellt. Dafür werden die Terminologien von Sport und E-Sport verglichen, um zu klären, ob der E-Sport als eine eigene Sportart angesehen werden kann oder nicht und somit den Namen zurecht trägt. Im weiteren Verlauf der Arbeit erhalten wir einen Einblick, wie sich der E-Sport überhaupt entwickeln konnte und welche Spiele für diese professionelle Weise des Spielens geeignet sind, denn nicht jedes Videospiel erfüllt die Voraussetzungen, die der E-Sport vorgibt. Im Anschluss steht daraufhin der Einfluss des E-Sports auf die Medien im Fokus.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der E-Sport als anerkannte Sportart?
- 2.1 Eine Einführung in die Welt des E-Sports
- 2.2 Definitionen
- 2.2.1 Definition des allgemeinen Sportbegriffs
- 2.2.2 Definition E-Sport
- 2.3 Verdient der E-Sport nun seinen Namen?
- 3 Die Strukturen des E-Sports
- 3.1 Pro-Gamer
- 3.2 Clans
- 3.3 Ligen und große Turniere
- 3.4 Die Entwicklung des E-Sports
- 3.4.1 Wie der E-Sport ins Leben gerufen wurde
- 3.4.2 Beliebte Spiele der E-Sport-Szene und warum diese?
- 4 Neuer Wirtschaftszweig der Unterhaltungsindustrie
- 4.1 Die Marktentwicklung des E-Sports
- 4.2 Die Medialisierung der Thematik E-Sport
- 4.2.1 Der E-Sport in den Onlinemedien
- 4.2.2 Die Annäherung von Fernsehen und E-Sport
- 4.2.3 Der E-Sport in weiteren Medien
- 4.3 Realer und virtueller Fußball im Einklang
- 4.4 Die Gamescom als Mekka der E-Sportler
- 5 Gewalt in Videospielen als Hemmnis für den E-Sport
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die aufstrebende Entwicklung des E-Sports und seine Einordnung in die Medienlandschaft. Die Analyse soll klären, ob der E-Sport als Sportart im herkömmlichen Sinne betrachtet werden kann oder ob der Begriff lediglich eine Rechtfertigung für das Spielen von Videospielen darstellt.
- Definitionen von Sport und E-Sport im Vergleich
- Entwicklungsgeschichte und Strukturen des E-Sports
- Mediale Präsenz und Einfluss des E-Sports
- Der Einfluss von Gewalt in Videospielen auf den E-Sport
- Relevanz des E-Sports für die Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung führt den Leser in die Welt des E-Sports ein und beschreibt die rasante Entwicklung des Phänomens in den letzten Jahren. Sie stellt die Relevanz des Themas für die Gesellschaft und die Wissenschaft dar.
- Kapitel 2: Der E-Sport als anerkannte Sportart?: Dieses Kapitel untersucht, ob der E-Sport den Kriterien einer herkömmlichen Sportart entspricht. Es werden Definitionen von Sport und E-Sport gegenübergestellt und die aktuelle Debatte um die Anerkennung des E-Sports als Sportart beleuchtet.
- Kapitel 3: Die Strukturen des E-Sports: Dieses Kapitel beleuchtet die Organisationsstrukturen des E-Sports und beschreibt die Rollen von Pro-Gamern, Clans, Ligen und Turnieren. Es wird auch auf die Entstehungsgeschichte des E-Sports eingegangen und beliebte E-Sport-Spiele werden vorgestellt.
- Kapitel 4: Neuer Wirtschaftszweig der Unterhaltungsindustrie: Dieses Kapitel befasst sich mit dem wirtschaftlichen Einfluss des E-Sports und der Entwicklung des E-Sport-Marktes. Es wird die zunehmende Medialisierung des E-Sports beleuchtet und die Präsenz des E-Sports in verschiedenen Medien, wie Online-Plattformen, Fernsehen und anderen Medien, untersucht.
- Kapitel 5: Gewalt in Videospielen als Hemmnis für den E-Sport: Dieses Kapitel beleuchtet die Kontroverse um die Gewalt in Videospielen und die Auswirkungen auf die Anerkennung und Akzeptanz des E-Sports. Es wird diskutiert, ob gewalttätige Darstellungen in Videospielen den E-Sport in seiner Entwicklung und medialen Präsenz behindern können.
Schlüsselwörter
E-Sport, Sportart, Videospiele, Pro-Gamer, Clans, Ligen, Turniere, Medialisierung, Gewalt in Videospielen, Marktentwicklung, Unterhaltungsindustrie, Casual Gaming, Deutsche Olympische Sportbund (DOSB)
Häufig gestellte Fragen
Ist E-Sport eine anerkannte Sportart?
Die Debatte ist komplex. Während Kritiker den Mangel an körperlicher Aktivität betonen, argumentieren Befürworter mit den hohen kognitiven Anforderungen und dem wettbewerblichen Charakter, der dem traditionellen Sport ähnelt.
Was sind Pro-Gamer und Clans?
Pro-Gamer sind professionelle Spieler, die ihren Lebensunterhalt durch Preisgelder und Sponsoring verdienen. Clans sind organisierte Teams oder Vereine, in denen diese Spieler zusammenarbeiten.
Welche Spiele eignen sich für den E-Sport?
Nicht jedes Spiel ist geeignet. E-Sport-Titel benötigen eine hohe Spielbalance, strategische Tiefe und eine gute Zuschauertauglichkeit, wie etwa League of Legends oder Counter-Strike.
Welchen wirtschaftlichen Einfluss hat der E-Sport?
E-Sport hat sich zu einem riesigen Wirtschaftszweig in der Unterhaltungsindustrie entwickelt, mit Millionenumsätzen durch Werbung, Medienrechte und ausverkaufte Stadien.
Wie beeinflusst Gewalt in Videospielen die Akzeptanz von E-Sport?
Die Kontroverse um gewalthaltige Spiele (sog. "Killerspiele") behindert oft die offizielle Anerkennung durch Sportverbände wie den DOSB und erschwert die Gewinnung von Mainstream-Sponsoren.
- Quote paper
- Janis Muschik (Author), 2017, Entwicklung und Strukturen des E-Sports in der Medienlandschaft. Ein neuer Wirtschaftszweig in der Unterhaltungsindustrie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/382468