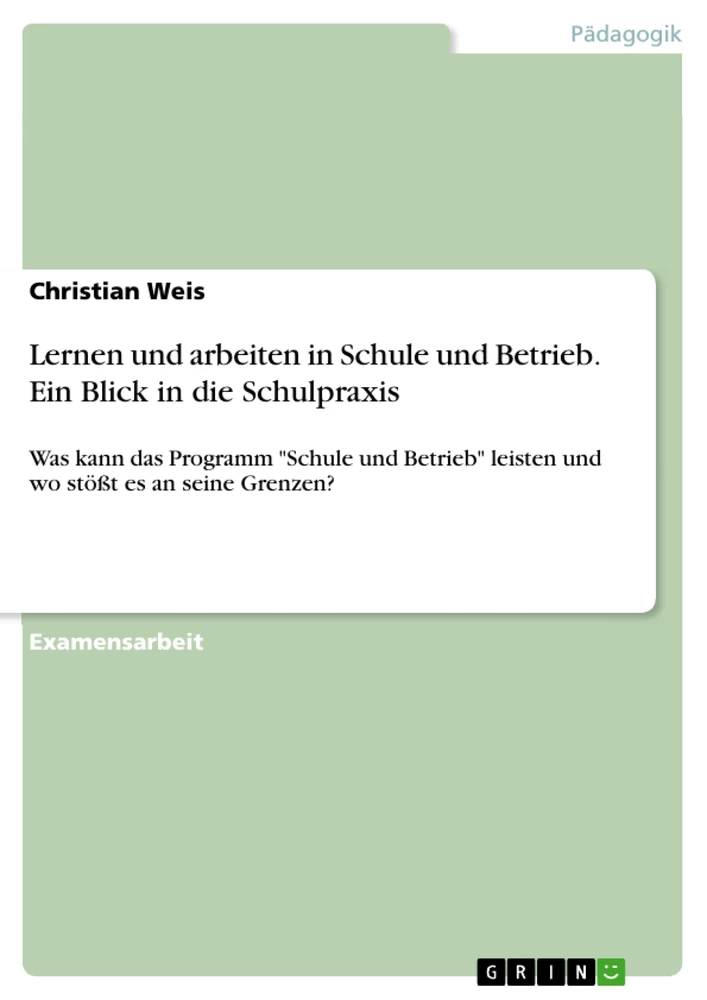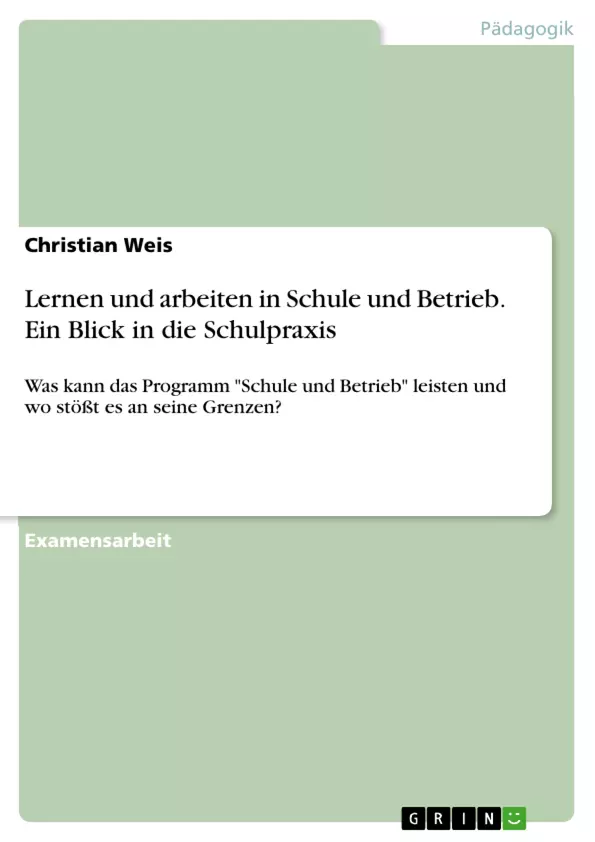[...] Das SchuB-Programm (Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb) verfolgt den Zweck, abschlussgefährdete und lernmüde Schüler/innen mit einer Kombination aus beruflichen Praxiselementen und schulcurricularen Basics für den Hauptschulabschluss zu motivieren. Zu diesem Zweck teilt sich die Schulwoche der Schüler/innen in drei Schul- und zwei Arbeitstage, welche die Lernenden in Ausbildungsbetrieben verbringen.
Das wirklich Besondere an der SchuB-Idee, dass mich auch Jahre nach meinem Aufenthalt an der WvE-Schule noch begeistert, ist die Vorstellung einer qualitativen statt quantitativen Veränderung von Schule. Ich möchte kurz erklären, inwiefern diese Erkenntnis meinen praktischen Erfahrungsschatz bereichert hat:
Mit dem SchuB-Programm wurde der Versuch unternommen, Schule zeitgemäß zu gestalten. Zeitgemäß heißt, bestehende Strukturen im Schulwesen aufzubrechen, zu verändern und zu aktualisieren. Zeitgemäß bedeutet auch, das Bildungssystem auf die Bedürfnisse und den Lebensstil einer Generation anzupassen, anstatt ohnehin schulschwache- und müde Schüler/innen, die sich dazu noch oft mit einer Handvoll außerschulischer Probleme und Konflikte auseinandersetzen müssen, mit noch mehr Unterricht, Lernzeit und Nachhilfe zu konfrontieren. Ebendas versucht SchuB. Das Programm bietet den Schülern/innen nicht einfach mehr von dem Schulkonzept, in dem sie zu scheitern drohen, sondern bemüht sich mit einer völlig neuen Idee, Schule für die betroffenen Jugendlichen wieder lebensrelevant zu gestalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Persönliche Motivation und Hintergründe für die Fragestellung
- 2. Was ist SchuB?
- 2.1. Offizielle Präsentation des hessischen Kultusministeriums
- 2.2. Lernortkooperation SchuB – Zuordnung und Unterscheidung verschiedener Modelle und Konzepte
- 2.3. Erlass über die Zusammenarbeit von Schule und Betrieb im Bereich der allgemeinbildenden und der berufsbildenden Schulen
- 2.3.1. Das Schulgesetz
- 2.3.2. Betriebliche Experten/innen in der Schule
- 2.3.4. Betriebspraktikum
- 2.3.5. Rückblick
- a) Benötigen die Lehrkräfte besondere Qualifikationen oder Kompetenzen?
- b) Wie vereinbart die Schule das Neutralitätsgebot mit eventuellen Versuchen der Vereinnahmung der Schüler/innen durch Betriebsinteressen?
- c) Inwieweit darf und muss sich die Schule als Bildungsmonopol externen Institutionen öffnen und sie am Bildungsauftrag beteiligen?
- d) Welche kommunikativen Besonderheiten erfordert die Zusammenarbeit von Schule und Betrieb?
- 2.4. Kritische Anmerkungen
- 2.5. Was hat das Kapitel „Was ist SchuB“ geleistet?
- 3. Übergang, Schnittstelle und Hürde Berufsausbildung: Über die zeitaktuelle Notwendigkeit von SchuB
- 3.1. Arbeitsmarktlage und Entwicklung der Schulabschlüsse: Chancen und Schwierigkeiten beim Übergang in die Berufswelt
- 3.2. Ein Projekt des Deutschen Jugendinstitutes: Übergangspanel
- 3.3. Interpretation der Ergebnisse
- 3.4. Ausblick
- 4. Von der Theorie in die Schulpraxis: Über die Wirkung von SchuB im Klassenzimmer
- 4.1. Intention
- 4.2. Wahl und Begründung der Methode
- 4.2.1. Qualitative Sozialforschung
- 4.2.2. Forschungszugang
- 4.2.3. Methodik
- a) Vorwissen über den Forschungsgegenstand
- b) Historie und Forschungstradition
- c) Charakteristika der Stichprobe
- 4.3. Interview: Arbeitsschritte im qualitativen Forschungsprozess
- a) Basisphase
- b) Planungsphase
- c) Durchführungsphase
- d) Auswertungsphase
- 4.4. Auswertung und Interpretation der Interviews
- 4.4.1. Auswertung
- a) Ursachen
- b) Merkmale und ihre Wirkung
- 4.4.2. Interpretation
- 5. Fazit und Ausblick
- 6. Abkürzungsverzeichnis
- 7. Literaturverzeichnis
- 7.1. Literatur
- 7.2. Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem SchuB-Konzept, einem Programm zur Förderung von Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb. Das Ziel ist es, den Umfang, die Wirksamkeit und die Grenzen des SchuB-Konzepts in der Schulpraxis zu beleuchten.
- Das Konzept SchuB und seine Umsetzung in der Schule
- Die Rolle von SchuB im Übergang von der Schule in die Berufswelt
- Die Bedeutung von SchuB für die Lernmotivation und -erfolge von Schülern
- Kritische Betrachtung der Herausforderungen und Grenzen des SchuB-Konzepts
- Der Einfluss von SchuB auf die Entwicklung und Möglichkeiten des hessischen Kooperationsprojekts
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung bietet einen Überblick über die Struktur und den Verlauf der Arbeit, sowie die persönlichen Motivationen und Hintergründe des Autors für die Wahl des Themas.
- Das zweite Kapitel erläutert den Begriff SchuB und seine verschiedenen Erscheinungsformen, sowie den schulgesetzlichen Rahmen für die Zusammenarbeit von Schule und Betrieb.
- Das dritte Kapitel untersucht die Notwendigkeit des SchuB-Konzepts unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes und den damit verbundenen Konsequenzen für Heranwachsende mit einer geringen Bildungsaspiration.
- Das vierte Kapitel beleuchtet mit Hilfe der theoretisch-thematischen und wirtschaftspraktischen Erkenntnisse den Einfluss von SchuB auf die Lernbemühungen in der Schulpraxis und untersucht die subjektive Bedeutsamkeit und Wirksamkeit der Fördermaßnahme für die Schüler.
Schlüsselwörter
SchuB, Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb, Berufsbildung, Übergang Schule-Beruf, Lernmotivation, Fördermaßnahme, Qualitative Sozialforschung, Interview, Schulgesetz, Betriebspraktikum, Arbeitsmarkt, Bildungsaspiration, Schulpraxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das SchuB-Programm (Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb)?
SchuB ist ein Förderprogramm für abschlussgefährdete Schüler, das drei Schultage mit zwei Praxistagen in einem Ausbildungsbetrieb kombiniert.
Welches Ziel verfolgt das SchuB-Konzept?
Es soll lernmüde Jugendliche durch Praxisbezug motivieren, den Hauptschulabschluss zu erreichen und den Übergang in die Berufswelt zu erleichtern.
Warum ist SchuB heute so wichtig?
Angesichts der schwierigen Arbeitsmarktlage bietet es eine Alternative für Schüler, die im klassischen Schulsystem zu scheitern drohen, indem es Schule lebensrelevant gestaltet.
Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieb aus?
Die Zusammenarbeit ist durch Erlasse geregelt und umfasst Betriebspraktika sowie den Einsatz von betrieblichen Experten in der Schule zur praxisnahen Vermittlung von Inhalten.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung von SchuB?
Herausforderungen sind die notwendige Qualifikation der Lehrkräfte, die Wahrung des Neutralitätsgebots gegenüber Betriebsinteressen und die Koordination zwischen den Lernorten.
- Quote paper
- Christian Weis (Author), 2015, Lernen und arbeiten in Schule und Betrieb. Ein Blick in die Schulpraxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/382670