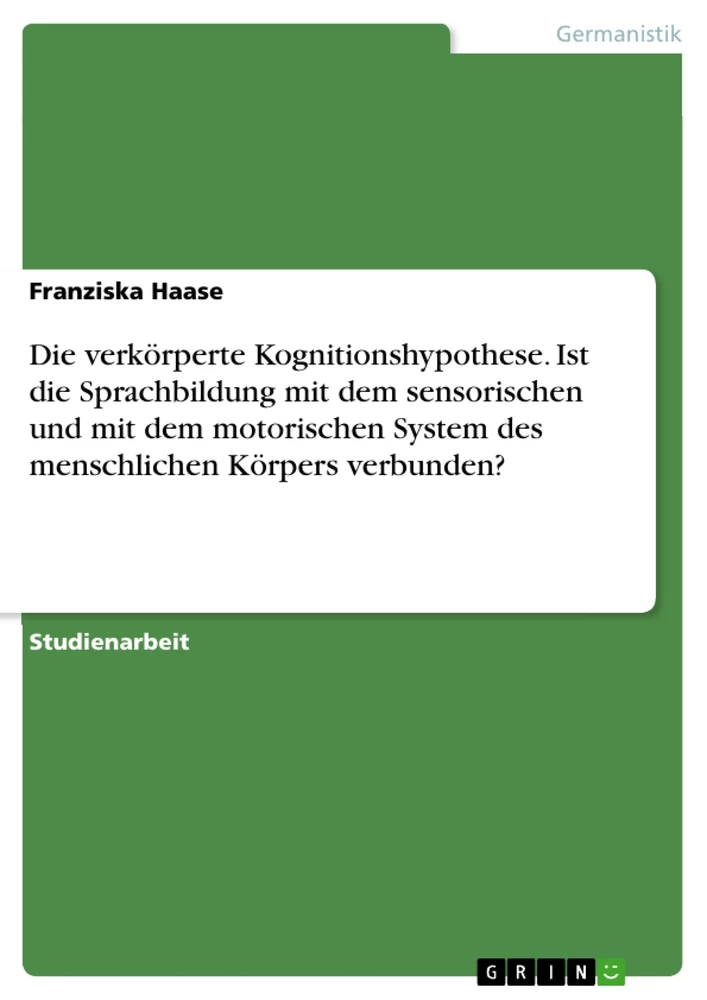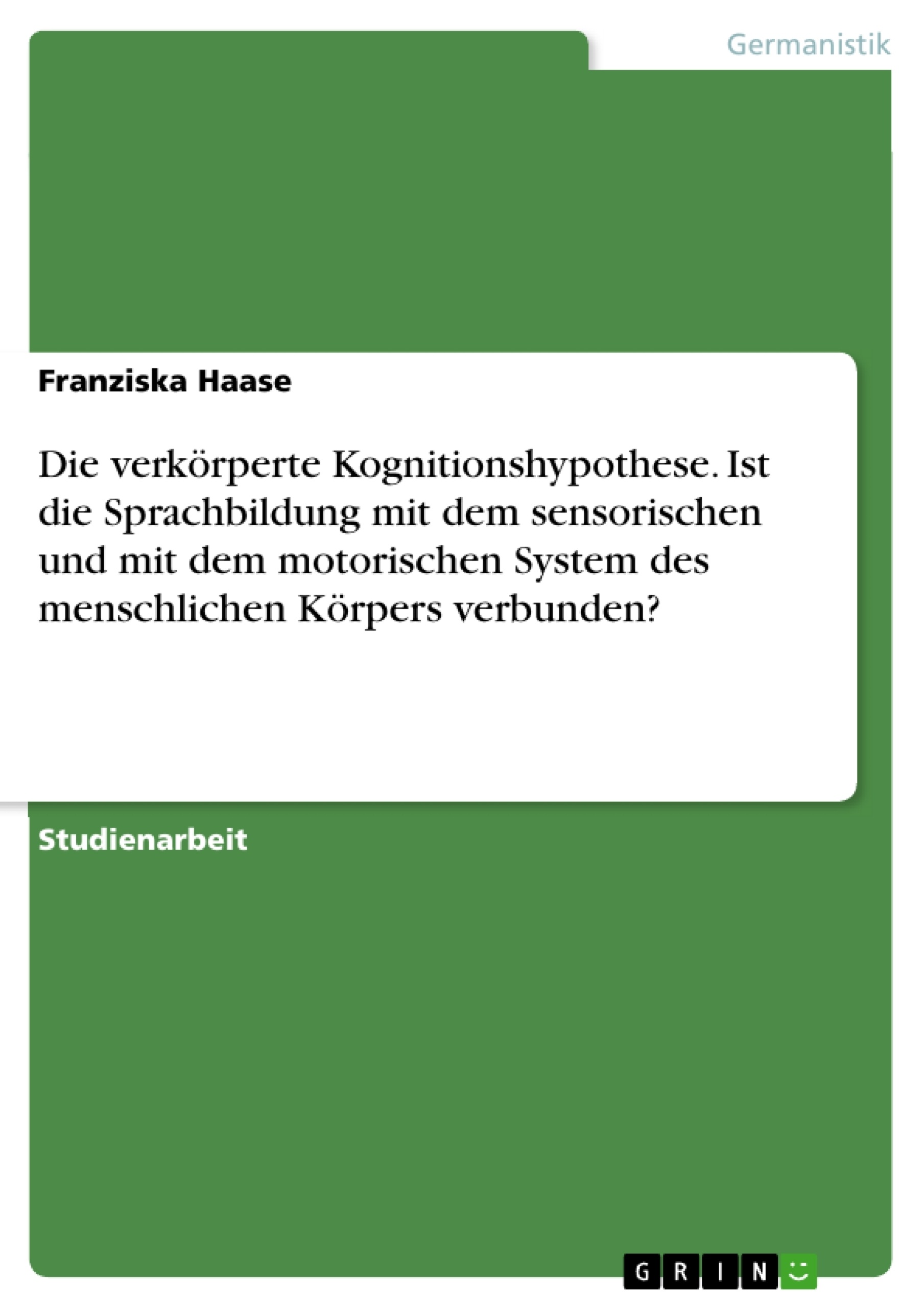Sprache ist für jeden von uns ein alltägliches Gut. Sie ist für jedermann unentbehrlich. So ist es nicht verwunderlich, dass es sich Sprachforscher zur Aufgabe gemacht haben, die Entstehung der Sprache genauer zu untersuchen. Über die Jahre sind verschiedene Theorien entstanden wie Sprache entsteht. Zum einen setzten Forscher auf eine Sprachbildung, die mit dem sensorischen und motorischen System des Körpers verbunden ist.
Ein anderer Teil der Forscher unterstützt die Theorie, dass die Sprachbildung unabhängig von der Bewegung des Körpers passiert. Wenn Studien zur verkörperten Kognitionshypothese durchgeführt werden, dann kann die Durchführung und die Betrachtung der Ergebnisse in vier Unterkategorien eingeteilt werden. Bei den vier Unterkategorien handelt es sich um die direkte Demonstration, die demonstrierten Verhaltensweisen, die Demonstrationen von sensorischen und motorischen Aktionen und die Betrachtung von beeinträchtigten lexikalischen Endscheidungsleistungen. Die meisten verwertbaren Studienergebnisse konnten erzielt werden, indem automatisierte motorische Prozesse untersucht wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung...
- Abhängigkeit der Sprachbildung vom sensorischen und motorischen System.......
- Betrachtung der TMS-Studie von Neininger und Pulvermüller und Betrachtung weiterer Studien Pulvermüllers....
- Betrachtung der Forschung von Boulenger in Bezug auf die Sprachverarbeitung der Parkinsonerkrankten………
- Vergleich Boulenger und Caramazza..
- Betrachtung der unverkörperten Kognitionshypothese......
- Schlussfazit..
- Literaturverzeichnis....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der verkörperten Kognitionshypothese und untersucht, ob die Sprachbildung mit dem sensorischen und motorischen System des menschlichen Körpers verbunden ist. Sie analysiert verschiedene Studien, um die Hypothese zu belegen und die unverkörperte Kognitionshypothese zu widerlegen.
- Die Abhängigkeit der Sprachbildung vom sensorischen und motorischen System.
- Die Analyse der TMS-Studie von Neininger und Pulvermüller.
- Die Untersuchung der Sprachverarbeitung bei Parkinsonerkrankten.
- Der Vergleich verschiedener Forschungsergebnisse zur verkörperten Kognitionshypothese.
- Die Gegenüberstellung der verkörperten und unverkörperten Kognitionshypothese.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Sprachbildung ein und stellt die beiden konkurrierenden Hypothesen, die verkörperte und die unverkörperte Kognitionshypothese, vor. Sie erläutert die Bedeutung der verkörperten Kognitionshypothese und skizziert die Forschungsstrategie der Arbeit.
Das zweite Kapitel analysiert die TMS-Studie von Neininger und Pulvermüller, die die enge Verbindung zwischen motorischem System und Sprachbildung beleuchtet. Es werden weitere Studien Pulvermüllers betrachtet, die die Hypothese der verkörperten Kognition unterstützen. Zudem wird die Forschung von Boulenger zur Sprachverarbeitung bei Parkinsonerkrankten vorgestellt und mit Caramazza verglichen.
Das dritte Kapitel widmet sich der unverkörperten Kognitionshypothese und stellt die Argumentation dieser Theorie dar. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der zuvor analysierten Studien die unverkörperte Kognitionshypothese widerlegen könnten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die verkörperte Kognitionshypothese, Sprachbildung, TMS-Studien, motorisches System, sensorisches System, Parkinsonerkrankte, unverkörperte Kognitionshypothese, neurologische Forschung, neuronale Prozesse.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die verkörperte Kognitionshypothese?
Diese Hypothese geht davon aus, dass die Sprachbildung und Sprachverarbeitung eng mit dem sensorischen und motorischen System des menschlichen Körpers verbunden sind, anstatt unabhängig davon abzulaufen.
Welche Rolle spielt das motorische System bei der Sprache?
Studien wie die TMS-Untersuchung von Neininger und Pulvermüller zeigen, dass automatisierte motorische Prozesse aktiviert werden, wenn wir Sprache verarbeiten, was auf eine neuronale Kopplung hindeutet.
Wie verarbeiten Parkinsonerkrankte Sprache?
Die Forschung von Boulenger zeigt, dass Beeinträchtigungen des motorischen Systems bei Parkinson-Patienten auch Auswirkungen auf die Verarbeitung von Aktionsverben haben können, was die verkörperte Kognition stützt.
Was ist die unverkörperte Kognitionshypothese?
Dies ist die Gegenansicht, nach der Sprachbildung ein rein kognitiver Prozess ist, der unabhängig von körperlichen Bewegungen oder sensorischen Erfahrungen im Gehirn stattfindet.
Was sind „lexikalische Entscheidungsleistungen“?
Dabei handelt es sich um die Fähigkeit des Gehirns, Wörter zu erkennen und zuzuordnen. Die Arbeit untersucht, wie diese Leistungen beeinträchtigt werden, wenn sensorische oder motorische Areale gestört sind.
- Citation du texte
- Franziska Haase (Auteur), 2016, Die verkörperte Kognitionshypothese. Ist die Sprachbildung mit dem sensorischen und mit dem motorischen System des menschlichen Körpers verbunden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383796