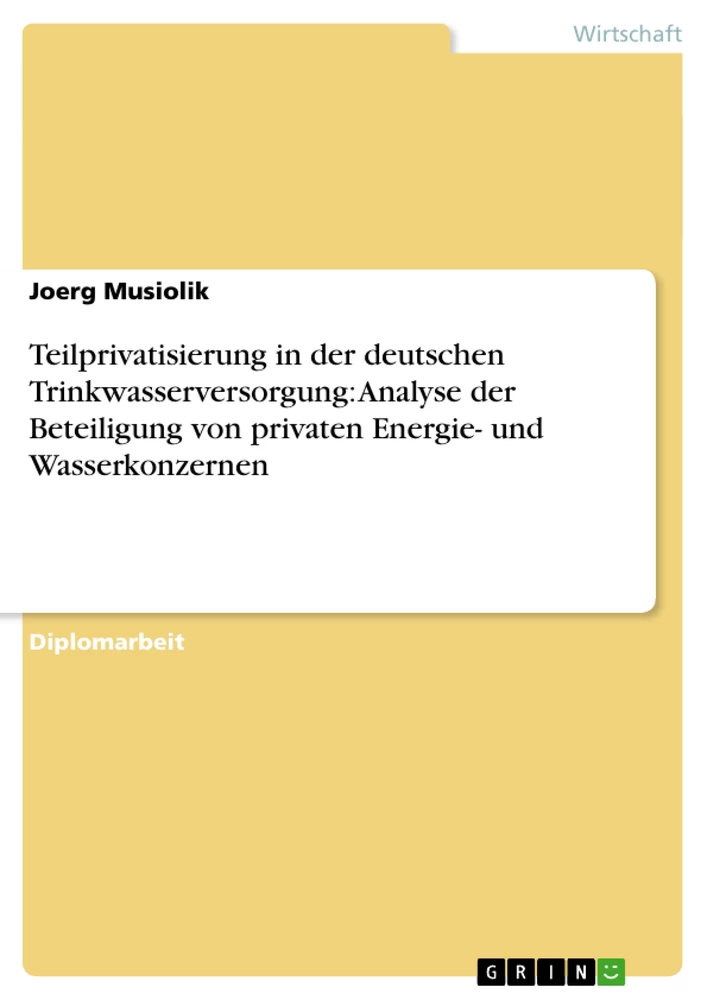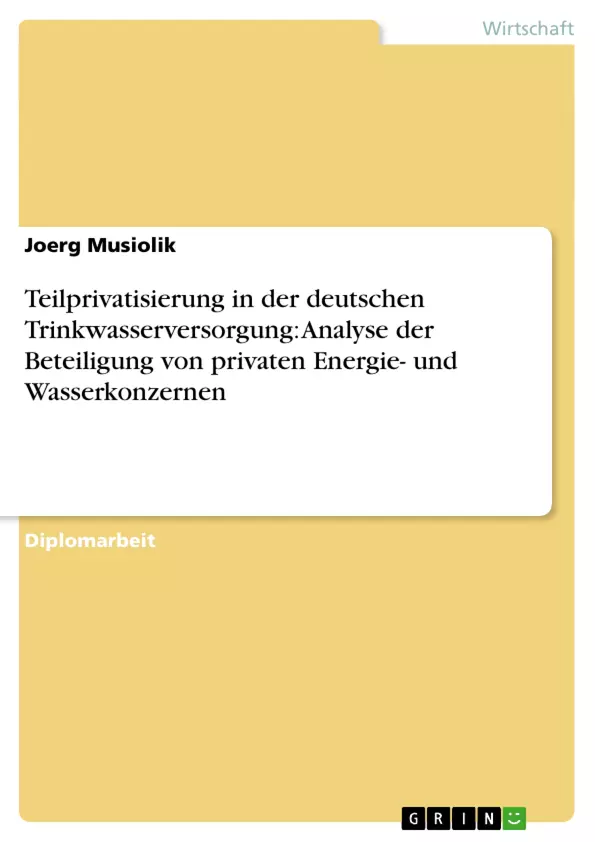Im Kontext der Privatisierungs- und Liberalisierungsdiskussion hat der Deutsche Bundestag am 21.03.2002 den Antrag „Nachhaltige Wasserwirtschaft in Deutschland“ verabschiedet und sich gegen eine Liberalisierung und für eine Modernisierung der deutschen Wasserwirtschaft ausgesprochen. Das Parlament hat sich damit eindeutig für den Erhalt der Wasserversorgung als kommunale Aufgabe entschieden und die kommunale Entscheidungshoheit und demokratische Kontrolle anerkannt. Gleichzeitig wird vor dem Hintergrund der kleinteiligen Organisationsstruktur, durch die Förderung kooperativer, bzw. öffentlich-privater Lösungen die Schaffung effizienter und wettbewerbsgerechter Dienstleistungsunternehmen angestrebt. Neben Elementen der Bestands- und Struktursicherung weist die Modernisierungsstrategie damit Optionen auf, privatwirtschaftliches Engagement und Wettbewerb in der Wasserwirtschaft zu implementieren. Ob sich ein fortschreitender Ausverkauf der kommunalen Trinkwasserversorgung mit den Interessen in Einklang bringen lässt, die sich am Gemeinwohl und der demokratischen Kontrolle ausrichten, ist zu bezweifeln. Eine Modernisierungsstrategie unter Förderung öffentlich-privater Lösungen ist mit dem Ziel der Bewahrung der Trinkwasserversorgung als kommunale Aufgabe unter Umständen nicht zu vereinbaren. Die Arbeit verfolgt daher nicht nur die Intention, die Entwicklung der Beteiligung von Konzernen an kommunalen Versorgungsunternehmen darzulegen und die Aktivitäten der Konzerne E.on, RWE, EnBW, Veolia, Suez/Ondeo und Gelsenwasser zusammenzufassen. Vielmehr sind die Hypothese zu überprüfen, ob Konzernbeteiligungen nur selektiv nach Regionen und bestimmten Gemeindegrößenklassen erfolgen, und ob durch die Teilprivatisierung von kommunalem Eigentum langfristig der kommunale Einfluss und das Gemeinwohl aus der kommunalen Trinkwasserversorgung verdrängt werden kann. Folgende Forschungsfragen dienen in der Arbeit als Orientierung: 1. Welche Konzernstrategien und -interessen lassen sich aus dem Prozess der Teilprivatisierung kommunaler Versorgungsunternehmen herleiten? 2. Welchen Einfluss haben Beteiligungen von Energie- und Wasserkonzernen auf die Wettbewerbsintensität und Effizienz im Trinkwassersektor? 3. In welchen Bundesländern und in welchen Gemeindegrößenklassen sind Teilprivatisierungen in der deutschen Trinkwasserversorgung besonders vertreten? Worin liegen die Gründe für diese Entwicklung? [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1. Einordnung des Themas
- 1.2. Zielsetzung und Fragestellung
- 1.3. Inhalt und Aufbau
- 2. DIE Ordnungspolitische Struktur der Trinkwasserversorgung in Deutschland
- 2.1. Definition: Trinkwasserversorgung und klassische Wasserversorgungsunternehmen
- 2.2. Die Geschichte der kommunalen Wasserversorgung
- 2.3. Exkurs: Der kommunale Querverbund
- 2.4. Das dezentrale Organisationsprinzip und die Rolle der Kommunen in der Trinkwasserversorgung
- 2.4.1. Das dezentrale Organisationsprinzip
- 2.4.2. Kommunale Entscheidungshoheit und die zentrale Stellung der Kommunen in der Trinkwasserversorgung
- 2.5. Die Theorie natürlicher Monopole und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
- 2.6. Räumliche und sektorale Struktur der Trinkwasserversorgung in Deutschland
- 2.6.1. Räumliche Struktur der Trinkwasserversorgung in Deutschland
- 2.6.2. Sektorale Struktur der Trinkwasserversorgung in Deutschland
- 3. Veränderungen der Rahmenbedingungen: Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik
- 3.1. Neoliberale Konzepte der Privatisierung, Liberalisierung und Deregulierung
- 3.1.1. Diskreditierung öffentlicher Unternehmen
- 3.2. Finanzkrise und kommunale Kostenorientierung
- 3.3. Privatisierungsformen und Modelle
- 3.3.1. Privatisierungsformen
- 3.3.2. Teilprivatisierung in der Trinkwasserversorgung
- 3.3.3. Privatisierungsmodelle: Das Betriebsführungs-, Betreiber- und Kooperationsmodell
- 3.4. Wettbewerb in der Trinkwasserversorgung
- 3.4.1. Wettbewerbsformen
- 3.5. Modernisierungsoffensive in der deutschen Trinkwasserversorgung
- 4. Veränderung in der Betriebsstruktur: Energie- und Wasserkonzerne in der Trinkwasserversorgung
- 4.1. Entwicklung privater Energie- und Wasserkonzerne
- 4.2. Strategien und Unternehmensziele
- 4.2.1. Strategien der Energiekonzerne
- 4.2.2. Strategien der Wasserkonzerne
- 5. Die Methodik der empirischen Auswertung
- 5.1. Die Problematik der Datengewinnung
- 5.2. Der Prozess der Datengewinnung
- 5.3. Die Methodik der Auswertung
- 5.3.1. Auswertung der Konzernaktivitäten: Konzernstrategien
- 5.3.2. Raumbezogene Auswertung: Verbreitungsgrad
- 5.3.3. Einflussmöglichkeiten der Kommune: Einflussgrad
- 6. Analyse der Beteiligungen von Energie- und Wasserkonzernen an kommunalen Versorgungsunternehmen
- 6.1. Analyse der Konzernaktivitäten und Konzentrationsprozesse im Trinkwassersektor
- 6.1.1. Konzernanteile an der Grundgesamtheit der Versorgungsunternehmen
- 6.1.2. Beteiligungen nach Unternehmenstypen
- 6.1.3. Größenvorteile durch strategische Beteiligungspartner
- 6.1.4. Exkurs: Die Unternehmensnetzwerke THÜGA und RHENAG
- 6.1.5. (Wasser-) Dienstleistungsunternehmen in der Konzernstruktur
- 6.1.6. Konzentration von Konzernbeteiligungen im Trinkwassersektor
- 6.2. Raumbezogene Analyse der Beteiligungen
- 6.2.1. Beteiligungen nach Bundesländern
- 6.2.2. Räumliche Schwerpunkte von Konzernbeteiligungen
- 6.2.3. Konzernbeteiligungen nach Gemeindegrößenklassen
- 6.3. Analyse der Einflussmöglichkeiten der Konzerne
- 6.3.1. Rechtsformen der WVU
- 6.3.2. Beteiligungsanteile der Konzerne an WVU
- 7. Bewertung der Beteiligungen von Energie- und Wasserkonzernen an kommunalen Versorgungsunternehmen
- 7.1. Bewertung der Konzernaktivitäten und -Strategien in der Trinkwasserversorgung
- 7.1.1. Zusammenfassung und Bewertung der Konzernstrategien
- 7.1.2. Bewertung von Beteiligungs- und Dienstleistungswettbewerb in der Trinkwasserversorgung
- 7.1.3. Wettbewerb und Effizienz
- 7.2. Bewertung der räumlichen und strukturellen Verteilung von Konzernbeteiligungen (Verbreitungsgrad)
- 7.3. Auswirkungen der Konzernbeteiligungen auf Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen (Einflussgrad)
- 7.3.1. Einfluss von Organisationsprivatisierungen auf die Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen
- 7.3.2. Bewertung der Anteilsverkäufe an kommunalen WVU
- 7.3.3. Demokratische Kontrolle in gemischtwirtschaftlichen Unternehmen
- 7.3.4. Auswirkungen der Aufgabenausgliederungen
- 8. Zusammenfassung
- 8.1. Zusammenfassende Bewertung von Teilprivatisierungen
- 8.2. Bewertung der Modernisierungsstrategie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit analysiert die Teilprivatisierung in der deutschen Trinkwasserversorgung. Die Arbeit untersucht, wie sich die Beteiligung privater Energie- und Wasserkonzerne an kommunalen Versorgungsunternehmen auf die Organisation, die Struktur und die Steuerung der Trinkwasserversorgung auswirkt.
- Entwicklung und Auswirkungen der Teilprivatisierung in der Trinkwasserversorgung
- Strategien und Einfluss von Energie- und Wasserkonzernen im Trinkwassersektor
- Räumliche und strukturelle Verteilung von Konzernbeteiligungen
- Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen im Kontext von Konzernbeteiligungen
- Bewertung der Auswirkungen von Teilprivatisierung auf Wettbewerb, Effizienz und demokratische Kontrolle
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Teilprivatisierung in der deutschen Trinkwasserversorgung ein und definiert die Zielsetzung und Fragestellung der Arbeit. Es werden die wichtigsten Themengebiete und den Aufbau der Arbeit skizziert.
Kapitel 2 beleuchtet die ordnungspolitische Struktur der Trinkwasserversorgung in Deutschland, einschließlich der Definition von Trinkwasserversorgung und klassischen Wasserversorgungsunternehmen, der Geschichte der kommunalen Wasserversorgung, dem dezentralen Organisationsprinzip und der Rolle der Kommunen, sowie der Theorie natürlicher Monopole und dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Es analysiert die räumliche und sektorale Struktur der Trinkwasserversorgung in Deutschland.
Kapitel 3 untersucht die Veränderungen der Rahmenbedingungen, die den Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik und die verstärkte Privatisierung der Trinkwasserversorgung vorangetrieben haben. Es befasst sich mit neoliberalen Konzepten der Privatisierung, Liberalisierung und Deregulierung, der Finanzkrise und kommunalen Kostenorientierung, verschiedenen Privatisierungsformen und -modellen, sowie dem Wettbewerb in der Trinkwasserversorgung.
Kapitel 4 analysiert die Entwicklung privater Energie- und Wasserkonzerne in der Trinkwasserversorgung, ihre Strategien und Unternehmensziele. Es beleuchtet die zunehmenden Aktivitäten von Energiekonzernen im Trinkwassersektor und die damit verbundenen Chancen und Risiken.
Kapitel 5 beschreibt die Methodik der empirischen Auswertung, die für die Analyse der Beteiligungen von Energie- und Wasserkonzernen an kommunalen Versorgungsunternehmen verwendet wird. Es erläutert die Herausforderungen der Datengewinnung, den Prozess der Datengewinnung und die verschiedenen Auswertungsmethoden.
Kapitel 6 analysiert die Beteiligungen von Energie- und Wasserkonzernen an kommunalen Versorgungsunternehmen. Es untersucht die Konzernanteile an der Grundgesamtheit der Versorgungsunternehmen, die Beteiligungen nach Unternehmenstypen, die Größenvorteile durch strategische Beteiligungspartner, sowie die räumliche und strukturelle Verteilung der Beteiligungen. Es analysiert die Einflussmöglichkeiten der Konzerne auf die Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen.
Schlüsselwörter
Teilprivatisierung, Trinkwasserversorgung, Energiekonzerne, Wasserkonzerne, kommunale Versorgungsunternehmen, Konzernbeteiligungen, Wettbewerb, Effizienz, demokratische Kontrolle, Steuerungsmöglichkeiten, räumliche Struktur, sektorale Struktur, Finanzkrise, Liberalisierung, Deregulierung, Wertschöpfungskette, natürliche Monopole, Organisationsstruktur, Modernisierung, Methodik der Datengewinnung.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Trinkwasserversorgung oft als "natürliches Monopol"?
Aufgrund der hohen Infrastrukturkosten für Rohrnetze ist es ökonomisch nicht sinnvoll, parallele Netze aufzubauen, was zu einer monopolartigen Stellung des Anbieters in einer Region führt.
Welche Folgen hat die Teilprivatisierung für die Kommunen?
Teilprivatisierungen können zu einem Verlust an demokratischer Kontrolle und Steuerungsmöglichkeiten führen, da private Konzerne oft primär gewinnorientiert agieren.
Welche Strategien verfolgen Energie- und Wasserkonzerne?
Konzerne wie RWE oder E.on streben oft nach Synergieeffekten im "Querverbund" (Strom, Gas, Wasser) und beteiligen sich strategisch an kommunalen Unternehmen, um Marktanteile zu sichern.
Was ist die Modernisierungsstrategie des Bundestages von 2002?
Der Bundestag sprach sich gegen eine vollständige Liberalisierung und für den Erhalt der Wasserversorgung als kommunale Aufgabe aus, fördert jedoch kooperative, öffentlich-private Lösungen.
In welchen Regionen sind Konzernbeteiligungen besonders häufig?
Die Arbeit analysiert, ob Beteiligungen selektiv in bestimmten Bundesländern oder bei spezifischen Gemeindegrößenklassen (z.B. größere Städte) verstärkt auftreten.
- Citar trabajo
- Joerg Musiolik (Autor), 2004, Teilprivatisierung in der deutschen Trinkwasserversorgung: Analyse der Beteiligung von privaten Energie- und Wasserkonzernen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38385