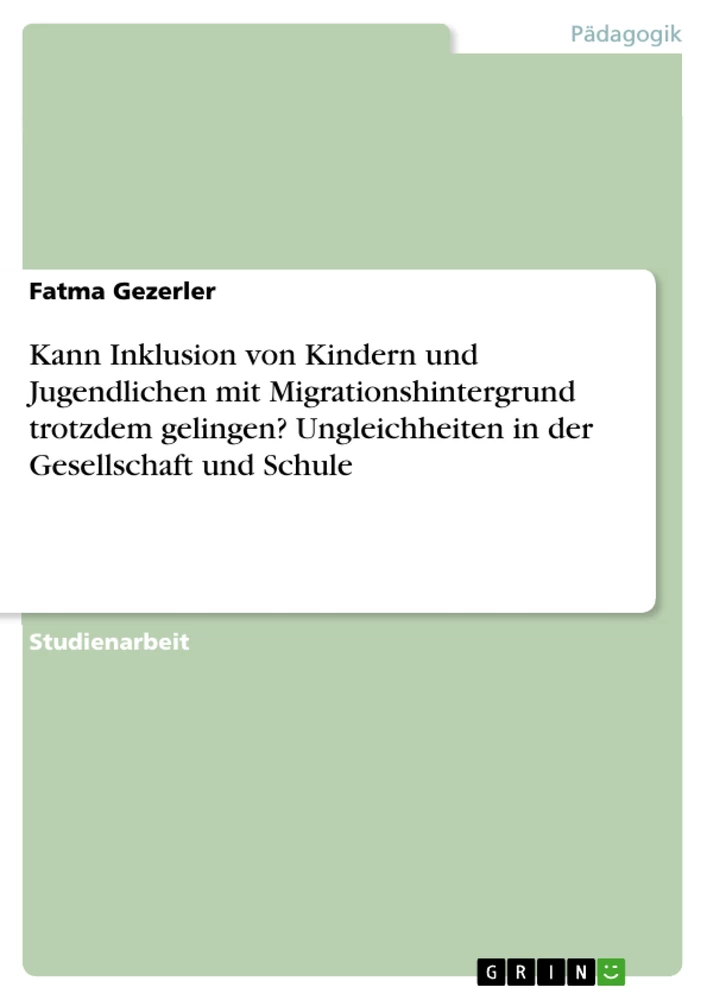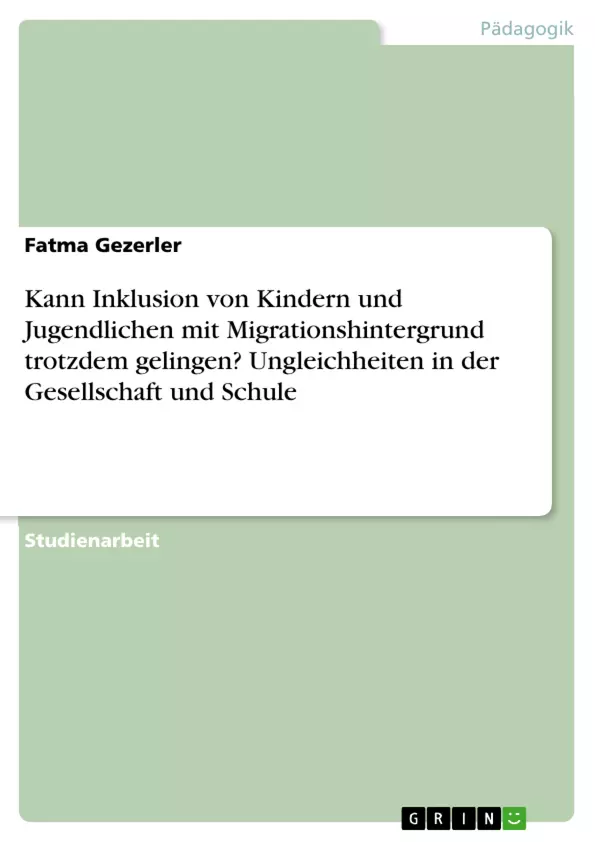Deutschland ist ein Einwanderungsland. Kulturelle Vielfalt ist ein Hauptbestandteil unserer Gesellschaft geworden. Diese Vielfalt wird durch Personen herbeigeführt, die einen Migrationshintergrund haben und den Alltag, so wie das wissenschaftliche, intellektuelle und künstlerische Leben mitprägen. Kinder und Jugendliche, die aus Familien stammen, in denen mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist, sind sogenannte Kinder mit Migrationshintergrund. Auch ich stamme aus solch einer Familie. Ich bin zwar in Deutschland geboren, habe aber bis zu meinem vierten Lebensjahr in der Türkei gelebt. Mein Vater ist in Deutschland geboren und spricht sehr gut Deutsch, hat es aber nicht geschafft seine Schulausbildung abzuschließen. Meine Mutter dagegen ist erst mit 21 Jahren nach Deutschland ausgewandert und hat immer noch große Defizite in ihren Deutschkenntnissen. Deshalb finde ich es besonders interessant mich mit allen Themen bezüglich Migration zu beschäftigen. Durch die eigene Betroffenheit, ist es mir in diesem Bereich immer möglich aus Erfahrung zu sprechen. Dadurch habe ich das Gefühl, anderen bereichern zu können.
Eines meiner Praktika habe ich an einer Grundschule mit hohem Anteil an Kinder mit Migrationshintergrund gemacht. In der ersten Klasse war ein türkischstämmiges Mädchen, das während der Wochenplanarbeit immer wieder um Hilfe gebeten hat. In der Aufgabe ging es darum, aus einem „Buchstabensalat“ Wörter zu bilden. Nachdem sie viele der Wörter nicht bilden konnte, hat ihr mehrmals ihre deutsche Banknachbarin geholfen. Sie bearbeitete auch die gleiche Aufgabe, im Gegensatz zu der türkischstämmigen Schülerin hatte sie keine Probleme damit. Anschließend wendete sich die Schülerin mit Migrationshintergrund verzweifelt mir zu und behauptete: „Ich kann das nicht, weil ich bin Türke. Sie kann es, weil sie deutsch ist.“ Ich finde, dass man an der Aussage merkt, dass sich diese Schülerin als „anders“ und sogar als benachteiligt empfunden hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Persönlicher Zugang zum Thema
- Besuch der Lessingschule in Ingolstadt
- Ungleichheiten in Gesellschaft und Schule
- Das Scheitern des deutschen Bildungssystems
- Gesellschaftliche Entwicklung als Herausforderung für die Pädagogik
- Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte im deutschen Bildungssystem
- Klärung des Inklusionsbegriffs
- Von der Integration zur Inklusion
- Migration als Teil der Inklusion
- Kann Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund trotzdem gelingen?
- Ausgewählte Forschungsmethoden
- Entwicklung des Schülers J.
- Beobachtung von J.
- Interview mit der Lehrkraft
- Die Interviews
- I. und ihre Mutter
- Kind N. und ihr Vater
- Jugendliche E.
- Vergleich zwischen den Schülern
- Persönliches Résumé
- Inklusives interkulturelles Lernen
- Interkulturelles Lernen- eine begriffliche Annährung
- Auseinandersetzung mit der Fremdheit
- Heterogenität
- Unterricht, Unterrichtsgestaltung und Didaktik
- Wie es gelingen kann- Am Beispiel der Grundschule Berg Fidel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem. Sie analysiert die Ursachen für Ungleichheiten in der Gesellschaft und in der Schule und hinterfragt die Möglichkeiten einer gelingenden Inklusion im Kontext von interkulturellem Lernen.
- Ungleichheiten in der Gesellschaft und im deutschen Bildungssystem
- Inklusion als pädagogisches Konzept und seine Implikationen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Herausforderungen und Chancen interkulturellen Lernens im Kontext von Inklusion
- Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Förderung der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Analyse von Praxisbeispielen und Forschungsbefunden
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Themas Migration und Inklusion im Kontext der deutschen Gesellschaft und stellt einen persönlichen Bezug zum Thema her. Der Besuch der Lessingschule in Ingolstadt dient als Ausgangspunkt für die Analyse der Herausforderungen, denen Schulen mit einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund gegenüberstehen.
- Ungleichheiten in Gesellschaft und Schule: Dieses Kapitel beleuchtet die Problematik des deutschen Bildungssystems und zeigt die Auswirkungen gesellschaftlicher Entwicklungen auf die Pädagogik. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen, denen Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem begegnen.
- Klärung des Inklusionsbegriffs: Der Inklusionsbegriff wird definiert und seine Bedeutung im Kontext von Integration und Migration erläutert. Das Kapitel verdeutlicht, wie Migration ein integraler Bestandteil des Inklusionskonzepts ist.
- Kann Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund trotzdem gelingen?: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Forschungsmethoden, die zur Analyse der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund eingesetzt werden können. Es werden Fallbeispiele und Interviews vorgestellt, die Einblicke in die Lebenswelt und die Erfahrungen dieser Schüler geben.
- Inklusives interkulturelles Lernen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept des interkulturellen Lernens und seinen Bedeutung im Kontext von Inklusion. Es werden wichtige Aspekte wie die Auseinandersetzung mit der Fremdheit, die Heterogenität und die Bedeutung von Unterrichtsgestaltung und Didaktik in der inklusiven Schule behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Inklusion, Migration, Bildung, Interkulturelles Lernen, Heterogenität, Unterrichtsgestaltung, und Ungleichheiten. Es werden verschiedene Forschungsmethoden, Praxisbeispiele und Fallstudien beleuchtet, um ein umfassendes Bild der Herausforderungen und Chancen der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem zu zeichnen.
- Citar trabajo
- Fatma Gezerler (Autor), 2015, Kann Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund trotzdem gelingen? Ungleichheiten in der Gesellschaft und Schule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385147