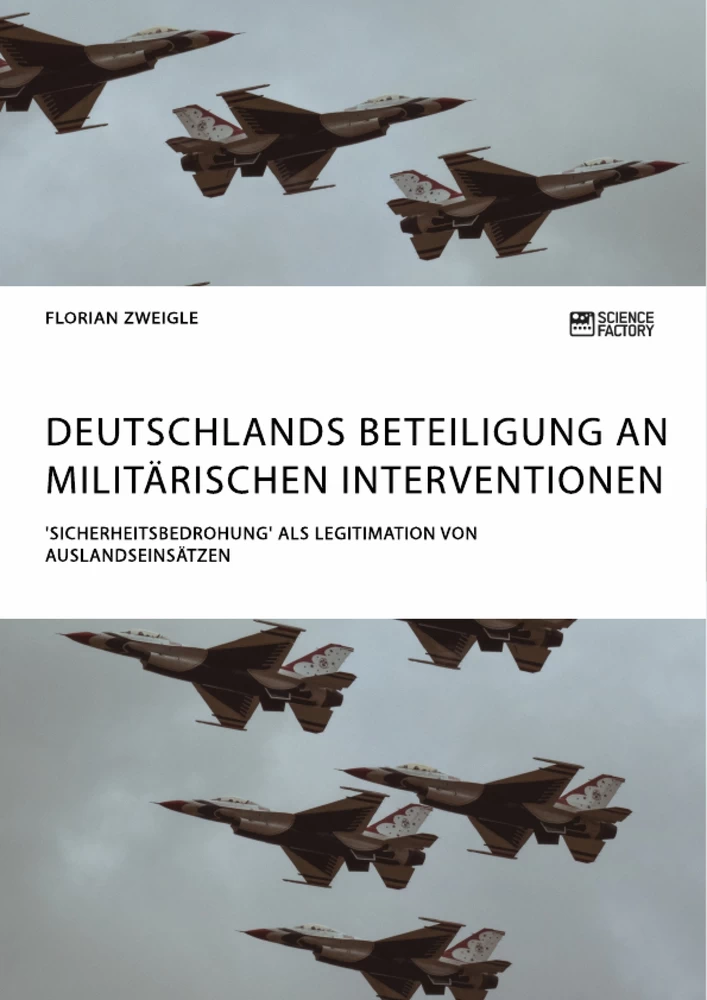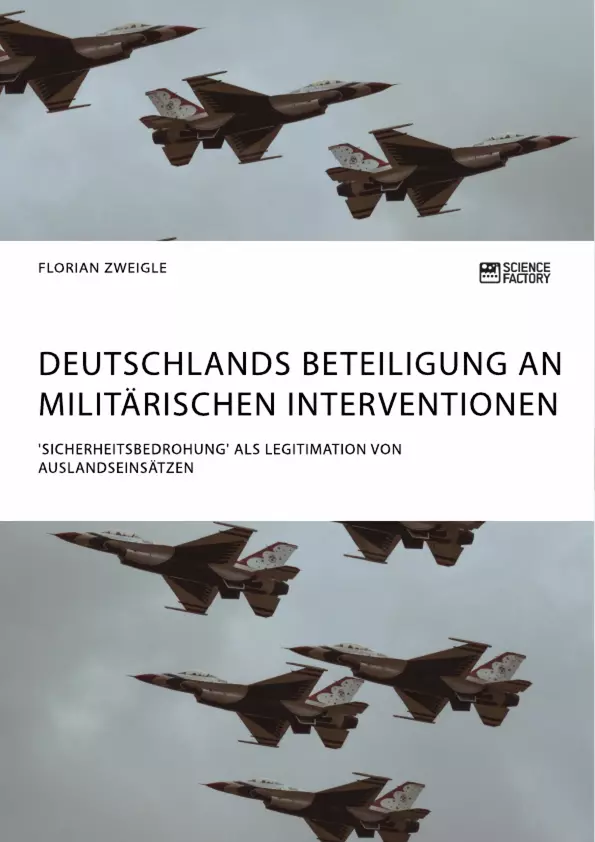Entscheidungen über Einsätze der Bundeswehr im Ausland verlangen eine intensive politische und gesellschaftliche Debatte. Gerade vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands braucht es bei der Diskussion um Auslandseinsätze eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Verhältnismäßigkeit solcher Einsätze. Ebenso muss eine Gesellschaft die gesetzten gesetzlichen Schranken analysieren.
Florian Zweigle untersucht, welche Stelle der sich wandelnde Begriff der Sicherheit in dieser Debatte einnimmt. Der Autor geht in seiner Publikation der Frage nach, warum sich die Bundesregierung für einen Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, aber gegen eine Entsendung nach Libyen entschied.
Aus dem Inhalt:
- Bundeswehr;
- Auslandseinsätze;
- Sicherheit;
- Afghanistan;
- Libyen
Inhaltsverzeichnis
- Abstract/Zusammenfassung
- 1 Einleitung
- 2 Fragestellung/Forschungsinteresse/Relevanz
- 3 Konzeptualisierung
- 3.1 Theorie der Securitization und Konzept „Sicherheit“
- 3.2 Strategic Culture
- 3.3 Öffentliche Meinung
- 3.4 Militärische Intervention/Notfallmaßnahmen/Souveränität
- 4 Operationalisierung
- 5 Forschungsstand
- 6 Zwischenfazit I
- 7 Exkurs: Historischer Überblick
- 8 Fallbeispiel Afghanistan
- 8.1 Referent Object und Securitizing Actor
- 8.2 Politische Ebene
- 8.3 Gesellschaftliche Ebene
- 8.4 Zwischenfazit II
- 9 Fallbeispiel Libyen
- 9.1 Referent Object und Securitizing Actor
- 9.2 Politische Ebene
- 9.3 Gesellschaftliche Ebene
- 9.4 Zwischenfazit III
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die deutsche Beteiligung an militärischen Interventionen im Kontext der „Sicherheitsbedrohung“ als Legitimationsgrund für Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ziel ist es, die Faktoren zu analysieren, die zu unterschiedlichen Entscheidungen in Bezug auf deutsche militärische Interventionen führen. Die Analyse erfolgt anhand der Theorie der Securitization, die die Konstruktion von Sicherheitsbedrohungen durch Sprechakte beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle der öffentlichen Meinung bei der Anerkennung oder Ablehnung einer solchen Sicherheitsbedrohung.
- Strategic Culture der Bundesrepublik Deutschland
- Theorie der Securitization
- Öffentliche Meinung und Sicherheitsbedrohungen
- Analyse von Fallbeispielen (Afghanistan, Libyen)
- Politische und gesellschaftliche Ebene der Securitization
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema und die Fragestellung der Arbeit vor. Kapitel 2 beleuchtet die Relevanz des Forschungsinteresses und führt den Leser in die Thematik ein. Kapitel 3 konzeptualisiert die wichtigsten theoretischen Definitionen und Ideen, die für die Analyse der deutschen Sicherheitspolitik relevant sind. Kapitel 4 beschreibt die Operationalisierung der gewählten Forschungsansätze. Kapitel 5 liefert einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand. Kapitel 6 bietet ein Zwischenfazit zum ersten Teil der Arbeit. Kapitel 7 liefert einen historischen Überblick über deutsche Auslandseinsätze. Kapitel 8 analysiert das Fallbeispiel Afghanistan und untersucht die politischen und gesellschaftlichen Faktoren, die zur Anerkennung oder Ablehnung der Sicherheitsbedrohung führten. Kapitel 9 wiederholt diesen Prozess mit dem Fallbeispiel Libyen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Securitization, Strategic Culture, öffentliche Meinung, militärische Interventionen, Sicherheitsbedrohungen, Deutschland, Afghanistan, Libyen, Auslandseinsätze, Bundeswehr, politische Ebene, gesellschaftliche Ebene.
- Citation du texte
- Florian Zweigle (Auteur), 2018, Deutschlands Beteiligung an militärischen Interventionen. 'Sicherheitsbedrohung' als Legitimation von Auslandseinsätzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385756