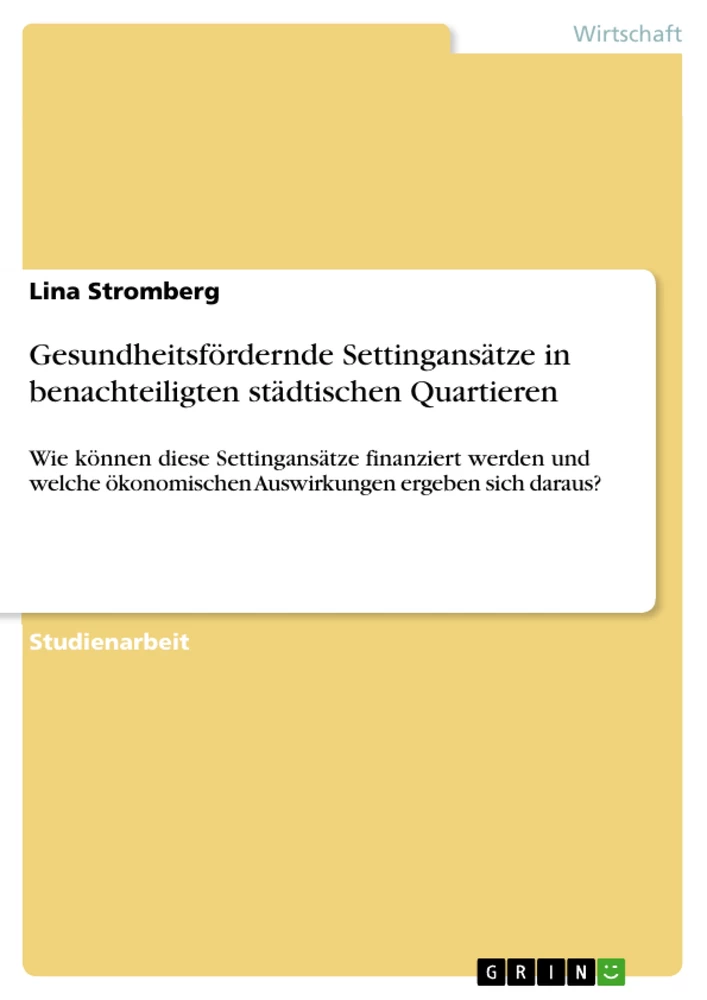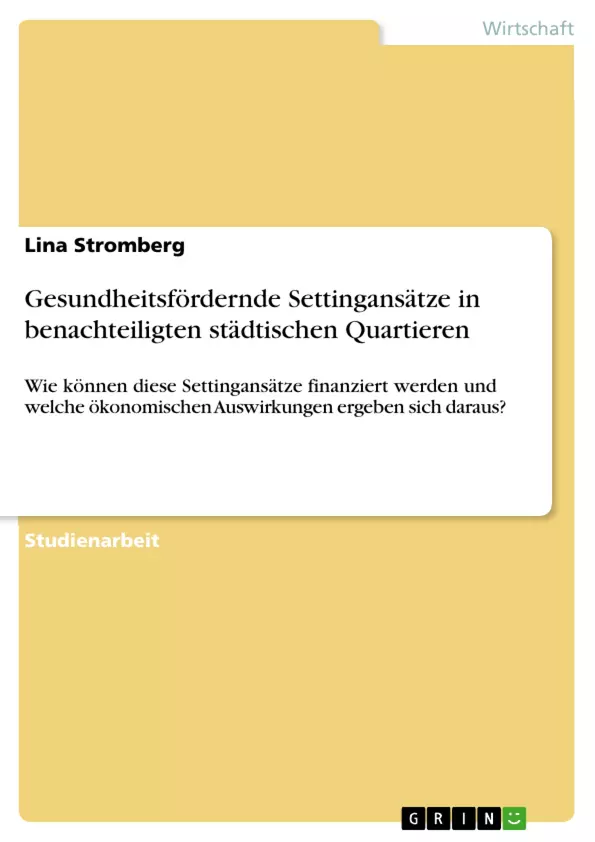Ziel dieser Arbeit ist es einen Überblick über gesundheitsfördernde Settingansätze in benachteiligten städtischen Quartieren zu geben und eine Antwort auf die Frage zu finden, wie solche Settingansätze finanziert werden und welche ökonomischen Auswirkungen sich daraus ergeben können. Dazu werden wir zunächst die Begrifflichkeit des Settings erläutern. Anknüpfend daran zeigen wir auf, welche Überlegungen und Ideen dem Konzept des Settingansatzes zugrunde liegen und warum dieser Ansatz gerade in benachteiligten städtischen Quartieren bedeutsam ist.
Im nächsten Abschnitt wird darauf eingegangen, wie Gesundheitsförderung im Setting benachteiligter städtischer Quartiere konkret aussieht, d.h. welche Maßnahmen entwickelt wurden, um die Gesundheit der dort lebenden Bevölkerung zu stärken. Daran schließt sich eine Darstellung der ökonomischen Aspekte von Gesundheitsförderung an, welche die allgemeinen Gesundheitsausgaben, die Ausgaben für Prävention/Gesundheitsschutz, die Ausgaben für Gesundheitsförderung und die jeweils dazugehörigen Kostenträger näher illustriert.
Damit einhergehend erfolgt eine Betrachtung der positiven ökonomischen Auswirkungen, die von gesundheitsfördernden Settingansätze ausgehen können. Im darauffolgenden Kapitel möchten wir näher erläutern, wie diese gesundheitsfördernden Maßnahmen finanziert werden bzw. welche Möglichkeiten es zur Finanzierung gibt. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst, und zwar unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Aspekts. Hierbei wird also abgewogen, inwieweit sich dieses Konzept wirtschaftlich lohnt, d.h. ob und inwieweit der Nutzen dieses gesundheitsfördernden Settingansatzes größer ist als die Kosten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung und Vorstellung des Settingansatzes
- Gesundheitsfördernde Quartiere
- Ökonomische Aspekte der Gesundheitsförderung
- Ökonomische Auswirkungen der gesundheitsfördernden Settingansätze
- Formen der Finanzierungsmöglichkeiten
- Bund-Länder Programm „Soziale Stadt“
- Verfügungsfonds
- Gesetzliche Krankenkassen
- Stiftungen
- Fundraising
- Bußgeld
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beleuchtet gesundheitsfördernde Settingansätze in benachteiligten städtischen Quartieren und befasst sich mit ihrer Finanzierung sowie den ökonomischen Auswirkungen. Das Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über dieses Konzept zu bieten.
- Das Konzept des Settingansatzes und seine Bedeutung im Kontext von Gesundheitsförderung
- Spezifische Herausforderungen und Chancen in benachteiligten städtischen Quartieren
- Konkrete Maßnahmen zur Gesundheitsförderung in solchen Settings
- Ökonomische Aspekte von Gesundheitsförderung und ihre Auswirkungen
- Finanzierungsmöglichkeiten für gesundheitsfördernde Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt das Konzept des Settingansatzes ein und erläutert seine Bedeutung im Kontext von Gesundheitsförderung, insbesondere in benachteiligten städtischen Quartieren. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Finanzierung und die ökonomischen Auswirkungen von gesundheitsfördernden Settingansätzen in diesen Quartieren zu beleuchten.
Begriffsklärung und Vorstellung des Settingansatzes
Dieser Abschnitt definiert den Begriff "Setting" und untersucht die spezifischen Charakteristiken von benachteiligten städtischen Quartieren. Er beleuchtet, warum Gesundheitsförderung in diesen Quartieren von besonderer Bedeutung ist, und stellt das Gesundheitsdeterminanten-Modell nach Dahlgren und Whitehead vor.
Gesundheitsfördernde Quartiere
Dieser Abschnitt betrachtet konkrete Maßnahmen zur Gesundheitsförderung in benachteiligten städtischen Quartieren, die auf die Verbesserung der Lebensbedingungen und die Förderung der Gesundheit der dort lebenden Menschen abzielen.
Schlüsselwörter
Schlüsselbegriffe des Textes sind: Settingansatz, Gesundheitsförderung, benachteiligte städtische Quartiere, ökonomische Aspekte, Finanzierung, Gesundheitsdeterminanten, Ottawa-Charta, Empowerment, Lebenswelten, Chancengleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem gesundheitsfördernden Settingansatz?
Ein Settingansatz zielt darauf ab, gesundheitsfördernde Maßnahmen direkt in den Lebenswelten der Menschen (z.B. Stadtquartier, Schule, Betrieb) zu verankern.
Warum sind benachteiligte städtische Quartiere ein Fokus der Gesundheitsförderung?
In diesen Quartieren sind Gesundheitsrisiken oft höher und die Ressourcen geringer. Der Ansatz soll zur Chancengleichheit beitragen und das Empowerment der Bewohner stärken.
Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es für solche Projekte?
Finanzierungsmöglichkeiten bieten das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“, gesetzliche Krankenkassen, Stiftungen, Verfügungsfonds oder Fundraising.
Lohnt sich Gesundheitsförderung aus ökonomischer Sicht?
Ja, die Arbeit untersucht den Kosten-Nutzen-Aspekt und zeigt auf, dass Prävention langfristig Gesundheitsausgaben senken und die Lebensqualität steigern kann.
Was ist das Gesundheitsdeterminanten-Modell?
Es handelt sich um ein Modell von Dahlgren und Whitehead, das aufzeigt, wie soziale, wirtschaftliche und ökologische Faktoren die Gesundheit des Einzelnen beeinflussen.
- Citar trabajo
- Lina Stromberg (Autor), 2016, Gesundheitsfördernde Settingansätze in benachteiligten städtischen Quartieren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385944