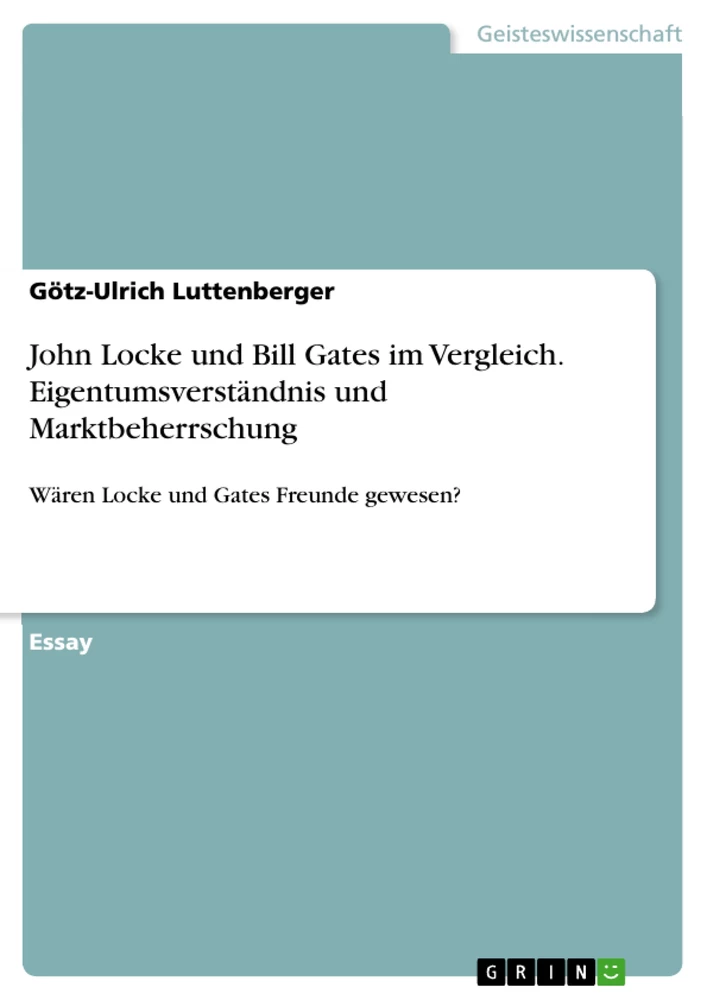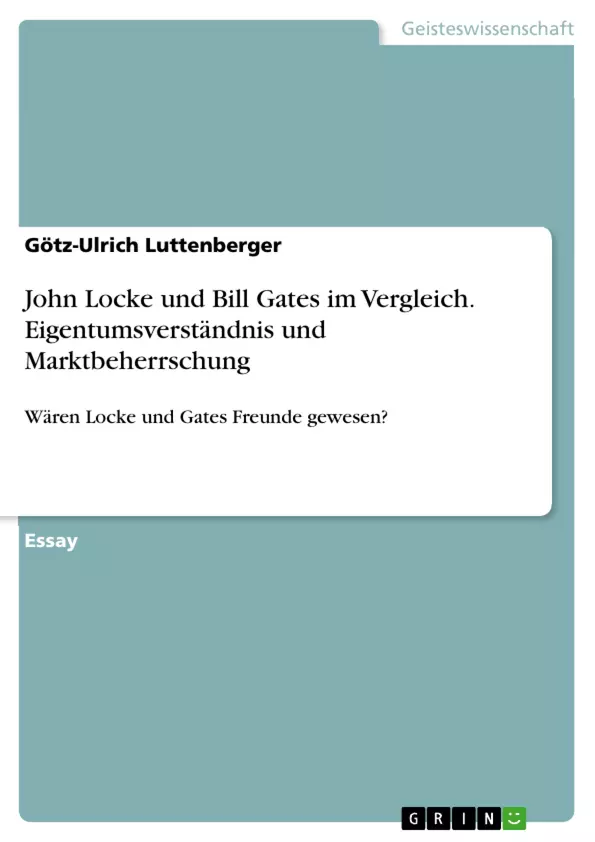Die Arbeit setzt sich mit John Lockes Abhandlung „Two Treatises of Government“ auseinander. Es geht darum, ob das locksche Eigentumsverständnis sich auch auf sogenanntes ,geistiges Eigentum‘ bezieht und falls ja, ob es sogar eine Monopolstellung oder wenigsten eine Marktbeherrschung des Eigentümers beziehungsweise Autors rechtfertigt.
Ausgangspunkt der Überlegungen Luttenbergers ist der Dauerstreit zwischen der EU-Kommission und Microsoft über den Vertrieb des InternetExplorers beziehungsweise von Edge zusammen mit dem Windows-Betriebssystem. Dazu überlegt der Autor, ob sich das locksche Eigentumsverständnis auch auf sogenanntes ,geistiges Eigentum‘ bezieht und falls ja, ob es sogar eine Monopolstellung von Urhebern und Autoren rechtfertigt.
Im Ergebnis wird dafür argumentiert, dass sich das Recht auf Privateigentum nach Locke nicht auf jegliches geistiges Eigentum erstreckt. Soweit es das andererseits aber tut, legitimiert es selbst ein Marktmonopol.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- John Lockes Eigentumsverständnis
- Ursprung des Eigentums
- Erwerb von Privateigentum durch Arbeit
- Grenzen des Erwerbs von Privateigentum
- Moderne Ausdehnung possessorischer Rechte auf sogenanntes „geistiges Eigentum“ – die Rolle Microsofts als Marktbeherrscher
- Geistiges Eigentum
- Marktbeherrschung – Missbrauch
- Sind „geistiges Eigentum“ und Marktbeherrschung mit John Lockes Eigentumstheorie legitimierbar?
- Begründung „geistigen Eigentums“ - Ergebnis schöpferischer Arbeit
- Schranken der Verwertung „geistigen Eigentums“
- Eigentumsschranke Monopol?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Legitimität der Marktbeherrschung von Microsoft im Licht von John Lockes Eigentumsverständnis. Sie analysiert, ob Lockes Theorie des Privateigentums auf das moderne Konzept des „geistigen Eigentums“ anwendbar ist und ob sie eine Monopolstellung rechtfertigt.
- John Lockes Eigentumstheorie
- Das Konzept des „geistigen Eigentums“
- Marktbeherrschung und ihre Legitimität
- Die Rolle von Microsoft als Marktbeherrscher
- Die Beziehung zwischen Eigentum und Freiheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit setzt sich mit dem Konflikt zwischen der Europäischen Kommission und Microsoft hinsichtlich des angeblichen „Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung“ auseinander. Sie argumentiert, dass Lockes Eigentumsverständnis einen Ausgangspunkt für die Untersuchung der Legitimität von Microsofts Geschäftspraktiken bietet.
2. John Lockes Eigentumsverständnis
Dieses Kapitel erläutert Lockes Eigentumsbegriff und seine Unterscheidung zwischen dem Eigentum an der eigenen Person und dem Eigentum an äußeren Dingen. Es wird die Rolle der Arbeit bei der Aneignung von Eigentum sowie die Grenzen des Eigentumserwerbs nach Locke beleuchtet.
3. Moderne Ausdehnung possessorischer Rechte auf sogenanntes „geistiges Eigentum“ - die Rolle Microsofts als Marktbeherrscher
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem modernen Begriff des „geistigen Eigentums“ und seiner rechtlichen Behandlung im Vergleich zu materiellen Gütern. Es wird die Position von Microsoft als Marktbeherrscher im Zusammenhang mit seinem Betriebssystem und Webbrowser untersucht.
4. Sind „geistiges Eigentum“ und Marktbeherrschung mit John Lockes Eigentumstheorie legitimierbar?
Dieses Kapitel analysiert, ob Lockes Eigentumstheorie auf „geistiges Eigentum“ anwendbar ist und ob sie eine Monopolstellung rechtfertigt. Es werden die Argumente für und gegen die Legitimität von Marktbeherrschung im Kontext des lockeschen Denkens betrachtet.
Schlüsselwörter
John Locke, Eigentum, geistiges Eigentum, Marktbeherrschung, Microsoft, Europäische Kommission, Anti-Trust-Gesetze, Freiheit, Naturzustand, Arbeit, Monopol.
Häufig gestellte Fragen
Wie begründet John Locke das Recht auf Eigentum?
Nach Locke entsteht Privateigentum durch die Vermischung der eigenen Arbeit mit den Gaben der Natur. Jeder Mensch hat zudem ein natürliches Eigentum an seiner eigenen Person.
Lässt sich Lockes Theorie auf "geistiges Eigentum" anwenden?
Die Arbeit untersucht, ob schöpferische Arbeit (wie Software-Entwicklung) nach Lockes Prinzipien die gleichen Rechte wie materielles Eigentum begründet. Das Ergebnis ist differenziert.
Rechtfertigt Lockes Eigentumsverständnis ein Marktmonopol?
Die Arbeit argumentiert, dass dort, wo das Recht auf geistiges Eigentum nach Locke greift, es konsequenterweise auch eine marktbeherrschende Stellung legitimieren kann.
Welche Rolle spielt Bill Gates in diesem Vergleich?
Bill Gates bzw. Microsoft dienen als Fallbeispiel für Marktbeherrschung. Es wird analysiert, ob die Geschäftspraktiken von Microsoft im Licht der lockschen Philosophie legitim sind.
Was war der aktuelle Anlass für diese Untersuchung?
Ausgangspunkt ist der langjährige Streit zwischen der EU-Kommission und Microsoft über den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung beim Vertrieb von Webbrowsern.
- Citation du texte
- Götz-Ulrich Luttenberger (Auteur), 2017, John Locke und Bill Gates im Vergleich. Eigentumsverständnis und Marktbeherrschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385984