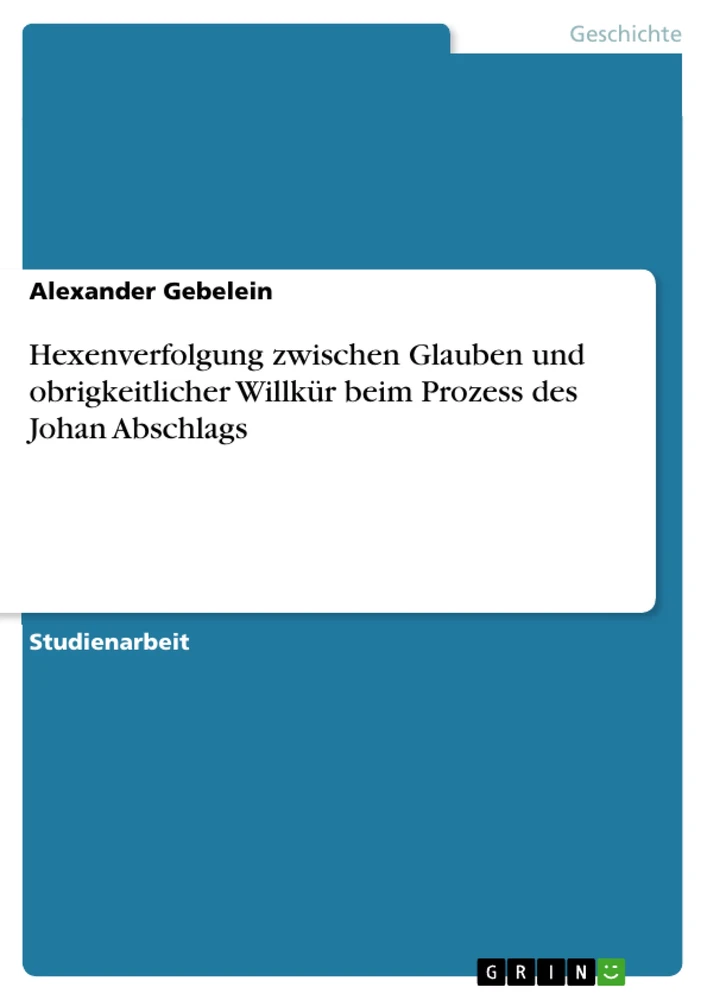Lemgo war im 16. Jahrhundert die bedeutendste Stadt der Grafschaft Lippe. Sie war bereits 1550 schon lutherisch und konnte diesen Glauben auch gegen seinen Landesherren durchsetzen. Neben der Freiheit im Glauben behauptete es sich auch seine städtische Autonomie gegenüber den Tendenzen des lippischen Territorialstaates. Ermöglicht werden konnte diese Entwicklung aufgrund der wirtschaftlichen Stärke Lemgos im ausgehenden 16. Jahrhundert. Jedoch begann genau diese Stärke im siebzehnten Jahrhundert unter den Wirren des Krieges und dem Bedeutungsverlust des städtischen Marktes zu straucheln. Lemgo verschuldete sich zunehmend und wies nach dem Krieg wachsende soziale, wirtschaftliche und politische Spannungen auf. Von den ursprünglich 1000 Häusern waren nach dem Krieg vielleicht noch die Hälfte intakt. Von den ursprünglich 4700 Einwohnern blieben nicht mal mehr als 1400 übrig.
Lemgo entpuppte sich als eine Kernzone der Hexenverfolgung. Mit allein noch über 200 erhaltenen Prozessakten ist es überaus wichtig für das Forschungsfeld. Das Thema „Hexen“ ist in den 90er Jahren aus seiner wissenschaftlichen Randexistenz herausgeholt worden und zu einem zentralen Feld der Geschichtswissenschaft aufgestiegen. Trotzdem wurde in den letzten Jahren Kritik laut, dass statt einem klaren Interpretationsmodell für die Hexenverfolgung viele widersprüchliche Erklärungsmuster nebeneinander existieren. Mit anderen Worten: Die Hexenforschung bietet viele interessante Fragen, aber kaum überzeugende Antworten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rechtssystem
- Der Rat
- Der Prozess
- Ansätze
- Obrigkeitliche Disziplinierung
- Sozialhistorische Perspektive
- Glaube
- Diskurs zum Obristleuteniant Johan Abschlag
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Fall von Johan Abschlag und untersucht dessen Prozessakten im Kontext der Hexenverfolgung in Lemgo im 17. Jahrhundert. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle der obrigkeitlichen Sozialdisziplinierung durch den Rat und den Bürgermeister und versucht, die komplexe Frage nach der Entstehung der Hexenverfolgung durch verschiedene Ansätze zu beleuchten.
- Die Hexenverfolgung als Ausdruck der politischen und sozialen Spannungen in Lemgo im 17. Jahrhundert.
- Die Rolle der Obrigkeit in der Disziplinierung und Kontrolle der Bevölkerung.
- Die Rolle des Glaubens und des Aberglaubens in der Entstehung von Hexenverfolgungen.
- Die geschlechtsspezifische Asymmetrie in der Hexenverfolgung und die Frage nach den Ursachen.
- Der Fall von Johan Abschlag als Beispiel für die Willkür und die Missbräuche des Rechtssystems.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt Lemgo als eine Kernzone der Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert vor und zeigt die spezifischen Herausforderungen der Stadt im Kontext von Krieg und sozialem Wandel auf. Sie diskutiert verschiedene Ansätze zur Interpretation der Hexenverfolgung und kritisiert die fehlende Klarheit in der bisherigen Forschung.
- Das Kapitel "Rechtssystem" beleuchtet die rechtliche Struktur in Lemgo und die Rolle des Rates und der Prozesse in der Verfolgung von "Hexen".
- Im Kapitel "Ansätze" werden verschiedene Perspektiven auf die Entstehung der Hexenverfolgung vorgestellt. Neben der obrigkeitlichen Disziplinierung und der sozialhistorischen Perspektive wird auch der Einfluss des Glaubens beleuchtet.
- Das Kapitel "Diskurs zum Obristleuteniant Johan Abschlag" untersucht den Fall von Johan Abschlag und die Rolle der Obrigkeit in dessen Verfolgung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Hexenverfolgung, Lemgo, Obrigkeit, Sozialdisziplinierung, Glaube, Rechtssystem, Geschlechterverhältnis, Johan Abschlag, 17. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Warum war Lemgo ein Zentrum der Hexenverfolgung?
Lemgo wies im 17. Jahrhundert starke soziale, wirtschaftliche und politische Spannungen auf, die durch den Dreißigjährigen Krieg und den wirtschaftlichen Niedergang verschärft wurden.
Wer war Johan Abschlag?
Johan Abschlag war ein Obristleutnant, dessen Prozess als Beispiel für obrigkeitliche Willkür und die Instrumentalisierung von Hexenprozessen untersucht wird.
Welche Rolle spielte der Rat der Stadt Lemgo?
Der Rat und der Bürgermeister nutzten Hexenprozesse oft als Mittel der Sozialdisziplinierung und zur Festigung ihrer Macht gegenüber der Bevölkerung.
Welche Erklärungsmodelle für Hexenverfolgung werden diskutiert?
Diskutiert werden die obrigkeitliche Disziplinierung, sozialhistorische Ursachen (Krisenbewältigung) sowie religiöser Eifer und Aberglaube.
Wie viele Prozessakten sind aus Lemgo erhalten?
Es sind noch über 200 Prozessakten erhalten, was Lemgo zu einem bedeutenden Forschungsort für die Hexenforschung macht.
- Citation du texte
- Alexander Gebelein (Auteur), 2017, Hexenverfolgung zwischen Glauben und obrigkeitlicher Willkür beim Prozess des Johan Abschlags, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386987