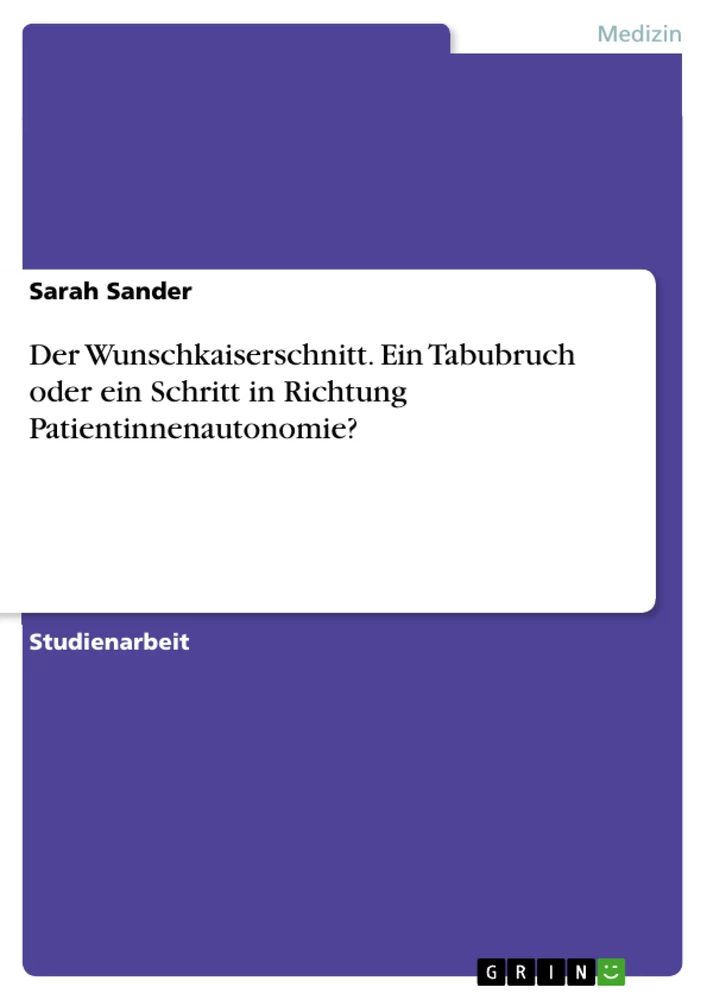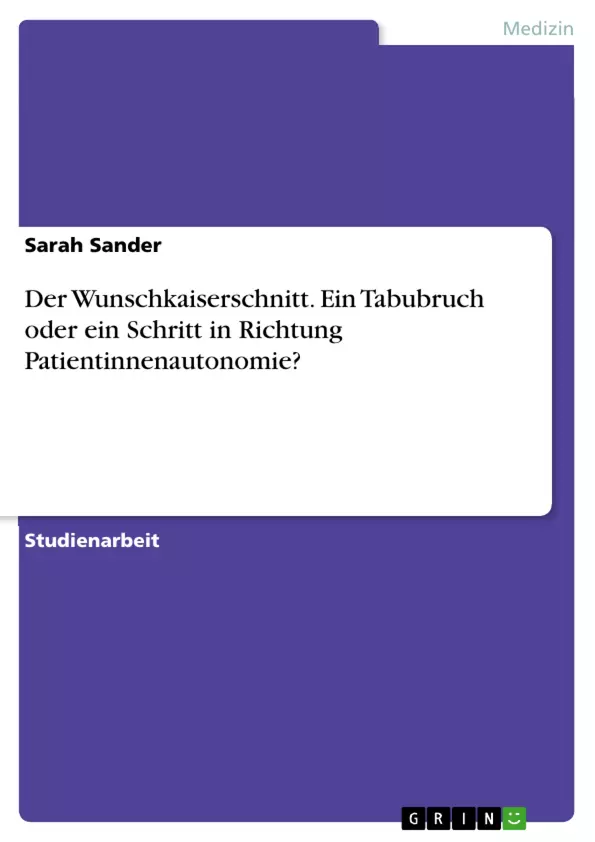Jeder dritte Säugling in Deutschland erblickt das Licht der Welt per Kaiserschnitt. Das waren im Jahr 2015 insgesamt 222919 Kinder – 1991 waren es gerade einmal halb so viele Neugeborene, die mittels Sectio geboren wurden (Statistisches Bundesamt 2017). Dabei erfolgen „[h]öchstens 10% aller Kaiserschnitte […] aus zwingend geburtsmedizinischen Gründen, um Leben und Gesundheit von Frau und/oder Kind zu retten.“ (Baumgärtner & Schach 2010) Der Kaiserschnitt zählt „zu den häufigsten Eingriffen in der Humanmedizin und ist zu einer „Routineoperation“ mit sehr geringer Morbidität und Mortalität geworden.“ (Schuller & Surbek 2014) Nichtsdestotrotz wird immer wieder drauf hingewiesen, dass eine natürliche Geburt einem Kaiserschnitt hinsichtlich des Geburtserlebnisses um Längen voraus ist (Husslein & Langer 2000). Aus welchen Gründen entscheiden sich dennoch immer mehr Gebärende für einen Kaiserschnitt auf Wunsch?
In den folgenden Kapiteln werden die Vorteile und Risiken beider Entbindungsmöglichkeiten genannt. Daraufhin stehen die Beweggründe der Frauen, die sich für einen Kaiserschnitt entscheiden, im Vordergrund. Anschließend widmet sich ein Kapitel den Grundsätzen der PatientInnenautonomie, um am Schluss mit den gewonnenen Resultaten die ethische Frage dieser Arbeit diskutieren zu können:
Stellt der Wunschkaiserschnitt einen Tabubruch dar oder kann er als ein Schritt in Richtung Patientinnenautonomie anerkannt werden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorteile und Risiken der unterschiedlichen Entbindungsarten - vaginale Geburt und geplanter Kaiserschnitt
- Vorteile einer vaginalen Geburt
- Risiken einer vaginalen Geburt
- Vorteile eines geplanten Kaiserschnitts
- Risiken eines geplanten Kaiserschnitts
- Beweggründe der Frauen für den Wunsch nach einem Kaiserschnitt
- PatientInnenautonomie
- Diskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ethische Frage des Wunschkaiserschnitts. Sie beleuchtet die Vor- und Nachteile vaginaler Geburten und geplanter Kaiserschnitte, analysiert die Motive von Frauen, die sich für einen Kaiserschnitt entscheiden, und diskutiert den Wunschkaiserschnitt im Kontext der PatientInnenautonomie.
- Vor- und Nachteile vaginaler Geburten und Kaiserschnitte
- Motive von Frauen für einen Wunschkaiserschnitt
- PatientInnenautonomie im Kontext der Geburtsentscheidung
- Ethische Implikationen des Wunschkaiserschnitts
- Entwicklung und gesellschaftliche Wahrnehmung des Kaiserschnitts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert die steigende Kaiserschnittrate in Deutschland und stellt die zentrale Forschungsfrage: Stellt der Wunschkaiserschnitt einen Tabubruch dar oder einen Schritt in Richtung PatientInnenautonomie? Sie verdeutlicht den Wandel des Kaiserschnitts von einem Notfalleingriff zu einem zunehmend gewählten Geburtsmodus und hebt die gesellschaftliche Kontroverse um den Wunschkaiserschnitt hervor. Die Einleitung skizziert die Struktur der Arbeit und die behandelten Themen.
Vorteile und Risiken der unterschiedlichen Entbindungsarten - vaginale Geburt und geplanter Kaiserschnitt: Dieses Kapitel vergleicht die Vor- und Nachteile von vaginaler Geburt und geplantem Kaiserschnitt. Es beleuchtet die physiologischen Vorteile der natürlichen Geburt, aber auch die Risiken wie Beckenbodenschäden oder Komplikationen während der Geburt. Gleichzeitig werden die Vorteile des Kaiserschnitts hinsichtlich der Vermeidung dieser Risiken, aber auch die potenziellen Risiken und Komplikationen des Eingriffs selbst dargestellt. Der Vergleich soll eine informierte Entscheidungsfindung ermöglichen.
Beweggründe der Frauen für den Wunsch nach einem Kaiserschnitt: Dieses Kapitel untersucht die vielfältigen Beweggründe von Frauen, die sich für einen Wunschkaiserschnitt entscheiden. Es geht über die rein zeitlichen Aspekte hinaus und analysiert Ängste vor Schmerzen, Komplikationen und Verletzungen, aber auch individuelle Präferenzen und das Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstbestimmung im Geburtsprozess. Die Kapitel untersucht die Komplexität der Entscheidungsfindung der Frauen.
PatientInnenautonomie: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der PatientInnenautonomie im medizinischen Kontext, insbesondere im Zusammenhang mit der Geburtsentscheidung. Es diskutiert das Recht der Frau auf Selbstbestimmung und informiert über die Rolle der ärztlichen Beratung und der informierten Einwilligung. Es wird untersucht, wie PatientInnenautonomie in der Praxis umgesetzt werden kann und welche ethischen Herausforderungen sich daraus ergeben.
Schlüsselwörter
Wunschkaiserschnitt, PatientInnenautonomie, vaginale Geburt, geplanter Kaiserschnitt, Geburtsentscheidung, Risiken, Vorteile, ethische Implikationen, Selbstbestimmung, medizinische Indikation.
Häufig gestellte Fragen zum Wunschkaiserschnitt
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert umfassend den Wunschkaiserschnitt. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, eine Zusammenfassung der Kapitel, Schlüsselwörter und behandelt die Vor- und Nachteile vaginaler Geburten und geplanter Kaiserschnitte, die Motive von Frauen für einen Wunschkaiserschnitt und die PatientInnenautonomie in diesem Kontext.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Vor- und Nachteile vaginaler Geburten und geplanter Kaiserschnitte, die Motive von Frauen für einen Wunschkaiserschnitt (über rein zeitliche Aspekte hinausgehend), PatientInnenautonomie im Kontext der Geburtsentscheidung, ethische Implikationen des Wunschkaiserschnitts und die Entwicklung und gesellschaftliche Wahrnehmung des Kaiserschnitts.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Die Einleitung beleuchtet die steigende Kaiserschnittrate und die zentrale Forschungsfrage. Das Kapitel über die Vor- und Nachteile von vaginaler Geburt und geplantem Kaiserschnitt vergleicht beide Entbindungsarten. Ein weiteres Kapitel untersucht die Beweggründe von Frauen für einen Wunschkaiserschnitt. Das Kapitel zur PatientInnenautonomie befasst sich mit dem Recht der Frau auf Selbstbestimmung und informierte Einwilligung. Ein Fazit rundet die Arbeit ab.
Welche Vorteile und Risiken von vaginalen Geburten und Kaiserschnitten werden diskutiert?
Die Arbeit beschreibt die physiologischen Vorteile der natürlichen Geburt und die damit verbundenen Risiken (z.B. Beckenbodenschäden). Sie beleuchtet auch die Vorteile des Kaiserschnitts bei der Vermeidung dieser Risiken, gleichzeitig werden aber auch die potenziellen Risiken und Komplikationen des Eingriffs selbst dargestellt.
Welche Motive von Frauen für einen Wunschkaiserschnitt werden analysiert?
Die Arbeit analysiert vielfältige Motive, die über rein zeitliche Aspekte hinausgehen. Sie berücksichtigt Ängste vor Schmerzen, Komplikationen und Verletzungen sowie individuelle Präferenzen und das Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstbestimmung im Geburtsprozess.
Wie wird PatientInnenautonomie in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel zur PatientInnenautonomie diskutiert das Recht der Frau auf Selbstbestimmung, die Rolle der ärztlichen Beratung und der informierten Einwilligung. Es untersucht die Umsetzung von PatientInnenautonomie in der Praxis und die damit verbundenen ethischen Herausforderungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Wunschkaiserschnitt, PatientInnenautonomie, vaginale Geburt, geplanter Kaiserschnitt, Geburtsentscheidung, Risiken, Vorteile, ethische Implikationen, Selbstbestimmung, medizinische Indikation.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Stellt der Wunschkaiserschnitt einen Tabubruch dar oder einen Schritt in Richtung PatientInnenautonomie?
- Citation du texte
- Sarah Sander (Auteur), 2017, Der Wunschkaiserschnitt. Ein Tabubruch oder ein Schritt in Richtung Patientinnenautonomie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387111