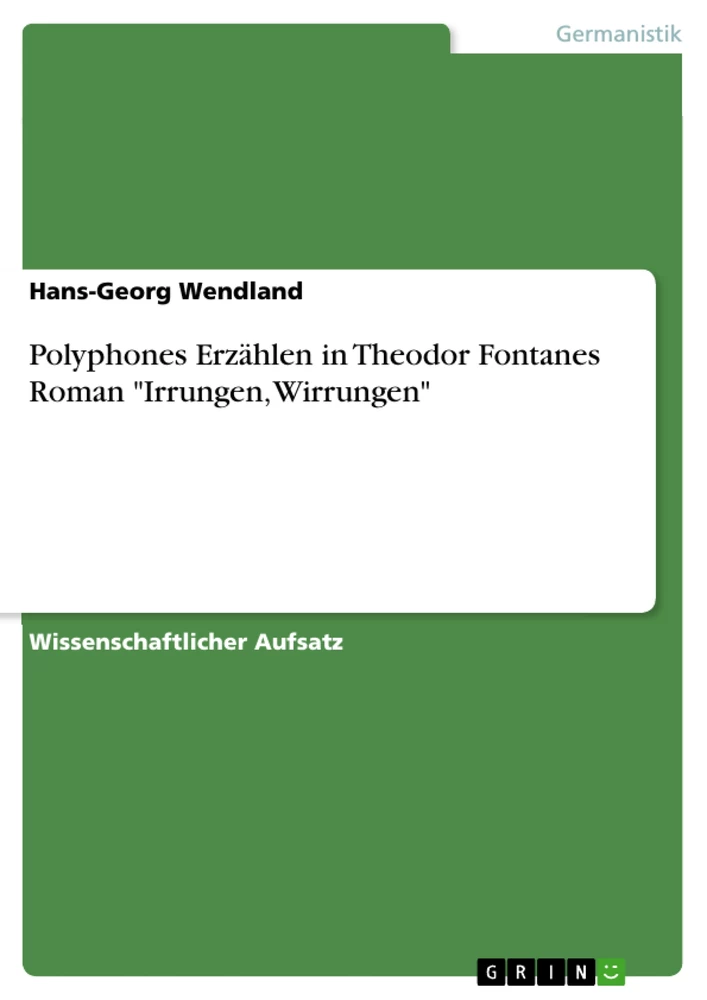„Meine ganze Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, die Menschen so sprechen zu lassen, wie sie wirklich sprechen.“
Diese Äußerung Theodor Fontanes verdeutlicht in schlichter Einfachheit, welchen Stellenwert der Autor der Sprechweise seiner Romanfiguren beigemessen hat. Mehr noch als durch die Beschreibung äußerer Attribute, individueller Eigenarten und Handlungsweisen aus der Perspektive des Erzählers werden die Figuren seiner Romane – und dies trifft in besonderem Maße für Irrungen, Wirrungen zu – durch ihre Art und Weise zu sprechen charakterisiert. Fontane lässt die Menschen in diesem Roman nicht nur von oder über etwas sprechen. Es geht ihm vor allem darum, wie die Figuren im Gespräch miteinander kommunizieren und wie erfolgreich bzw. problematisch die Verständigung zwischen ihnen ist. Um diesen Zusammenhang zwischen Redeweise und Verständigung seiner Figuren näher zu untersuchen, soll eine weitere Äußerung Fontanes als Richtschnur und Wegweiser dienen, die einem Brief an Emil Dominik vom 14. Juli 1887 entnommen ist, wo er schreibt, bei Irrungen, Wirrungen solle der Leser unbedingt auf „die tausend Finessen ... achten, die ich dieser von mir besonders geliebten Arbeit mit auf den Lebensweg gegeben habe.“ Welcher Art diese Finessen sind, welche Botschaften sich in der Vielzahl von Andeutungen, Anspielungen, Formeln und Floskeln, Redensarten, Bezeichnungen, Namen und intertextuellen Bezügen verbergen und welchen Stellenwert sie im Gesamtgefüge des Romans einnehmen, bildet ebenfalls einen wichtigen Gegenstand dieser Untersuchung. In den Gesprächen der Figuren offenbaren sich nicht etwa unumstößliche, allgemeingültige Wahrheiten. Sie enthalten vielmehr ein Konfliktpotenzial von miteinander konkurrierenden Sichtweisen, Widersprüchlichkeiten, Mehrdeutigkeiten und Doppelbödigkeiten, die zu Missverständnissen oder Enttäuschungen führen und nicht vollständig aufgelöst werden können. Die Sprache der Figuren wird entscheidend durch ihren gesellschaftlichen Status und ihre Milieuzugehörigkeit bestimmt. Dabei entfaltet sich ein breites und vielfältig ausdifferenziertes Spektrum von Sprechweisen und Stilebenen, das die Schichtenzugehörigkeit der Figuren widerspiegelt und von der Sprache des einfachen Volkes und Kleinbürgertums bis zum Jargon der Offiziere und den Sprachgepflogenheiten der gehobenen Gesellschaftskreise und des Adels reicht.Charakteristisch für die Erzählweise des Romans ist ferner eine Erzählinstanz, die sich im Hintergrund hält.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Multiperspektivität, Polyphonie und Bachtins Konzept der Dialogizität
- Polyphonie und Polyglossie in Irrungen, Wirrungen
- „Wie die Menschen wirklich sprechen“: Standardsprache oder Dialekt?
- Pitt, Serge, Balafré, Gaston und die Sprache der Offiziere….....
- Die „Sprache des Herzens“ und der „Wahrhaftigkeit“
- „Was sagen Sie zu dem Wetter?\" Code-Switching und Polyglossie.....
- „Sprechtalent“ oder „Schwatzhaftigkeit“? Die „Kunst des gefälligen Nichtssagens“
- „Proppertät“, „Honnettität“ und „Reellität“: die Sprache der Neuen Zeit?
- „Es giebt keine Pompadours mehr“: Mit Schlagfertigkeit und Witz in eine „neue Zeit“
- Zusammenfassung.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die polyphone Erzählweise in Theodor Fontanes Roman „Irrungen, Wirrungen“ und untersucht, wie die Sprache der Figuren deren gesellschaftlichen Status und ihre Milieuzugehörigkeit widerspiegelt. Sie betrachtet die Verwendung von Dialekt, Code-Switching und anderen sprachlichen Besonderheiten sowie die Rolle des Erzählers in der Gestaltung des polyphonen Erzählens.
- Die Bedeutung der Sprache als Ausdruck von sozialer Zugehörigkeit
- Die Rolle von Polyphonie und Dialogizität in Fontanes Erzählweise
- Die Darstellung von gesellschaftlichen Konflikten durch die sprachliche Differenzierung der Figuren
- Die Frage nach der Authentizität der Sprache im Roman
- Die Verwendung von Bachtins Konzept der Dialogizität zur Analyse von Fontanes Werk
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Fontanes Fokus auf die Authentizität der Sprache seiner Figuren in „Irrungen, Wirrungen“ dar und führt das Konzept der „Finessen“ ein, die im weiteren Verlauf untersucht werden.
- Multiperspektivität, Polyphonie und Bachtins Konzept der Dialogizität: Dieses Kapitel erklärt Bachtins Konzept der Polyphonie und Dialogizität und untersucht, inwiefern Fontanes Erzählweise diesem Konzept entspricht.
- Polyphonie und Polyglossie in Irrungen, Wirrungen: Dieses Kapitel analysiert die sprachliche Vielfalt in Fontanes Roman. Es betrachtet die verschiedenen Sprechweisen der Figuren und untersucht, wie diese ihre soziale Herkunft und ihre Rolle in der Gesellschaft widerspiegeln. Es wird insbesondere auf die Verwendung von Dialekt, Code-Switching und anderen sprachlichen Besonderheiten eingegangen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter für diese Arbeit sind: Polyphonie, Dialogizität, Michail Bachtin, Theodor Fontane, Irrungen, Wirrungen, Sprache, gesellschaftlicher Status, Milieu, Dialekt, Code-Switching, Figurenrede, Erzählperspektive.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "polyphones Erzählen" bei Theodor Fontane?
Es beschreibt eine Erzählweise, in der viele verschiedene Stimmen und Sprechweisen gleichberechtigt nebeneinanderstehen und die Figuren durch ihre individuelle Sprache charakterisiert werden.
Wie charakterisiert Fontane seine Figuren in "Irrungen, Wirrungen"?
Weniger durch äußere Beschreibungen als vielmehr durch ihre Art zu sprechen, ihren Dialekt, Jargon oder die Verwendung von Floskeln und Code-Switching.
Was ist der Unterschied zwischen der Sprache der Offiziere und des Volkes?
Die Offiziere nutzen oft einen spezifischen Jargon und die "Kunst des gefälligen Nichtssagens", während das Kleinbürgertum eine Sprache der "Wahrhaftigkeit" oder dialektale Einfärbungen zeigt.
Welche Rolle spielt Bachtins Konzept der Dialogizität in der Analyse?
Es dient als theoretische Grundlage, um zu zeigen, wie Gespräche im Roman Konfliktpotenziale, Mehrdeutigkeiten und soziale Schichtenzugehörigkeiten widerspiegeln.
Was meinte Fontane mit den "tausend Finessen" seines Romans?
Damit sind die vielen Andeutungen, Anspielungen und intertextuellen Bezüge gemeint, die sich in der Sprache der Figuren verbergen und erst beim genauen Hinsehen offenbaren.
- Citation du texte
- Hans-Georg Wendland (Auteur), 2018, Polyphones Erzählen in Theodor Fontanes Roman "Irrungen, Wirrungen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387201