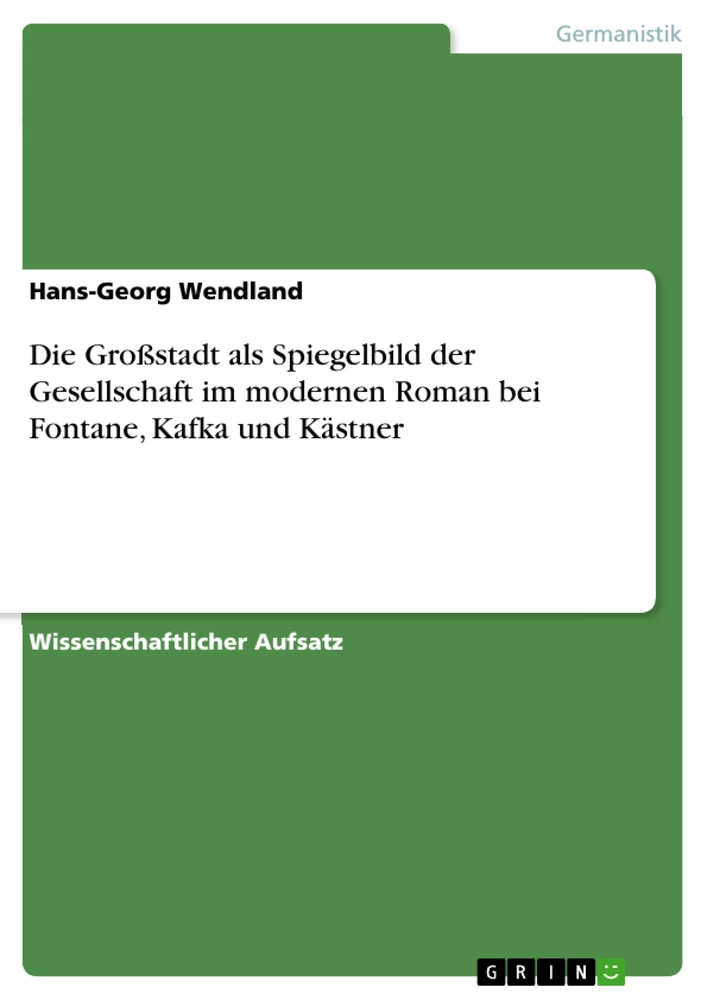In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer stürmisch einsetzenden Industrialisierung und als Folge davon zu einem enormen Städtewachstum und einem stetig anschwellenden Zustrom der Landbevölkerung in die großstädtischen Ballungszentren. Das führte zu einer zunehmenden Proletarisierung und Verelendung breiter Bevölkerungsschichten. Die damit zusammenhängenden Probleme von Wohnungsnot, Alkoholismus, Krankheit, Gewalt und Verbrechen schienen angesichts einer gleichgültigen und untätigen gesellschaftlichen Oberschicht unlösbar zu sein. In zeitgenössischen Berichten waren die hässlichen Seiten dieser Wirklichkeit oft nur Randerscheinungen. Stattdessen stellte man die Leistungsfähigkeit moderner Industriebetriebe heraus.
Ganz im Gegensatz dazu wurden in zeitgenössischen Kunstdarstellungen die Schattenseiten der modernen Arbeitswelt nicht durch die Faszination für die Leistungen moderner Industriekapitäne übertönt. Das erkennt man beispielsweise in Gemälden wie Adolph Menzels „Eisenwalzwerk“ (1875) mit dem sprechenden Untertitel „Moderne Cyclopen“ und später noch in den Bildern von Malern wie Max Liebermann, in denen sich die wirklichen Verhältnisse dieser Welt offenbaren: die Monotonie im Industriealltag und das Wohnungselend in den Mietskasernen und Hinterhöfen der Großstadt. Bereits im Jahre 1855 hatte der französische Maler Gustave Courbet (1819 - 1877) in Paris eine Auswahl seiner Werke gezeigt und sie "le réalisme" genannt. Unter diesem programmatischen Begriff propagierte er eine in der damaligen Kunstwelt als provozierend empfundene Malweise, mit der die Wirklichkeit nicht nach den vorformulierten Idealen einer "höheren" Realität und den Regeln einer normativen Ästhetik dargestellt, sondern als sichtbare Alltagswirklichkeit ungeschönt, d. h. mit all ihren gewöhnlichen und hässlichen Seiten, gezeigt werden sollte. Mit Bildern wie "Les casseurs de pierres" ("Die Steinklopfer", 1849) hatte er der konventionellen bürgerlichen Salonkunst und der idealisierenden Historienmalerei eine eindeutige Absage erteilt und war auf den erbitterten Widerstand der zeitgenössischen Kunstkritik gestoßen, die sich sowohl am Thema (das harte Los einfacher Straßenarbeiter) als auch an der Malweise (ungekünstelte Darstellung der Wirklichkeit) stieß und das Bild als hässlich empfand. Während dieser Zeit wurde die Großstadt als Schauplatz und Referenzrahmen mehr und mehr zum Gegenstand von Literatur.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theodor Fontanes „Fontanopolis\" und ihre Darstellung in „Irrungen, Wirrungen“
- Der Roman als „soziale Psychographie“
- Die Bedeutung von Milieu- und Standeszugehörigkeit: gesellschaftlich sanktionierte und tabuisierte städtische Räume
- Lärm und Hektik als bedrohliche Erscheinungsformen der modernen Großstadt
- Rückzug in traditionelle Ordnungsmuster der herkömmlichen Ständegesellschaft
- Franz Kafka und das „allermodernste New York\" in „Der Verschollene“
- Das Schiff als Sinnbild einer hierarchisch strukturierten Klassengesellschaft europäischen Zuschnitts
- Die Stadt: Ort der Superlative und Extreme
- Die Welt der Arbeit
- Soziale Gegensätze und Außenseiter der Gesellschaft
- Erich Kästners „Fabian\": Ein Roman der Neuen Sachlichkeit
- Neusachliche Themenschwerpunkte
- Die Großstadt als Paradigma für die Orientierungslosigkeit des modernen Menschen
- Die Welt der Arbeit
- Frauenbilder und das Thema Liebe in der modernen Großstadt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Darstellung der Großstadt in der Literatur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert. Ziel ist es, die Entwicklung des Großstadtromans in dieser Zeit anhand ausgewählter Werke von Theodor Fontane, Franz Kafka und Erich Kästner zu untersuchen.
- Die Veränderungen des großstädtischen Raumes und seine Darstellung in der Literatur
- Die Auswirkungen der Industrialisierung auf die Lebensbedingungen der Menschen in der Stadt
- Die Rolle der Großstadt als Schauplatz für gesellschaftliche Konflikte und soziale Ungleichheit
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der modernen Lebensweise in der Großstadt
- Die Darstellung von Frauenbildern und Liebesbeziehungen im Kontext der Großstadt
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einleitung, die die historische und gesellschaftliche Entwicklung der Großstadt im 19. Jahrhundert skizziert. Im zweiten Kapitel wird Theodor Fontanes „Fontanopolis\" und ihre Darstellung in „Irrungen, Wirrungen\" beleuchtet, wobei der Fokus auf den Aspekt der sozialen Psychographie und der Bedeutung von Milieu und Standeszugehörigkeit liegt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Franz Kafkas „Der Verschollene\" und der Darstellung des „allermodernsten New York\", wobei Themen wie das Schiff als Sinnbild der Klassengesellschaft und die sozialen Gegensätze der Stadt im Mittelpunkt stehen. Im vierten Kapitel wird Erich Kästners „Fabian\" als Roman der Neuen Sachlichkeit behandelt, wobei die Themenschwerpunkte die Orientierungslosigkeit des modernen Menschen und die Welt der Arbeit im Fokus stehen. Das fünfte Kapitel beleuchtet die Frauenbilder und das Thema Liebe in der modernen Großstadt, ohne jedoch auf die konkreten Inhalte der einzelnen Werke einzugehen.
Schlüsselwörter
Der Text konzentriert sich auf die Darstellung der Großstadt in der Literatur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert. Wichtige Schlüsselwörter sind: Großstadtroman, Industrialisierung, soziale Psychographie, Milieu, Standeszugehörigkeit, Klassengesellschaft, Orientierungslosigkeit, Frauenbilder, Liebesbeziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Großstadt in Theodor Fontanes "Irrungen, Wirrungen" dargestellt?
Die Stadt wird als Raum sozialer Psychographie dargestellt, in dem Milieu- und Standeszugehörigkeit den Lebensweg und die Liebe der Protagonisten bestimmen.
Welches Bild von New York zeichnet Franz Kafka in "Der Verschollene"?
Kafka beschreibt ein New York der Superlative und Extreme, das als Sinnbild einer hierarchisch strukturierten Klassengesellschaft und entfremdeten Arbeitswelt fungiert.
Was charakterisiert Erich Kästners "Fabian" als Roman der Neuen Sachlichkeit?
Der Roman nutzt die Großstadt Berlin als Paradigma für die Orientierungslosigkeit des modernen Menschen und die harten Realitäten der Arbeitswelt der späten 1920er Jahre.
Wie beeinflusste die Industrialisierung das Städtewachstum im 19. Jahrhundert?
Die Industrialisierung führte zu einem enormen Zustrom der Landbevölkerung, was Probleme wie Wohnungsnot, Proletarisierung und soziale Verelendung in den Ballungszentren verschärfte.
Welche Rolle spielen Frauenbilder in der modernen Großstadtliteratur?
Die Arbeit untersucht, wie sich traditionelle Frauenrollen im urbanen Raum wandeln und wie Liebesbeziehungen durch die Hektik und Anonymität der Stadt beeinflusst werden.
Was ist der Unterschied zwischen idealisierter Kunst und Realismus?
Der Realismus (z.B. bei Courbet oder Menzel) zeigt die Alltagswirklichkeit ungeschönt, inklusive ihrer hässlichen Seiten wie harter Arbeit und Armut, statt sie zu idealisieren.
- Citation du texte
- Hans-Georg Wendland (Auteur), 2018, Die Großstadt als Spiegelbild der Gesellschaft im modernen Roman bei Fontane, Kafka und Kästner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387334