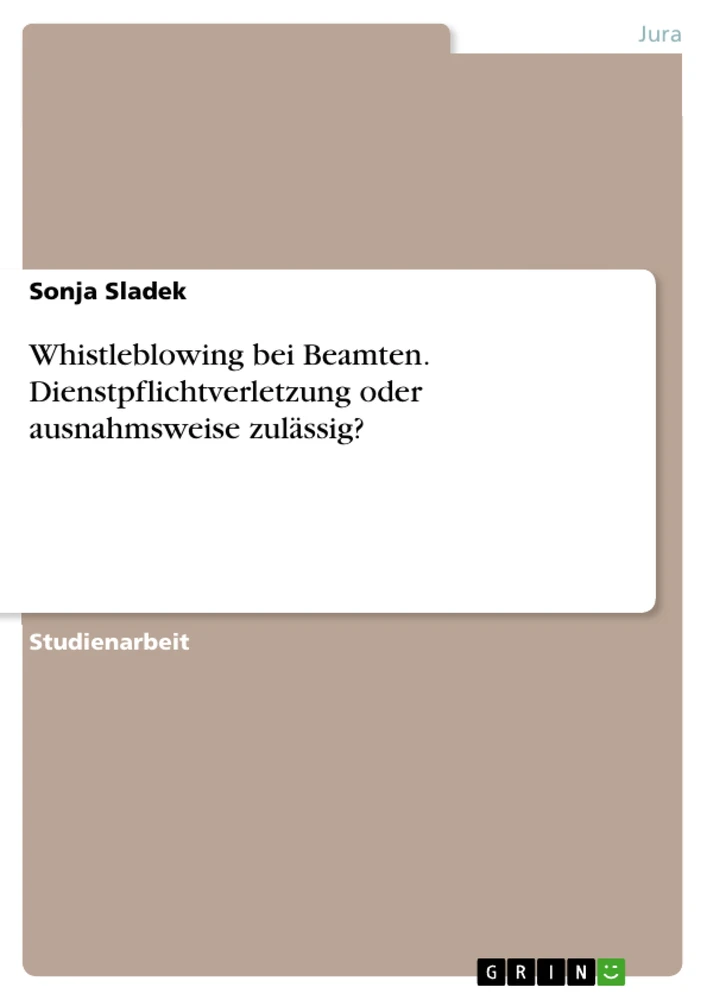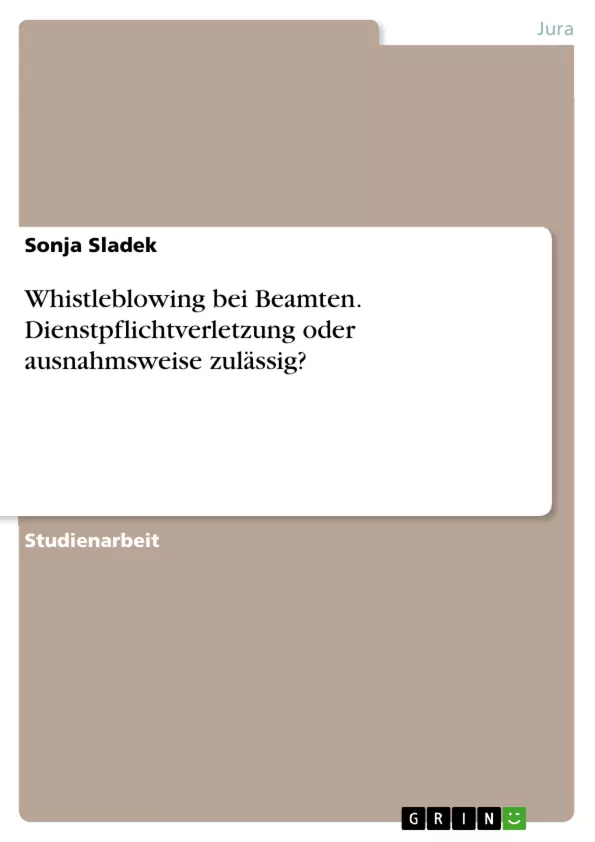Menschen die Missstände, Straftaten, unmoralische Hergänge oder Gefahren für die Umwelt und oder der Allgemeinheit, der Öffentlichkeit preisgeben, bezeichnet man als sogenannte Whistleblower. Dies bedeutet so viel wie jemanden verpfeifen und ist mit dem Deutschen Äquivalent des Hinweisgebers zu vergleichen. Eine mögliche Erklärung weshalb der aus dem Angelsächsischen stammende Begriff weit aus geläufiger ist als das gleichbedeutende deutsche Wort, könnte darin liegen, dass der Hinweisgeber völlige Legitimität impliziert, wohingegen das Wort verpfeifen „to blow the whistle“ den wahren Konflikt verschiedener Interessen wiedergibt. Dabei spielen Recht und Gesetzt ebenso eine Rolle wie Moral, Loyalität und die Beweggründe des Whistleblowers. Für die einen gelten sie als Denunzianten und Nestbeschmutzer, andere wiederum bewundern sie geradezu für ihre Zivilcourage und den Weg, den sie eingeschlagen haben und der sie Karriere und Reputation kosten kann. In der Bundesrepublik wie auch in einigen anderen europäischen Ländern bewegen sich Hinweisgeber in einer gesetzlichen Grauzone, die gerade im Bereich des Beamtenrechts noch undurchsichtiger wird. Im Folgenden wird versucht genauer darauf einzugehen, inwiefern Whistleblowing bei Beamtinnen und Beamten eine pflichtwidrige Dienstverletzung darstellt oder sie gegebenenfalls doch zulässig ist. Auch soll im Rahmen dieser Hausarbeit, neben der grundlegenden Fragestellung nach einer Dienstpflichtverletzung, auf die Zulässigkeit und mögliche Notwendigkeit von Zusätzen und Änderungen im Beamtenrecht eingegangen werden. Im besonderen Fokus liegen hierbei die Nordrhein-westfälischen Beamtinnen und Beamten. Das Thema Whistleblowing wird seit erst recht junger Zeit als öffentliche Debatte geführt und erstmals auch als mögliche Chance angesehen. Dabei gibt es das so modern klingende Whistleblowing eigentlich schon seit jeher. Neben den Unternehmen ist nun auch die Politik auf die Bedeutung dieser Thematik gestoßen. Ein Gesetzesentwurf aus dem Jahr 2012 im deutschen Bundestag sah vor einen weitreichenderen Schutz für Whistleblower zu schaffen, wurde jedoch in zweiter Lesung abgelehnt . Ebenso wurde ein zweiter Gesetzesentwurf aus dem Jahr 2015 vom deutschen Bundestag in zweiter Lesung, mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD, abgelehnt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bedeutung von Whistleblowing
- Was genau versteht man unter Whistleblowing?
- Probleme im Zusammenhang mit Whistleblowing
- Warum ist Whistleblowing auch in der öffentlichen Verwaltung und unter Beamten wichtig?
- Das Bild der Whistleblower
- Die Besonderheit von Whistleblowings bei Beamtinnen und Beamten
- Das öffentlich-rechtliche Dienst- und Treueverhältnis
- Das Verhältnis zu anderen Grundrechten
- Die Hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums
- Die Amtsverschwiegenheitspflicht
- Konkretisierung im Beamtenstatusgesetz
- „Ausnahmen“ der Verschwiegenheitspflicht
- Verbleibende Unsicherheiten der Ausnahmeregelungen
- Über Korruptionsstraftaten hinaus
- Aussagegenehmigung – Mögliche Schwachstellen
- Mögliche Änderungen
- Können die hergebrachten Grundsätze verändert werden?
- Wem obliegt die Gesetzgebungskompetenz?
- Der Bundesgesetzgeber in der Pflicht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die rechtliche Situation von Whistleblowing im Beamtenrecht, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Sie beleuchtet die Frage, ob Whistleblowing für Beamte eine Dienstpflichtverletzung darstellt oder unter welchen Umständen es zulässig ist. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen und diskutiert die Notwendigkeit von Anpassungen im Beamtenrecht.
- Die Definition und Bedeutung von Whistleblowing im öffentlichen Dienst
- Die Besonderheiten von Whistleblowing im Beamtenrecht, insbesondere die Amtsverschwiegenheitspflicht
- Die Abwägung zwischen Dienstpflicht und Grundrechten bei Whistleblowing
- Mögliche Änderungen im Beamtenrecht, um den Schutz von Whistleblowern zu verbessern
- Die Rolle der Politik bei der Gestaltung von Gesetzen zum Schutz von Whistleblowern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Whistleblowing ein und erklärt die Bedeutung des Begriffs im Kontext von Beamten. Sie verdeutlicht die rechtliche Grauzone und die Notwendigkeit, die Zulässigkeit von Whistleblowing im Beamtenrecht zu untersuchen.
Kapitel 2 beleuchtet die Bedeutung von Whistleblowing im Allgemeinen. Es definiert den Begriff und stellt die unterschiedlichen Perspektiven auf das Whistleblowing dar. Es werden die ethischen und rechtlichen Aspekte sowie die Herausforderungen für Whistleblower im öffentlichen Dienst erörtert.
Kapitel 3 konzentriert sich auf die Besonderheiten des Beamtenrechts. Es analysiert das öffentlich-rechtliche Dienst- und Treueverhältnis sowie die Auswirkungen auf die Handlungsfreiheit von Beamten im Falle von Whistleblowing. Darüber hinaus werden die relevanten Grundrechte und die Hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums betrachtet.
Kapitel 4 befasst sich mit der Amtsverschwiegenheitspflicht. Es untersucht die konkreten Regelungen im Beamtenstatusgesetz und die Ausnahmeregelungen, die für Whistleblowing relevant sind. Die Diskussion konzentriert sich auf die bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf die Ausnahmeregelungen und die Frage, ob die bestehende Rechtslage ausreichend Schutz für Whistleblower bietet.
Kapitel 5 widmet sich möglichen Änderungen im Beamtenrecht. Es diskutiert die Notwendigkeit und die Möglichkeit von Anpassungen, um den Schutz von Whistleblowern zu verbessern. Es werden die Gesetzgebungskompetenzen auf Bundes- und Landesebene beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Whistleblowing, Beamtenrecht, Amtsverschwiegenheitspflicht, Dienstpflichtverletzung, Grundrechte, Hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums, Korruptionsstraftaten, Aussagegenehmigung, Gesetzesänderungen, Schutz von Whistleblowern, öffentlicher Dienst.
- Quote paper
- Sonja Sladek (Author), 2017, Whistleblowing bei Beamten. Dienstpflichtverletzung oder ausnahmsweise zulässig?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387847