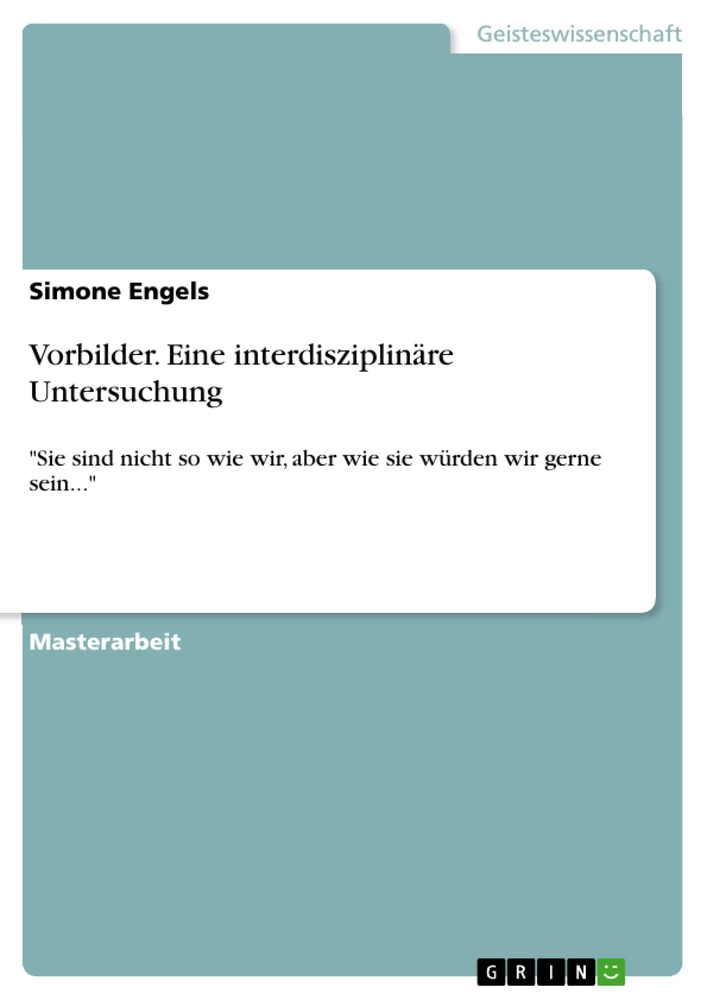Vorbilder sind Personen, mit denen wir uns identifizieren und deren Ideale uns mustergültig und nachahmungswert erscheinen. Auch wenn die Abgrenzungen zwischen Vorbildern, Idolen, Stars und Leitbilder fließend sind, lassen sich deutliche Unterscheidungen erkennen.
Der Identifikation mit einem Vorbild folgt die Imitation konkreter Verhaltensweisen und die Übernahme sozialer Attitüden, Werte und Normen. Das menschliche Imitationsverhalten wird dabei als ein grundlegender Prozess und ein menschliches Bedürfnis verstanden, welches, häufig unbeabsichtigt, sowohl in den frühen Lebensphasen als auch im Erwachsenenalter eine entscheidende Rolle spielt. Während zunächst Bezugspersonen wie die Eltern oder Vertraute als Vorbilder für Imitationsverhalten fungieren, gewinnen später andere, auch zunehmend medial präsentierte Modelle an vorbildhafter Bedeutung. Die Imitation des Verhaltens von Vorbildern und die Übernahme von Einstellungen und Werten folgen dabei bestimmten Gesetzmäßigkeiten, wobei besonders die wahrgenommene Ähnlichkeit zum Modell von Bedeutung ist. Da aus diesen Gesetzmäßigkeiten zwar notwendige, nicht aber hinreichende Bedingungen abgeleitet werden können, werden Charakteristiken wie Nähe, physische Attraktivität, (charismatische) Macht, Extraversion, Erfolg und Autorität als günstige Faktoren für eine Vorbildwirkung beschrieben.
Erfolgreiche Vorbilder sind ebenfalls fähig Individuen zu motivieren, Schwierigkeiten zu überwinden und selbst Erfolge zu erreichen. Besonders in Situationen, in denen ein Autostereotyp die Umsetzung von Fähigkeiten in konkreten Leistungen behindert. Zudem zeigt sich die Wirkung von Vorbildern in weiteren divergierenden Kontexten, wie in der Imitation von aggressiven Verhaltensweisen, bei der Unterlassung von prosozialem Verhalten und Altruismus, beim sogenannten Werther-Effekt sowie bei der Einstellungsänderung durch persuasive Kommunikation.
Schließlich können auch soziale Vergleiche mit Vorbildern auftreten. Soziale Vergleiche mit Vorbildern sind aufwärts gerichtet, weil das Vorbild bereits Erfolge erzielt hat, die das Individuum selbst noch nicht erreicht hat, vielleicht auch niemals erreichen wird. Der Vergleich mit einem relevanten und herausragenden Vorbild wirkt aber nur dann inspirierend und motivierend, wenn der Erfolg des Vorbilds als erreichbar eingestuft wird.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmung
- 3. Vorbilder und Imitation
- 3.1. Frühste Kindheit und Kindheit
- 3.2. Adoleszenz
- 3.3. Erwachsenenalter
- 3.4. Neurobiologische Erkenntnisse
- 3.5. Zusammenfassung
- 4. Grundlegende Bedingungen für die Wirkung von Vorbildern
- 4.1. Aufmerksamkeit
- 4.2. Gedächtnis
- 4.3. Reproduktion des Verhaltens
- 4.4. Bekräftigungs- und Motivationsprozesse
- 4.5. Ähnlichkeit
- 4.6. Zusammenfassung
- 5. Situative und personale Determinanten von Vorbildern
- 5.1. Nähe
- 5.2. Physische Attraktivität
- 5.3. Macht und Charisma
- 5.4. Autorität
- 5.5. Extraversion
- 5.6. Erfolg
- 5.7. Zusammenfassung
- 6. Vorbilder und Handlungsmotivation
- 7. Vorbilder in konkreten Inhaltsbereichen
- 7.1. Aggression
- 7.2. Werther-Effekt
- 7.3. Prosoziales Verhalten und Altruismus
- 7.4. Einflussnahme durch gezielte Kommunikation
- 7.5. Zusammenfassung
- 8. Soziale Vergleiche mit Vorbildern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Vorbilder und ihrer Auswirkungen auf das menschliche Verhalten. Sie untersucht die Mechanismen der Identifikation mit Vorbildern und die daraus resultierenden Imitations- und Handlungsprozesse. Die Arbeit beleuchtet sowohl die psychologischen und neurobiologischen Grundlagen der Vorbildwirkung als auch situative und personale Determinanten, die die Wirksamkeit von Vorbildern beeinflussen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Vorbild“
- Psychologische und neurobiologische Grundlagen der Vorbildwirkung
- Bedingungen für die Wirksamkeit von Vorbildern
- Situative und personale Faktoren, die die Vorbildwirkung beeinflussen
- Vorbilder in verschiedenen Inhaltsbereichen (z.B. Aggression, Prosoziales Verhalten, Werther-Effekt)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff des Vorbilds vor und beleuchtet seine Ambivalenz im Kontext der deutschen Geschichte. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs „Vorbild“ und grenzt ihn von verwandten Konzepten wie Idolen, Stars und Leitbildern ab. Kapitel 3 widmet sich dem Thema „Vorbilder und Imitation“ und analysiert die Rolle von Vorbildern in den verschiedenen Phasen des menschlichen Lebens, von der frühen Kindheit bis zum Erwachsenenalter. Kapitel 4 untersucht die grundlegenden Bedingungen für die Wirkung von Vorbildern, wie z.B. Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Bekräftigungs- und Motivationsprozesse. Kapitel 5 behandelt situative und personale Determinanten von Vorbildern, einschließlich Nähe, physische Attraktivität, Macht, Autorität, Extraversion und Erfolg.
Schlüsselwörter
Vorbild, Imitation, Identifikation, Nachahmung, Handlungsmotivation, soziale Vergleiche, Werther-Effekt, prosoziales Verhalten, Aggression, persuasive Kommunikation, neurobiologische Erkenntnisse.
- Quote paper
- Simone Engels (Author), 2012, Vorbilder. Eine interdisziplinäre Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388272