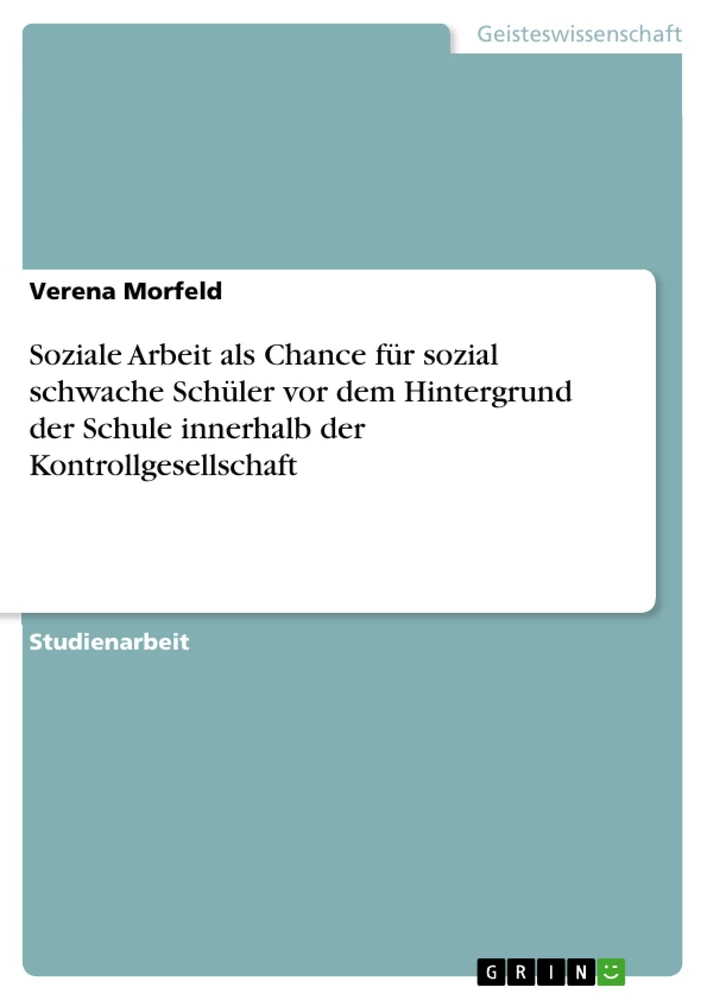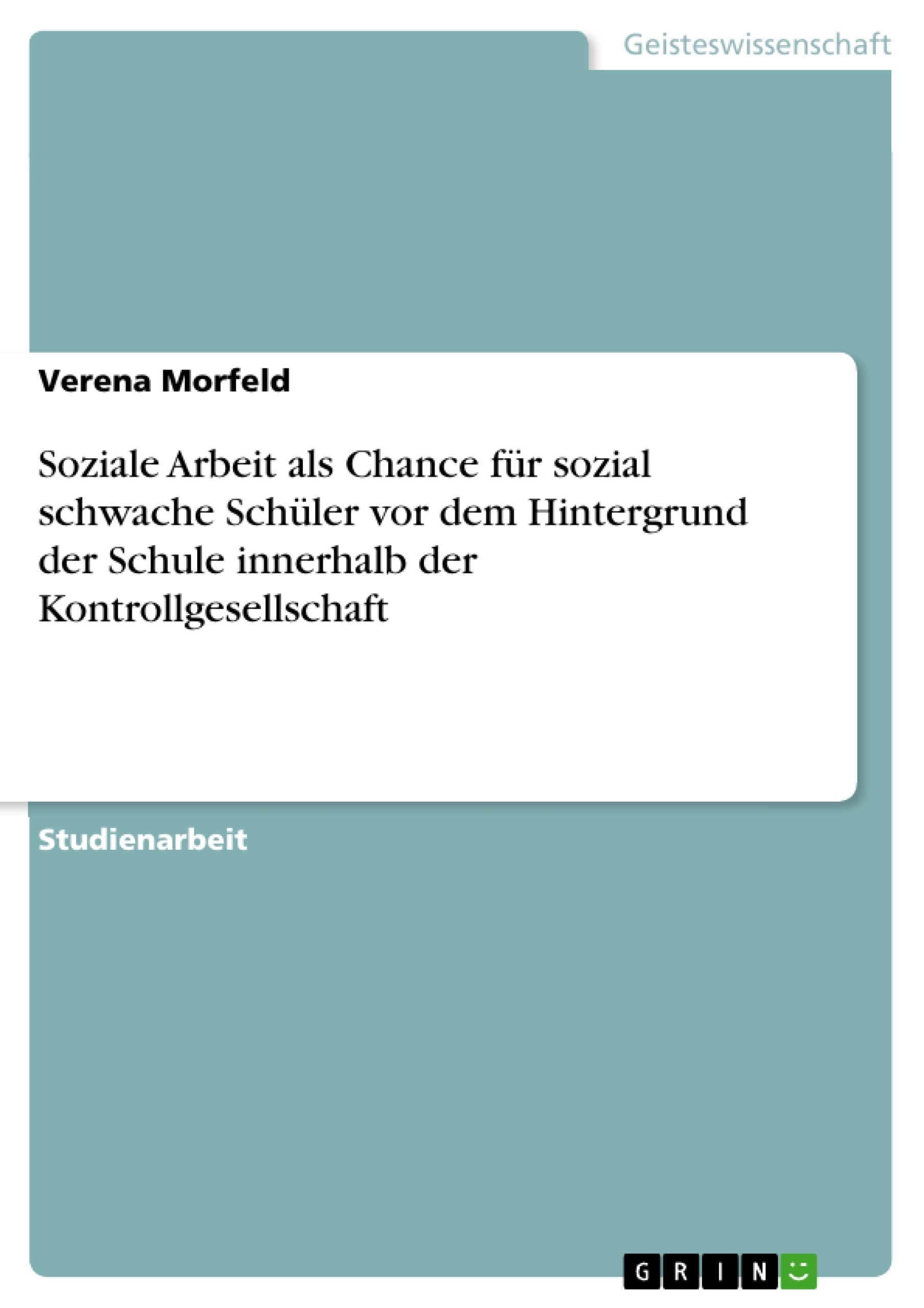Der aktuelle sozial- und innenpolitische Diskurs um Schulbildung, für den zur NRW Landtagswahl insbesondere die ehemalige Bildungsministerin Sylvia Löhrmann kritisiert wurde, zeigt, dass schulische Bildung in Deutschland zu einem im gesellschaftlichen Diskurs hoch angesehenem Gut gezählt werden kann. Bildung als ist dabei als gesellschaftliche Erwartung anzusehen, da ein Mindestmaß an Bildung vorausgesetzt wird, um Erfolg und Teilhabe in der Gesellschaft zu haben. Gesellschaft selbst zeichnet sich weiterhin durch hohe Erwartungen an ihre Mitglieder aus. Aus Sicht der Theorie der ‚Kontrollgesellschaft’ kennzeichnen die moderne Gesellschaft Forderungen nach Selbststeuerung des Menschen und einen damit verbunden Sicherheitsverlust durch das Wegbrechen inkludierender Strukturen der „Disziplinargesellschaft“. Dem Individuum wird so betrachtet abverlangt, sich selbst gesellschaftlich durch fortlaufende Konkurrenz mit anderen innerhalb der Gesellschaft zu positionieren. Dabei ist es dazu verdonnert sich den Normen anzupassen, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Kann den Erwartungen nicht entsprochen werden, so kann es passieren, dass insbesondere schwächer situierte Menschen Erfahrungen der Ausgrenzung und der sozialen Isolation machen.
Diese Isolation bedeutet auch den Ausschluss von Tauschprozessen und somit den „sozialen Tod“ (Pongratz 2010, S.72). Sie werden zu Verlierern des ‚Konkurrenzkampfs‘. Die Unterstützung von sozial schwachen Menschen und die Bewahrung dieser vor der sozialen Exklusion stellt eine wichtige Aufgabe der Sozialen Arbeit dar. Ausgehend von der Hypothese, dass gerade schulische Bildung über gesellschaftliche Zugangschancen bestimmt und aus der Perspektive der Theorie der Kontrollgesellschaft als gesellschaftliche Konkurrenzsituation verstanden werden kann, wird in der hier vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen, wie die schulische Methode des „Trainingsraums“ kritisch aus Sicht professioneller Sozialer Arbeit zu betrachten ist und welche Bedeutung sie für sozial schwache Schüler im Kontext von Schule hat. Denn wird den Bildungserwartungen nicht entsprochen, so kommen Methoden wie der Trainingsraum zum Einsatz. Dieser findet in vielen Schulen Deutschlands seinen Platz. Dabei ist jedoch aus Sicht der Sozialen Arbeit kritisch zu bewerten, ob der Trainingsraum den normativen Druck, den die Kontrollgesellschaft ohnehin schon ausdrückt, verstärkt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Annahmen zur Kontrollgesellschaft
- 2.1 Von der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft
- 2.2 Normalisierungsausgangslagen
- 3. Die Trainingsraummethode in der Praxis Schule vor dem Hintergrund der Kontrollgesellschaft
- 3.1 Schule innerhalb der Kontrollgesellschaft
- 3.2 Die Trainingsraummethode als Normalisierungstheorem im Setting Schule
- 3.2.1 Praktische Anwendung der Trainingsraum-Methode
- 3.3 Kritische Bewertung des Trainingsraums vor dem Hintergrund sozial schwacher Schüler in der Kontrollgesellschaft
- 4. Auftrag der Sozialen Arbeit vor dem Hintergrund sozial schwacher Schüler
- 4.1 Soziale Arbeit und ihr Auftrag
- 4.2 Lebensweltorientierung als Konzept der Sozialen Arbeit
- 5. Der Auftrag Sozialer Arbeit vor den Hintergrund der Trainingsraummethode - ein unterstützendes Angebot
- 5.1 Die Biografiearbeit als Alternative zum Trainingsraum
- 5.2 Fiktives Fallbeispiel Lena
- 5.3 Chance der Biografiearbeit als Methode der sozialen Arbeit und in Bezug auf Lena und sozial schwache Schüler
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Kontrollgesellschaft auf sozial schwache Schüler im Kontext der Schule und analysiert kritisch die Trainingsraummethode aus der Perspektive der Sozialen Arbeit. Die Zielsetzung ist es, die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Unterstützung sozial schwacher Schüler zu beleuchten und alternative Methoden wie die Biografiearbeit vorzustellen.
- Kontrollgesellschaft und ihre Auswirkungen auf Bildung
- Kritische Analyse der Trainingsraummethode in der Schule
- Der Auftrag der Sozialen Arbeit im Umgang mit sozial schwacher Schüler
- Lebensweltorientierung und Biografiearbeit als alternative Ansätze
- Soziale Exklusion und die Chancen der Teilhabe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den aktuellen Diskurs um Schulbildung in Deutschland dar und hebt die Bedeutung von Bildung für gesellschaftlichen Erfolg und Teilhabe hervor. Sie führt den Begriff der Kontrollgesellschaft ein und beschreibt die Herausforderungen für sozial schwache Schüler, die den gesellschaftlichen Erwartungen nicht entsprechen können. Die Arbeit untersucht kritisch die Trainingsraummethode und deren Bedeutung für sozial schwache Schüler im Kontext der Schule, wobei die Frage im Mittelpunkt steht, ob der Mensch in der Kontrollgesellschaft noch als Subjekt wahrgenommen wird und ob der Trainingsraum zur Objektivierung beiträgt.
2. Theoretische Annahmen zur Kontrollgesellschaft: Dieses Kapitel liefert einen theoretischen Rahmen, indem es die Kontrollgesellschaft und ihre Entwicklung aus der Disziplinargesellschaft beschreibt. Es erläutert den Begriff der Gouvernementalität und die Kontrollmechanismen der Kontrollgesellschaft. Die Normalisierungsausgangslage und die allgemeine Problematik der Arbeit werden dargelegt. Der Übergang von der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft wird detailliert beschrieben, wobei die Veränderungen in den Führungstechniken und die Verschiebung von Disziplin und Norm hin zu Flexibilität, Motivation und Selbststeuerung im Fokus stehen. Die Krise der Einschließungsmilieus und der Wandel von der Fabrik zum Unternehmen als verallgemeinerbares Modell neuer Kontrollformen werden analysiert.
3. Die Trainingsraummethode in der Praxis Schule vor dem Hintergrund der Kontrollgesellschaft: Dieses Kapitel analysiert die Trainingsraummethode im schulischen Kontext. Es wird die Schule als Institution innerhalb der Kontrollgesellschaft betrachtet und die Trainingsraummethode als Normalisierungstheorem im Setting Schule eingeordnet. Die praktische Anwendung der Methode wird beschrieben und kritisch bewertet. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen auf sozial schwache Schüler und die Frage, inwieweit der Trainingsraum den normativen Druck der Kontrollgesellschaft verstärkt und die Objektivierung des Menschen fördert.
4. Auftrag der Sozialen Arbeit vor dem Hintergrund sozial schwacher Schüler: Dieses Kapitel beleuchtet den Auftrag der Sozialen Arbeit im Kontext sozial schwacher Schüler. Es definiert die Rolle und die Aufgaben der Sozialen Arbeit und stellt die Lebensweltorientierung als ein relevantes Konzept vor. Es geht um die Unterstützung sozial schwacher Menschen und deren Bewahrung vor sozialer Exklusion. Die Lebensweltorientierung wird als Konzept der Sozialen Arbeit vorgestellt und in Bezug auf den Umgang mit sozial schwachen Schülern erläutert.
5. Der Auftrag Sozialer Arbeit vor den Hintergrund der Trainingsraummethode - ein unterstützendes Angebot: Dieses Kapitel diskutiert die Biografiearbeit als eine Alternative zur Trainingsraummethode. Ein fiktives Fallbeispiel veranschaulicht die Anwendung der Biografiearbeit und deren Chancen für sozial schwache Schüler. Es wird dargelegt, wie die Biografiearbeit den individuellen Bedürfnissen von Schülern gerecht werden und den Fokus auf die Stärken und Ressourcen der Schüler legen kann. Die Vorteile im Vergleich zur Trainingsraummethode werden herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Kontrollgesellschaft, Disziplinargesellschaft, Gouvernementalität, Soziale Arbeit, sozial schwache Schüler, Schule, Trainingsraummethode, Biografiearbeit, Lebensweltorientierung, soziale Exklusion, Selbststeuerung, Normalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Trainingsraummethode und ihre Auswirkungen auf sozial schwache Schüler im Kontext der Kontrollgesellschaft"
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht kritisch die Auswirkungen der Kontrollgesellschaft auf sozial schwache Schüler im schulischen Kontext. Im Fokus steht die Analyse der Trainingsraummethode und die Suche nach alternativen, unterstützenden Ansätzen der Sozialen Arbeit.
Welche Methoden werden in der Arbeit analysiert und verglichen?
Die Arbeit analysiert die Trainingsraummethode als Methode der Schulgestaltung im Kontext der Kontrollgesellschaft und vergleicht sie kritisch mit der Biografiearbeit als Ansatz der Sozialen Arbeit. Der Vergleich fokussiert auf die jeweiligen Auswirkungen auf sozial schwache Schüler.
Welche theoretischen Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den theoretischen Rahmen der Kontrollgesellschaft (Foucault), der Gouvernementalität und der Normalisierung. Im Kontext der Sozialen Arbeit wird das Konzept der Lebensweltorientierung herangezogen.
Wie wird die Kontrollgesellschaft in der Arbeit dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Kontrollgesellschaft als Weiterentwicklung der Disziplinargesellschaft, charakterisiert durch flexible Kontrollmechanismen, Selbststeuerung und die Internalisierung von Normen. Der Einfluss dieser Mechanismen auf die Schule und insbesondere auf sozial schwache Schüler wird detailliert untersucht.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit in dieser Arbeit?
Die Soziale Arbeit wird als wichtiger Akteur im Umgang mit sozial schwachen Schülern dargestellt. Ihre Aufgabe besteht darin, diese Schüler zu unterstützen und vor sozialer Exklusion zu schützen. Die Arbeit zeigt die Grenzen der Trainingsraummethode auf und präsentiert die Biografiearbeit als eine lebensweltorientierte Alternative.
Welche Kritikpunkte werden an der Trainingsraummethode geäußert?
Die Arbeit kritisiert die Trainingsraummethode im Kontext der Kontrollgesellschaft, da sie den normativen Druck verstärken und zur Objektivierung der Schüler beitragen kann. Besonders für sozial schwache Schüler wird eine negative Auswirkung befürchtet.
Was ist die Biografiearbeit und wie wird sie als Alternative dargestellt?
Die Biografiearbeit wird als lebensweltorientierte Methode der Sozialen Arbeit vorgestellt, die im Gegensatz zur Trainingsraummethode die individuellen Bedürfnisse und Ressourcen der Schüler in den Mittelpunkt stellt. Sie bietet eine Möglichkeit, die Stärken der Schüler zu fördern und sie in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Theoretische Annahmen zur Kontrollgesellschaft, Die Trainingsraummethode in der Schule, Auftrag der Sozialen Arbeit, Der Auftrag Sozialer Arbeit im Kontext der Trainingsraummethode und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Arbeit zusammengefasst.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Kontrollgesellschaft, Disziplinargesellschaft, Gouvernementalität, Soziale Arbeit, sozial schwache Schüler, Schule, Trainingsraummethode, Biografiearbeit, Lebensweltorientierung, soziale Exklusion, Selbststeuerung und Normalisierung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Pädagogen, Sozialarbeiter und alle, die sich mit den Herausforderungen der Schulbildung, der Sozialen Arbeit und den Auswirkungen der Kontrollgesellschaft auf vulnerable Gruppen auseinandersetzen.
- Quote paper
- Verena Morfeld (Author), 2017, Soziale Arbeit als Chance für sozial schwache Schüler vor dem Hintergrund der Schule innerhalb der Kontrollgesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388588