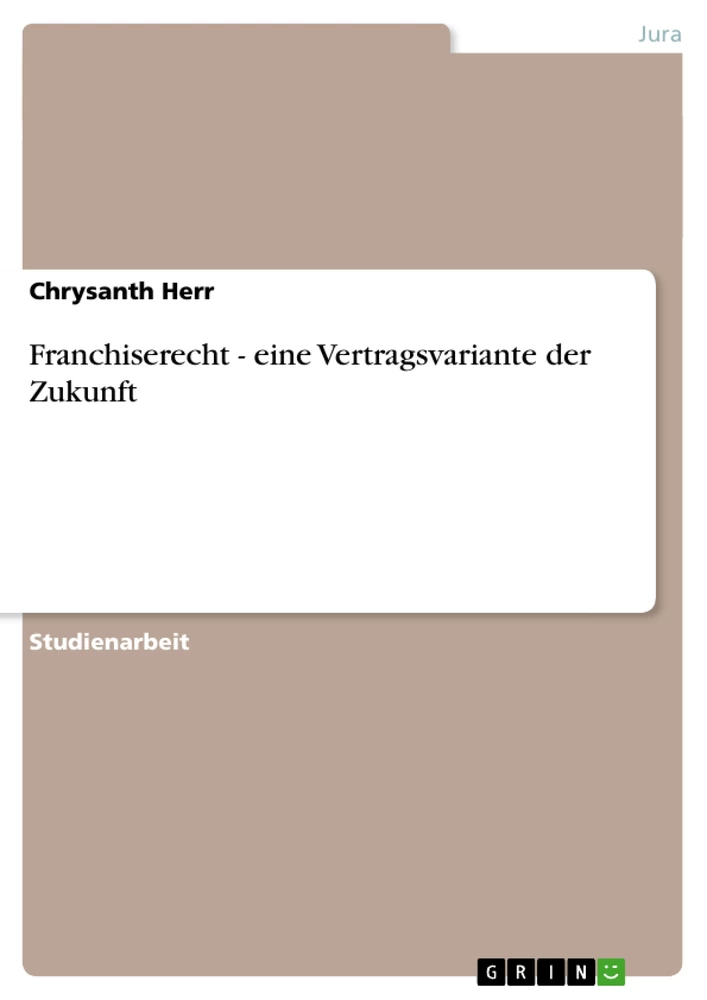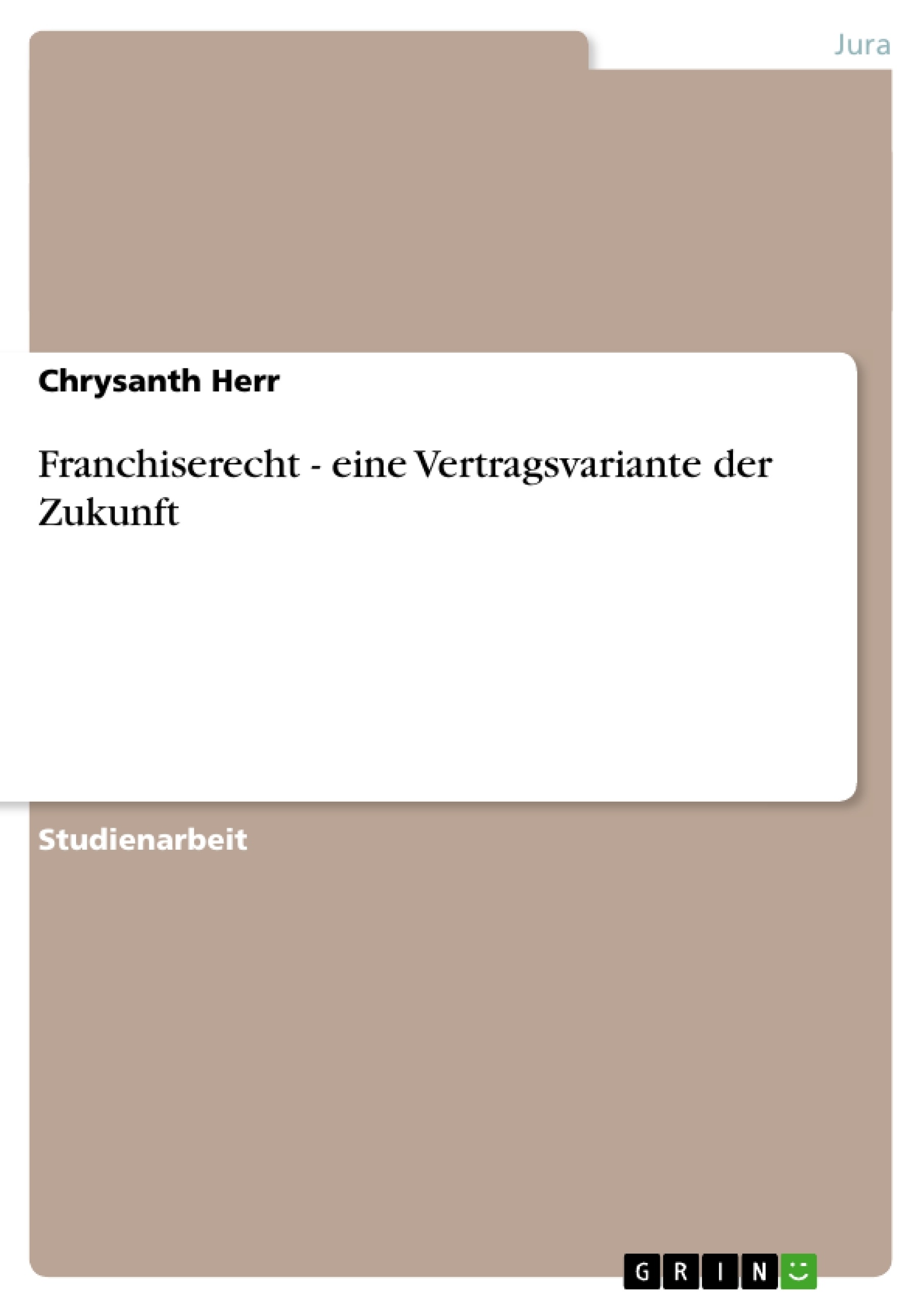Franchising ist „[…] aus dem Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken. Dennoch ist das Potential von Franchise und franchiseähnlichen Systemen in Deutschland bislang bei weitem noch nicht ausgeschöpft.“ Diese Aussage des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang Clement, zeigt sehr deutlich, dass die Relevanz von Franchising als Vertriebsform in der Zukunft weiter zunehmen wird. Schon heute ist Franchising mit 390.000 Beschäftigten (2003) und einem Gesamtumsatz von € 25,4 Mrd. (2003) ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland.1 Der Deutsche Franchiseverband (DFV) prognostiziert für 2005 Wachstumsraten bei der Beschäftigtenzahl von 6,5% p. a. und 9,5% p. a. für den Umsatz;2 das entspricht ca. 7.000 – 10.0003 neuen Franchisepartnerbetrieben im Jahr. Der Erfolg des Franchising als Vertriebsform resultiert aus den vielen Vorteilen sowohl für Franchisenehmer als auch für den Franchisegeber. Skalen- und Synergieeffekte können genutzt und die Wettbewerbsfähigkeit durch die Bündelung von Energien und Kräfte gesteigert werden.4 In einem Franchisesystem kann sich der Franchisenehmer auf seine Hauptaufgaben konzentrieren und wird zusätzlich vom fachkundigen und erfahrenen Franchisegeber beraten und unterstützt. Der Franchisegeber hingegen profitiert von der lokalen Kompetenz und dem hohen Engagement des Franchisenehmers. Die wachsende Internationalisierung, die kürzer werdenden Produktlebenszyklen, die hohen Marketingaufwendungen bei Produkteinführungen und die gestiegenen Anforderungen an das Know-how des Unternehmers lassen Franchising seit den 70er-Jahren immer wichtiger werden.5 Auch die Europäische Union (EU) erkannte diesen Prozess und förderte ihn zunächst durch die vom 01.02.1989 bis zum 31.12.1999 geltende EUGruppenfreistellungsverordnung für Franchise-Vereinbarungen6 (Franchise-GVO). Diese wurde am 1.1.2000 durch die EU-Gruppenfreistellungsverordnung für Vertikale Vertriebsbindung 7 (Vertikal-GVO) ersetzt und bildet mittlerweile die maßgebliche Richtlinie für den Franchisevertrag.8 [...] 1 Deutscher Franchise Verband (2005 a), S. 1. 2 Deutscher Franchise Verband (2005 b), S. 1. 3 Vgl. Peckert/Kiewitt/Klapperich/Schindler (2004), S. 8. 4 Vgl. Giesler/Nauschütt (2002), S. 3. 5 Vgl. Martinek (2003), S. 478f. 6 EG-Amtsblatt Nr. L 359/52. 7 EG-Amtsblatt. L 336, 221. 8 Vgl. Flohr (2002), S. 1.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Begriffliche Definitionen des Franchising
- 2.2 Typologien der Franchisesysteme
- 3 Das Franchisevertragsverhältnis
- 3.1 Der Franchisevertrag
- 3.1.1 Gesetzliche Grundlagen für Franchiseverträge
- 3.1.2 Rechtsnatur
- 3.1.3 Aufbau und Inhalt
- 3.1.4 Abgrenzung zu anderen Vertriebsverträgen
- 3.2 Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
- 3.2.1 Vorvertragliche Pflichten
- 3.2.2 Haupt- und Nebenpflichten der Vertragspartner
- 3.2.3 Nachvertragliche Pflichten
- 3.3 Beispielhafte Vertragsregelungen in der Praxis
- 3.1 Der Franchisevertrag
- 4 Entwicklung und Kritik
- 4.1 Prognostizierte Entwicklung
- 4.2 Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Analyse von Franchiseverträgen und untersucht deren Relevanz und Zukunft im Wirtschaftsleben. Der Fokus liegt dabei auf der Erörterung der rechtlichen Grundlagen, der Gestaltungsmöglichkeiten und der Chancen und Risiken des Franchising-Modells. Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis für die Funktionsweise von Franchiseverträgen zu vermitteln und deren Bedeutung als Vertriebsform zu beleuchten.
- Rechtliche Grundlagen und Gestaltungsmöglichkeiten von Franchiseverträgen
- Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im Franchiseverhältnis
- Vorteile und Nachteile des Franchising-Modells für Franchisenehmer und Franchisegeber
- Aktuelle Entwicklungen und Prognosen für das Franchising in Deutschland
- Kritische Würdigung des Franchising-Modells
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Relevanz des Franchising als Vertriebsform und geht auf die Bedeutung des Franchisevertrags ein.
Kapitel 2: Grundlagen
In diesem Kapitel werden die grundlegenden Definitionen des Franchising erläutert und verschiedene Typologien von Franchisesystemen vorgestellt.
Kapitel 3: Das Franchisevertragsverhältnis
Das dritte Kapitel widmet sich dem Franchisevertrag selbst. Hier werden die rechtlichen Grundlagen, die Rechtsnatur, der Aufbau und Inhalt sowie die Abgrenzung zu anderen Vertriebsverträgen erörtert. Darüber hinaus werden die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im Detail beleuchtet.
Kapitel 4: Entwicklung und Kritik
Das letzte Kapitel befasst sich mit der Entwicklung und Kritik des Franchising-Modells. Die prognostizierte Entwicklung des Franchising und die kritische Würdigung des Modells werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Franchisevertrag, Franchising, Vertriebsform, Franchisegeber, Franchisenehmer, Rechtliche Grundlagen, Rechtsnatur, Vertragsgestaltung, Rechte und Pflichten, Entwicklung, Kritik, Prognose.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Franchising?
Franchising ist eine Vertriebsform, bei der ein Franchisegeber einem Franchisenehmer gegen Gebühr die Nutzung eines Geschäftskonzepts, Namens und Know-hows erlaubt.
Welche rechtliche Grundlage gilt für Franchiseverträge in der EU?
Maßgeblich ist heute die EU-Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vertriebsbindungen (Vertikal-GVO).
Welche Pflichten hat ein Franchisegeber?
Der Franchisegeber muss den Nehmer beraten, unterstützen, das Know-how bereitstellen und die Marke weiterentwickeln.
Was sind vorvertragliche Aufklärungspflichten?
Der Franchisegeber ist verpflichtet, den potenziellen Partner umfassend über die Rentabilität und Risiken des Systems aufzuklären, bevor der Vertrag unterzeichnet wird.
Welche Vorteile bietet Franchising für den Franchisenehmer?
Der Nehmer profitiert von einer etablierten Marke, Synergieeffekten beim Einkauf und Marketing sowie einem bewährten Geschäftsmodell.
- Citar trabajo
- Chrysanth Herr (Autor), 2005, Franchiserecht - eine Vertragsvariante der Zukunft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38926