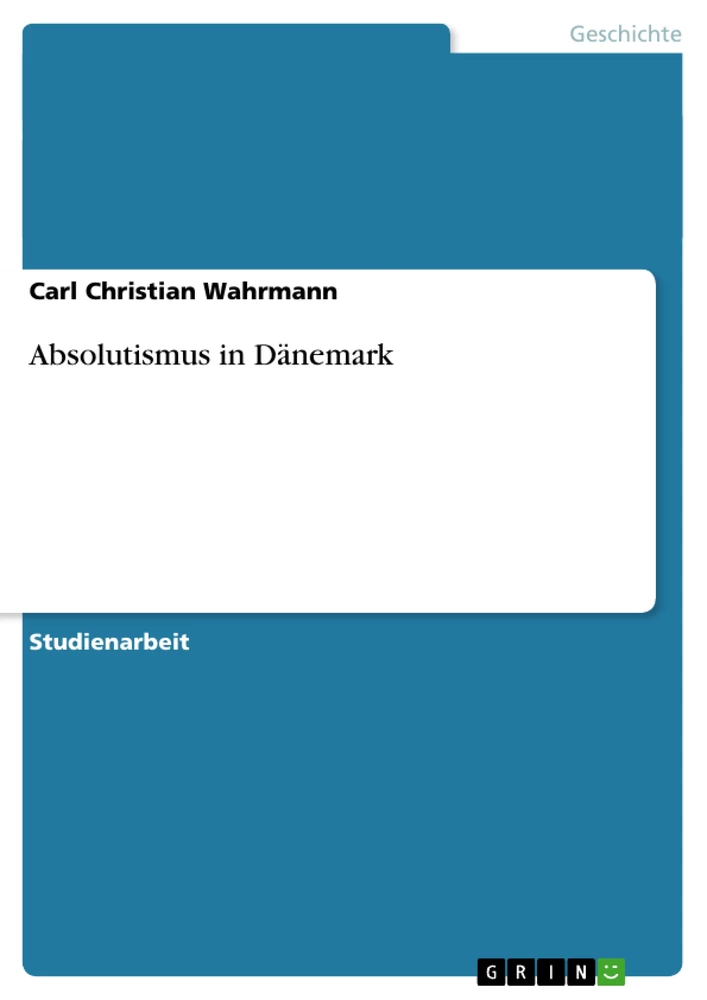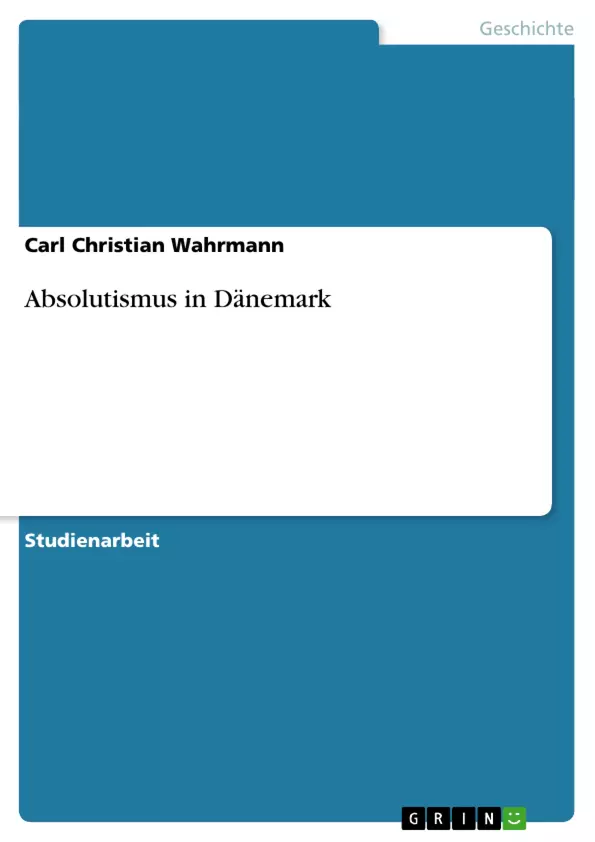Vielen Menschen erscheint noch immer Frankreich als das klassische Land des Absolutismus, Ludwig XIV. als der Prototyp des absoluten Herrschers, der, unabhängig von menschlichen Gesetzen, alle Macht im Staate in seinen Händen vereint. Dass die Regierungsfreiheit dieses Königs in vielen Fällen durch ständische Elemente eingeschränkt war, wird dabei häufig übersehen.
Ihre „absolute“ Stellung im Land mussten sich alle europäischen Monarchen über längere Zeiträume hinweg erkämpfen und nicht immer hatte der Anspruch legibus solutus eine reale Grundlage.
Eine Ausnahme bildet Dänemark. Bis ins 17. Jahrhundert hinein war Dänemark der politisch bedeutsamste Staat im Ostseeraum. Die Regierung teilte sich der König mit einem Reichsrat, der aus Mitgliedern der einflussreichsten Familien bestand. Durch die Kontrolle des Sundes und die damit verbundenen Zölle standen der Krone umfangreiche Finanzquellen zur Verfügung. Auch territorial war Dänemark ein bedeutender Machtfaktor. Das Königreich Norwegen war mit Dänemark verbunden, Gotland und Ösel gehörten ebenso zum Reich wie die wirtschaftlich bedeutenden Heringsmärkte im heutigen Südschweden. Durch außenpolitische Niederlagen wurde das Reich schwer erschüttert. Die Mehrheit der sich 1660 in Kopenhagen einfindenden Ständevertreter war der Ansicht, dass eine dauerhafte Konsolidierung des Staates nur durch eine entscheidende Machtverschiebung zugunsten des Königs zu erreichen sei. Mit dem Königsgesetz (Lex Regia) wurde König Friedrich III. alle Gewalt im Staate übertragen und der Absolutismus, einmalig in der historischen Entwicklung, offiziell eingeführt.
In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie Dänemark nach einer Zeit des außenpolitischen Machtverfalls den Weg von einem Wahlreich, in dem sich der König die Macht mit den Ständen teilte, zu einer Erbmonarchie fand, in der alle Herrschaft dem König zufiel. Welche Gründe sprachen für oder gegen die Übertragung der Staatsgewalten auf den Monarchen, wie setzte sich der Absolutismus im Land durch und wie war es möglich, dass das Staatsgrundgesetz der Lex Regia fast 300 Jahre Gültigkeit besaß?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die dänische Großmacht bis zum Frieden von Roskilde 1658
- Theoretische Grundlagen – Jean Bodin und Thomas Hobbes
- Die Erb- und Alleinherrschaftsakte von 1661
- Die Lex Regia von 1665
- Ergebnis und Ausblick
- Quellen und Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Dänemark nach einer Phase außenpolitischen Machtverfalls vom Wahlreich zu einer Erbmonarchie mit absolutem König wurde. Sie analysiert die Gründe für und gegen die Übertragung der Staatsgewalten auf den Monarchen, beschreibt den Weg des Absolutismus im Land und untersucht die Langlebigkeit der Lex Regia.
- Die Entwicklung Dänemarks vom dominierenden Ostseestaat zum schwachen Militärmacht im 17. Jahrhundert
- Die Rolle von König Christian IV. und die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges
- Die Einführung der Erb- und Alleinherrschaftsakte und die damit verbundene Machtverschiebung zum König
- Die Bedeutung der Lex Regia als Staatsgrundgesetz und die Herausforderungen für den dänischen Adel
- Die historische Bedeutung des dänischen Absolutismus für die politische und gesellschaftliche Entwicklung des Landes
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Bedeutung von Dänemark als Beispiel für den Absolutismus in Europa heraus und definiert den Forschungsgegenstand der Arbeit.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die dänische Großmacht im Ostseeraum bis zum Frieden von Roskilde 1658. Es analysiert die politische und militärische Schwäche Dänemarks im Vergleich zu Schweden und die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges.
- Kapitel drei betrachtet die theoretischen Grundlagen des Absolutismus anhand der Werke von Jean Bodin und Thomas Hobbes. Es untersucht, inwiefern deren Ideen auf die Entwicklung des Absolutismus in Dänemark Einfluss hatten.
- Kapitel vier beschäftigt sich mit der Einführung der Erb- und Alleinherrschaftsakte von 1661, die eine entscheidende Machtverschiebung zugunsten des Königs markierten. Es beleuchtet die Motive und Ziele der Akte sowie die Reaktion des Adels.
- Kapitel fünf analysiert die Lex Regia von 1665 als Staatsgrundgesetz, das die absolute Herrschaft des Königs festigte. Es untersucht die Auswirkungen der Lex Regia auf die politische und soziale Ordnung Dänemarks.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit fokussiert auf den dänischen Absolutismus, die Erb- und Alleinherrschaftsakte, die Lex Regia, König Friedrich III., den dänischen Adel, die Rolle des Reichsrats, den Dreißigjährigen Krieg, die schwedische Macht, die politische und gesellschaftliche Entwicklung Dänemarks.
- Citar trabajo
- M.A. Carl Christian Wahrmann (Autor), 2004, Absolutismus in Dänemark, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39490