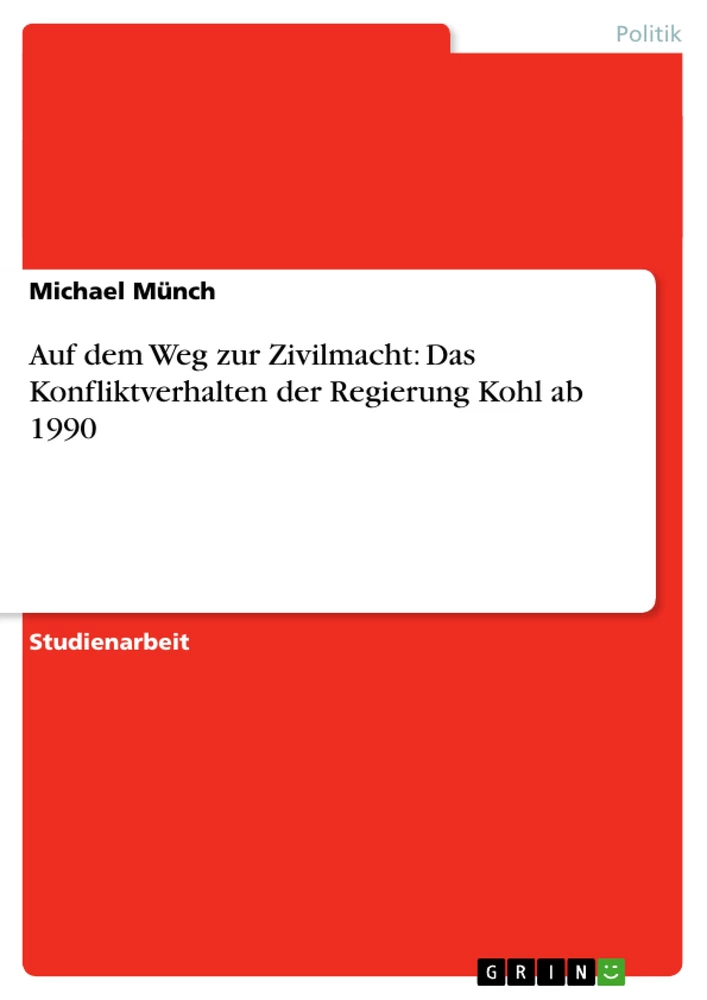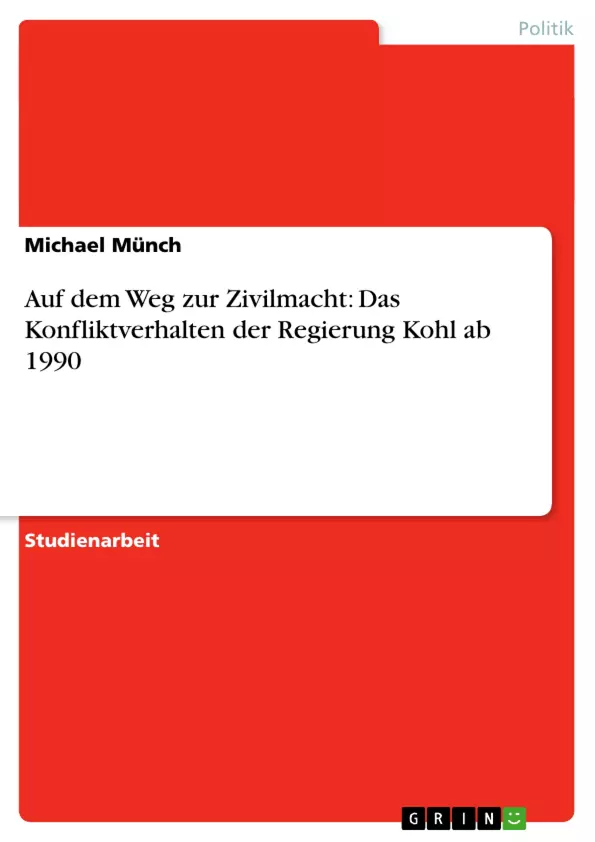„Nie wieder Krieg“ – dies war für die bundesdeutsche Außenpolitik vielleicht die bestimmendste Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Pazifistische Friedensbewegungen, Skepsis gegenüber militärischen Mitteln sowie Politiker, die befürchteten durch eine einzige falsche Entscheidung den Schritt zurück zum Militarismus zu gehen bestimmten jahrzehntelang das Öffentlichkeitsbild in Deutschland. Doch die Geschichte hat gezeigt: Ein Viertes Reich kam nicht. Auch die erwartete machtpolitische und militärische Dominanz eines wiedervereinigten Deutschland innerhalb Europas blieb aus.
Gedankengänge, wie die von Franz Josef Strauß, wonach jedem Deutschen die Hand abfallen solle, „der noch einmal ein Gewehr in die Hand nehme“ , stellten sich bereits während des Kalten Krieges und auch nach dessen Ende aufgrund neuer Herausforderungen als unpraktikabel und überzogen heraus. Doch wie konnte sich die Bundesrepublik in Zukunft (erfolgreich) in das internationale Konfliktmanagement einbringen? Hanns Maull stellte hierfür 1992 vierzehn Thesen auf, wonach Deutschland sich außenpolitisch als Zivilmacht etablieren muss, um an internationalem Einfluss zu gewinnen. Hierzu gehört z.B. der Gestaltungswille sich für eine Verrechtlichung der internationalen Beziehungen einzusetzen, ohne jedoch bei Konflikten auf die Androhung sowie Durchsetzung wirtschaftlicher Sanktionen und militärischer Mittel zu verzichten . Forderungen, mit denen sich die politische Führung Deutschlands seit 1990 in nahezu jedem Jahr neu auseinandersetzen musste.
Thema dieser Arbeit soll es sein das Konfliktverhalten der Regierung Kohl im Zeitraum von 1990 bis 1998 näher zu untersuchen. Maull konstatierte 1992, dass die BRD ihrer Rolle als Zivilmacht noch nicht gerecht werden konnte. Dies impliziert, dass bis zu diesem Zeitpunkt von den Verantwortlichen außenpolitische Fehler begangen wurden. Wie lässt sich dieses Fehlerverhalten beschreiben und inwieweit hätte es vielleicht vermieden werden können? Darüber hinaus soll geklärt werden, ob innerhalb der politischen Führungsriege Deutschlands ein Lern- und Entwicklungsprozess eingesetzt hat. Falls ja, wohin führte dieser bis 1998 und ließ er die BRD außenpolitisch an Gewicht gewinnen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Aufbau
- Forschungsstand
- Der Zweite Golfkrieg
- Die Ausgangssituation
- Das außenpolitische Umfeld
- Innenpolitische Debatten
- Deutschlands Sonderweg
- Der Jugoslawienkrieg
- Die Ausgangssituation
- Die deutsche Führungsrolle
- Deutscher Unilateralismus
- Der Rückzug aus der Verantwortung
- Die Somaliakatastrophe
- Die Ausgangssituation
- Deutsches Engagement
- Folgen für die deutsche Außenpolitik
- Der Kosovokrieg
- Die Ausgangssituation
- Erste Lösungsansätze
- Die Notwendigkeit einer humanitären Intervention
- Völkerrechtliche Bewertung des Bundestagsbeschlusses
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konfliktverhalten der Regierung Kohl im Zeitraum von 1990 bis 1998 und analysiert, inwieweit die Bundesrepublik in dieser Zeit ihrer Rolle als Zivilmacht gerecht werden konnte. Das zentrale Anliegen ist es, das Fehlerverhalten der deutschen Außenpolitik in verschiedenen internationalen Krisen zu beschreiben und zu erforschen, ob ein Lernprozess innerhalb der politischen Führungsriege stattfand. Die Arbeit untersucht die deutsche Beteiligung an vier wichtigen Konflikten: dem Zweiten Golfkrieg, dem Jugoslawienkrieg, der Somaliakatastrophe und dem Kosovokrieg.
- Die Rolle Deutschlands im internationalen Konfliktmanagement
- Die Debatte um die Zivilmacht Deutschlands und die Kritik an der Scheckbuchdiplomatie
- Die deutsche Führungsrolle und die Herausforderungen des Unilateralismus
- Die innenpolitischen Debatten um den Einsatz von Militär und die Verfassungsrechtlichen Grenzen
- Die völkerrechtliche Bewertung der deutschen Außenpolitik in den jeweiligen Konflikten
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel widmet sich dem Zweiten Golfkrieg und analysiert den Vorwurf der Scheckbuchdiplomatie gegenüber Deutschland. Es wird diskutiert, ob das Ausland die Rolle der Bundesrepublik falsch bewertete und inwieweit Deutschland durch seine Rolle als „Global Balancer\" zwischen den beiden ehemaligen Blockstaaten bereits ausgelastet war.
Im dritten Kapitel steht der Jugoslawienkrieg im Mittelpunkt. Die Arbeit untersucht die deutsche Bereitschaft zur Übernahme der außenpolitischen Führungsrolle und analysiert die Gründe für das Scheitern einer politischen Lösung. Darüber hinaus befasst sich das Kapitel mit den Vorwürfen, Deutschland habe die serbischen Aggressionen selbst provoziert.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Hungerkatastrophe in Somalia von 1992/93 und fokussiert neben den Hilfsmaßnahmen Deutschlands insbesondere auf die innenpolitische Situation. Es wird untersucht, inwieweit die Bundesrepublik sich bei der Verwendung von militärischen Mitteln außerhalb des NATO-Gebietes selbst blockierte und die Somaliakatastrophe zur Grundgesetzdebatte führte.
Der Kosovo-Konflikt wird im fünften Kapitel behandelt. Hier wird die Entscheidung der Regierung Kohl zu einem nicht durch den UN-Sicherheitsrat mandatierten NATO-Einsatz analysiert. Die Arbeit untersucht, ob die Bundesrepublik sich völkerrechtskonform verhielt oder ob sie sich an einem illegalen Angriffskrieg gegen Serbien beteiligte.
Schlüsselwörter
Zivilmacht, Konfliktverhalten, Regierung Kohl, Scheckbuchdiplomatie, Global Balancer, Jugoslawienkrieg, Somaliakatastrophe, Kosovokrieg, Völkerrecht, Grundgesetzdebatte, NATO-Einsatz, außenpolitische Führungsrolle, Unilateralismus, innenpolitische Debatten, deutsche Außenpolitik, Fehlerverhalten, Lernprozess, internationale Krisenmanagement
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "Zivilmacht" im Kontext deutscher Außenpolitik?
Eine Zivilmacht strebt die Verrechtlichung internationaler Beziehungen an und setzt primär auf nicht-militärische Mittel, verzichtet aber nicht gänzlich auf Sanktionen oder Militär zur Durchsetzung von Ordnung.
Welche Konflikte werden in der Regierungszeit Kohl (1990-1998) untersucht?
Die Arbeit analysiert das deutsche Verhalten im Zweiten Golfkrieg, im Jugoslawienkrieg, in der Somaliakatastrophe und im Kosovokrieg.
Was war die Kritik an der sogenannten "Scheckbuchdiplomatie"?
Deutschland wurde vorgeworfen, sich durch finanzielle Leistungen von einer aktiven militärischen oder politischen Verantwortung in internationalen Krisen freizukaufen.
Welche Rolle spielte der Kosovokrieg für die deutsche Außenpolitik?
Er markierte einen Wendepunkt, da sich Deutschland erstmals an einem NATO-Einsatz ohne UN-Mandat beteiligte, was zu intensiven völkerrechtlichen und innenpolitischen Debatten führte.
Gab es unter der Regierung Kohl einen außenpolitischen Lernprozess?
Die Arbeit untersucht, ob Deutschland von der anfänglichen Zurückhaltung (Scheckbuchdiplomatie) hin zu einer aktiveren Rolle im internationalen Krisenmanagement fand.
- Citation du texte
- Michael Münch (Auteur), 2004, Auf dem Weg zur Zivilmacht: Das Konfliktverhalten der Regierung Kohl ab 1990, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40291