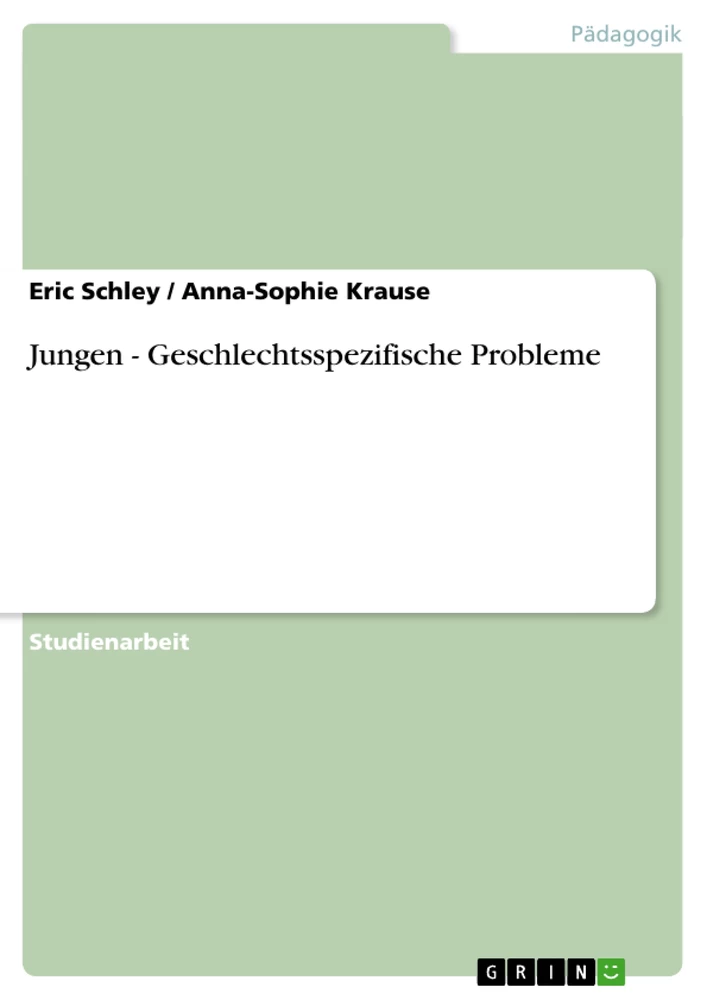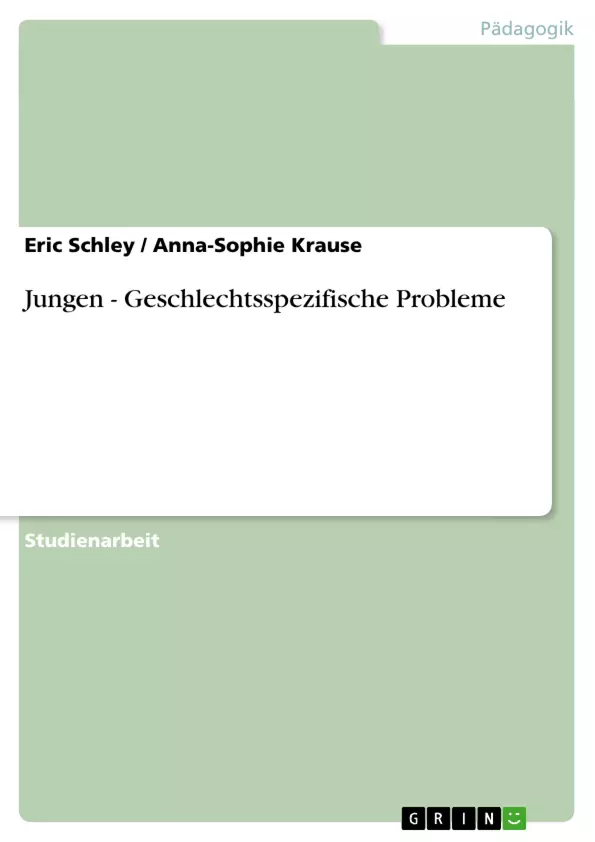Nach unseren gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen sind Jungen und Männer stark, unabhängig, kompetent, kontrolliert und dominant. „Wenn ein Mann so nicht ist, dann ist er ein Weichling, ein Sonderling oder ein Schwuler“ (Lenz 1996, 169).
Die Ergebnisse der letzten PISA-Studie, wonach Jungen weit hinter den Mädchen zurückbleiben, ließen uns zweifeln ob diese Zuschreibungen nicht ihre Passform verloren haben. Sind Jungen nur in der Schule schwach, oder muss man sich generell mit dem männlichen Rollenbild auseinandersetzen?
Zu beginn dieser Arbeit wurden Erkenntnisse der Geschlechterforschung vorangestellt, um auf dieser Grundlage männliche Identitätsarbeit besser verstehen zu können. Im Verlauf der Arbeit wird sich auf ausgewählte Problemfelder beschränkt.
Als möglichen Lösungsansatz für diese geschlechtsspezifischen Probleme möchten wir Jungenarbeit, als ein noch relativ unbekanntes und bisher vernachlässigtes Handlungsfeld der Sozialen Arbeit, aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Erik H. Eriksons Identitätsmodell
- Geschlechterrollen
- Männlich, weiblich - Was ist Geschlecht?
- Männlichkeit
- Jungenprobleme
- Schule, „Die Schwäche der Starken“
- Krank sein als Fremdwort - physische und psychische Krankheiten von Jungen
- Sexueller Missbrauch an Jungen
- Was Jungen stark macht - Jungenarbeit
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Autoren untersuchen die Problematik der männlichen Identitätsentwicklung und die Frage, inwieweit sich die traditionelle Rolle des Mannes im modernen Kontext als problematisch erweist. Die Analyse basiert auf Eriksons Identitätsmodell und beleuchtet die Schwierigkeiten, die Jungen im Bildungssystem, im Gesundheitswesen und im Umgang mit ihrer eigenen Sexualität erleben.
- Identitätsentwicklung im Spannungsfeld zwischen individueller Selbstfindung und gesellschaftlichen Erwartungen
- Kritik an traditionellen männlichen Rollenbildern und deren Auswirkungen auf Jungen
- Geschlechtsspezifische Herausforderungen in der Bildung, im Umgang mit Krankheit und im Kontext sexueller Übergriffe
- Jungenarbeit als möglicher Lösungsansatz für die besonderen Bedürfnisse von Jungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt Eriksons Identitätsmodell vor und analysiert die Bedeutung des psychosozialen Moratoriums für die Identitätsbildung. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition von Geschlecht und den traditionellen Rollenzuschreibungen an Männer. Das dritte Kapitel untersucht verschiedene Problemfelder, mit denen Jungen konfrontiert sind, wie z. B. die schulische Leistung, den Umgang mit Krankheit und den sexuellen Missbrauch.
Schlüsselwörter
Männliche Identitätsentwicklung, Geschlechterrollen, Eriksons Identitätsmodell, psychosoziales Moratorium, Jungenarbeit, Bildung, Gesundheit, sexueller Missbrauch.
Häufig gestellte Fragen
Welche geschlechtsspezifischen Probleme haben Jungen heute?
Jungen fallen häufig durch schulische Schwächen, eine höhere Anfälligkeit für physische und psychische Krankheiten sowie Schwierigkeiten bei der Identitätsbildung auf.
Warum gelten Jungen oft als „Bildungsverlierer“?
PISA-Studien zeigen, dass Jungen im Lesen und in der sprachlichen Kompetenz oft hinter Mädchen zurückbleiben, was teilweise auf mangelnde Passung der Rollenbilder im Schulsystem zurückgeführt wird.
Was ist das Ziel der Jungenarbeit?
Jungenarbeit möchte Jungen dabei unterstützen, ein vielfältiges Männlichkeitsbild zu entwickeln, das über Stärke und Dominanz hinausgeht, und soziale Kompetenzen stärken.
Wie wirkt sich das traditionelle Männerbild auf die Gesundheit aus?
Das Ideal des „starken Mannes“ führt oft dazu, dass Jungen Krankheitssymptome ignorieren und psychische Probleme nicht rechtzeitig kommunizieren.
Was versteht Erikson unter einem „psychosozialen Moratorium“?
Es ist eine Phase in der Jugend, in der Individuen ohne vollen gesellschaftlichen Druck verschiedene Rollen ausprobieren können, um ihre Identität zu finden.
- Citation du texte
- Eric Schley (Auteur), Anna-Sophie Krause (Auteur), 2004, Jungen - Geschlechtsspezifische Probleme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40946