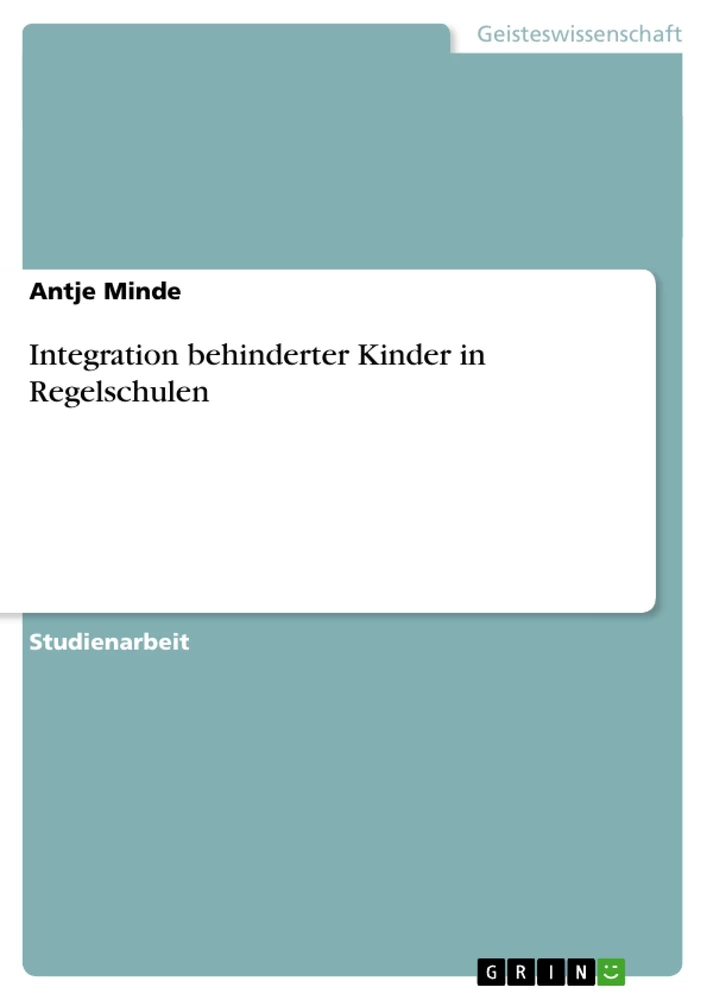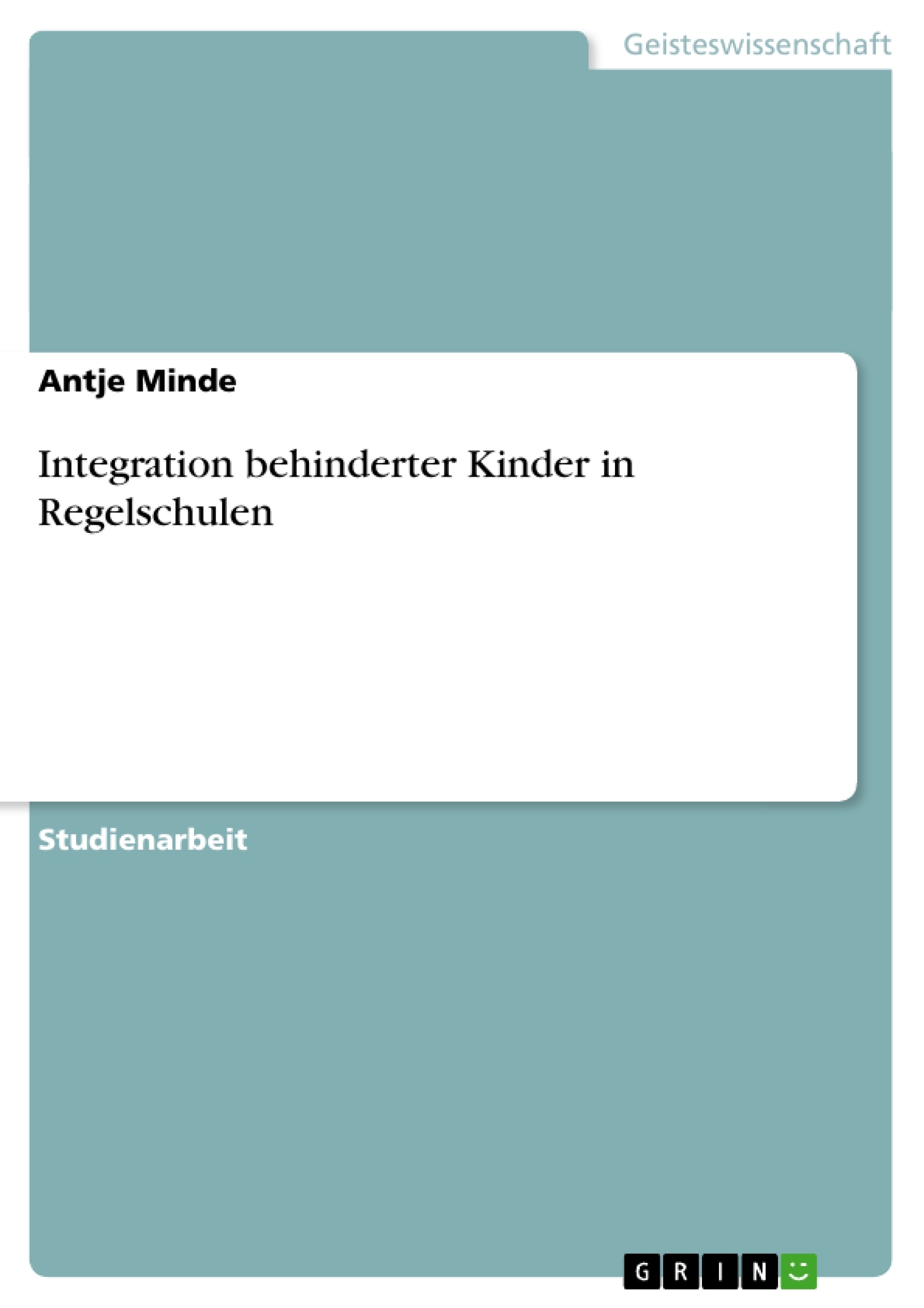Behinderte Menschen gehören in unserer Gesellschaft einer Randgruppe an, die größtenteils Isolierung erfährt und meist lebenslang benachteiligt ist. Aber gerade in der heutigen Zeit, die für Toleranz, Gleichberechtigung und Aufgeschlossenheit steht, sollte es möglich sein, diese Menschen in die verschiedenen Bereiche des Lebens zu integrieren, wie z. B. in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in Erziehungseinrichtungen. Wichtig ist dabei, die Behinderten nicht nur am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen, sondern ihnen das subjektive Gefühl des Integriertseins, des Geachtetseins, zu vermitteln. Unter Integration ist kein Prozess zu verstehen, der einseitig die Anpassung der gehandicapten Menschen an die Normen der „normalen“ Bevölkerung fordert, stattdessen ist eine aktive Beteilung, keine passive Eingliederung, der Behinderten gewünscht.
Ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit mit behinderten Menschen sind die Integrationsansätze in Regelschulen. Sicherlich werden auch in Zukunft die Sonderschulen mit ihren spezifischen Förderprogrammen an Bedeutung nicht verlieren, dennoch gibt es seit einigen Jahren den Anspruch, behinderte Schüler in einer Regelschule zu unterrichten. Um einen Einstieg in das Thema der gemeinsamen Erziehung zu geben, wird zunächst auf die Gründe für eine Integration eingegangen, um dann zwei Schulmodelle vorzustellen, die den Integrationsansatz verkörpern, die integrativen Schulen und das additiv-kooperative Modell. Dabei werden nicht nur die Schulen charakterisiert, sondern anhand von Erfahrungsberichten, die vom Leben behinderter Schüler in den jeweiligen Regelschulen erzählen, versucht, ein genaueres Bild zu vermitteln. Das Kernstück der Abhandlung besteht aus den Meinungen, Ansichten und Verhaltensmerkmalen der drei an den Integrationsklassen direkt beteiligten Gruppen: den Schüler, Eltern und Lehrern. Nacheinander werden Probleme und Chancen, Vor- und Nachteile aufzeigt, die sich durch das gemeinsame Erziehen ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Warum Integration
- Integrative Schulmodelle
- Integrative Schulen
- Erfahrungsberichte geistigbehinderter Kinder in integrativen Schulen
- Additiv-kooperative Schulformen
- Erfahrungsbericht einer additiv-kooperativen Schule
- Integrative Schulen
- Schülerverhalten in Integrationsklassen
- Integrationsklassen aus Sicht der Eltern
- Integrationsklassen aus Sicht der Lehrer
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Integration behinderter Kinder in Regelschulen. Sie untersucht die Gründe für die Integration, stellt verschiedene Schulmodelle vor und analysiert die Erfahrungen von Schülern, Eltern und Lehrern in Integrationsklassen.
- Gründe für die Integration von Kindern mit Behinderungen in Regelschulen
- Verschiedene Schulmodelle, die die Integration von Kindern mit Behinderungen in Regelschulen ermöglichen
- Erfahrungen von Schülern, Eltern und Lehrern in Integrationsklassen
- Herausforderungen und Chancen der Integration
- Die Bedeutung von Inklusion und Toleranz im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Integration behinderter Kinder in Regelschulen vor und erläutert die Bedeutung von Inklusion und Toleranz in der heutigen Gesellschaft.
- Warum Integration?: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen und praktischen Aspekte der Integration. Es wird argumentiert, dass die Integration behinderter Kinder in Regelschulen ihnen die Möglichkeit bietet, ihre Behinderung zu akzeptieren und soziale Kontakte zu knüpfen.
- Integrative Schulmodelle: Dieses Kapitel stellt zwei verschiedene Schulmodelle vor, die die Integration von Kindern mit Behinderungen in Regelschulen ermöglichen: integrative Schulen und additiv-kooperative Schulformen. Es wird außerdem auf die Erfahrungen von Kindern mit Behinderungen in diesen Schulformen eingegangen.
- Schülerverhalten in Integrationsklassen: Dieses Kapitel analysiert das Verhalten von Schülern in Integrationsklassen und betrachtet die Herausforderungen und Chancen des gemeinsamen Lernens. Es wird auf die Interaktion zwischen behinderten und nichtbehinderten Schülern eingegangen.
- Integrationsklassen aus Sicht der Eltern: Dieses Kapitel beleuchtet die Perspektive der Eltern von Kindern mit Behinderungen auf die Integration in Regelschulen. Es werden die Erwartungen und Ängste der Eltern erörtert.
- Integrationsklassen aus Sicht der Lehrer: Dieses Kapitel betrachtet die Erfahrungen von Lehrern in Integrationsklassen. Es wird auf die Herausforderungen und Möglichkeiten des Unterrichts in Integrationsklassen eingegangen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter in dieser Arbeit sind: Integration, Inklusion, Toleranz, Behinderung, Regelschule, Sonderschule, integrative Schulen, additiv-kooperative Schulformen, Schülerverhalten, Elternperspektive, Lehrerperspektive.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Integration fordert oft die Anpassung des Einzelnen an das System, während Inklusion (im Text als aktive Beteiligung beschrieben) die Wertschätzung von Vielfalt als Norm ansieht.
Welche Schulmodelle für Integration gibt es?
Die Arbeit stellt integrative Regelschulen und das additiv-kooperative Modell vor, bei dem Sonderschulklassen teilweise in Regelschulen integriert werden.
Wie reagieren Schüler auf Integrationsklassen?
Die Arbeit analysiert das Verhalten von behinderten und nichtbehinderten Schülern und zeigt Chancen für soziales Lernen und den Abbau von Vorurteilen auf.
Welche Herausforderungen sehen Lehrer bei der Integration?
Lehrer stehen vor der Aufgabe, heterogene Lerngruppen individuell zu fördern, was oft spezifische Fortbildungen und zusätzliche Ressourcen erfordert.
Was ist die Sicht der Eltern auf integrative Beschulung?
Eltern erhoffen sich durch die Integration bessere soziale Kontakte für ihre Kinder und ein Gefühl des Geachtetseins in der Gesellschaft.
- Citar trabajo
- Antje Minde (Autor), 2005, Integration behinderter Kinder in Regelschulen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41132