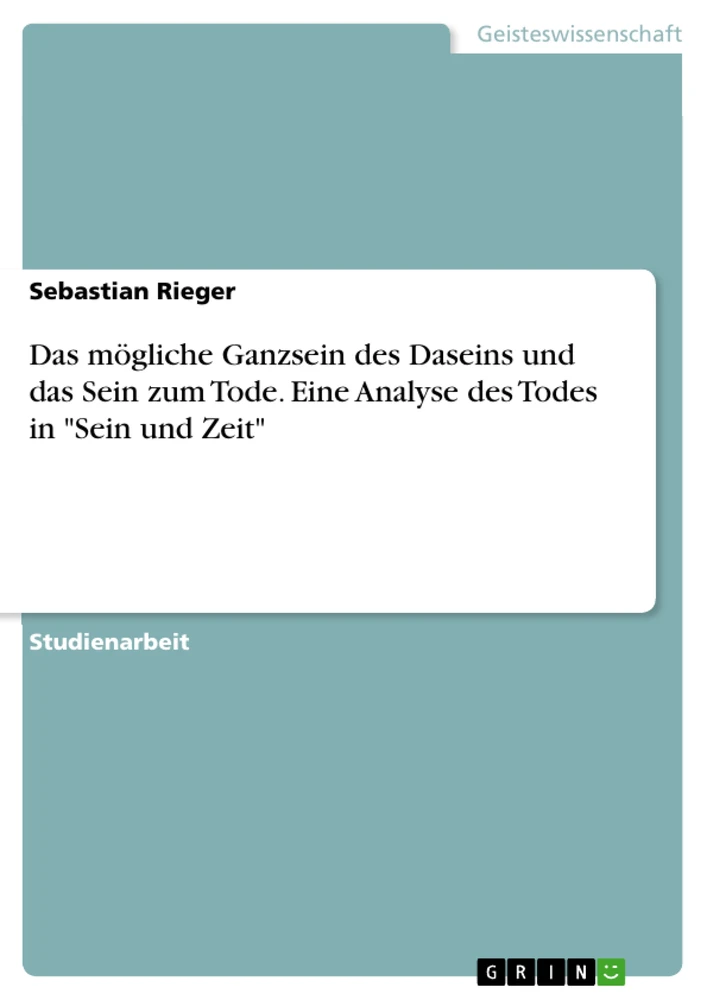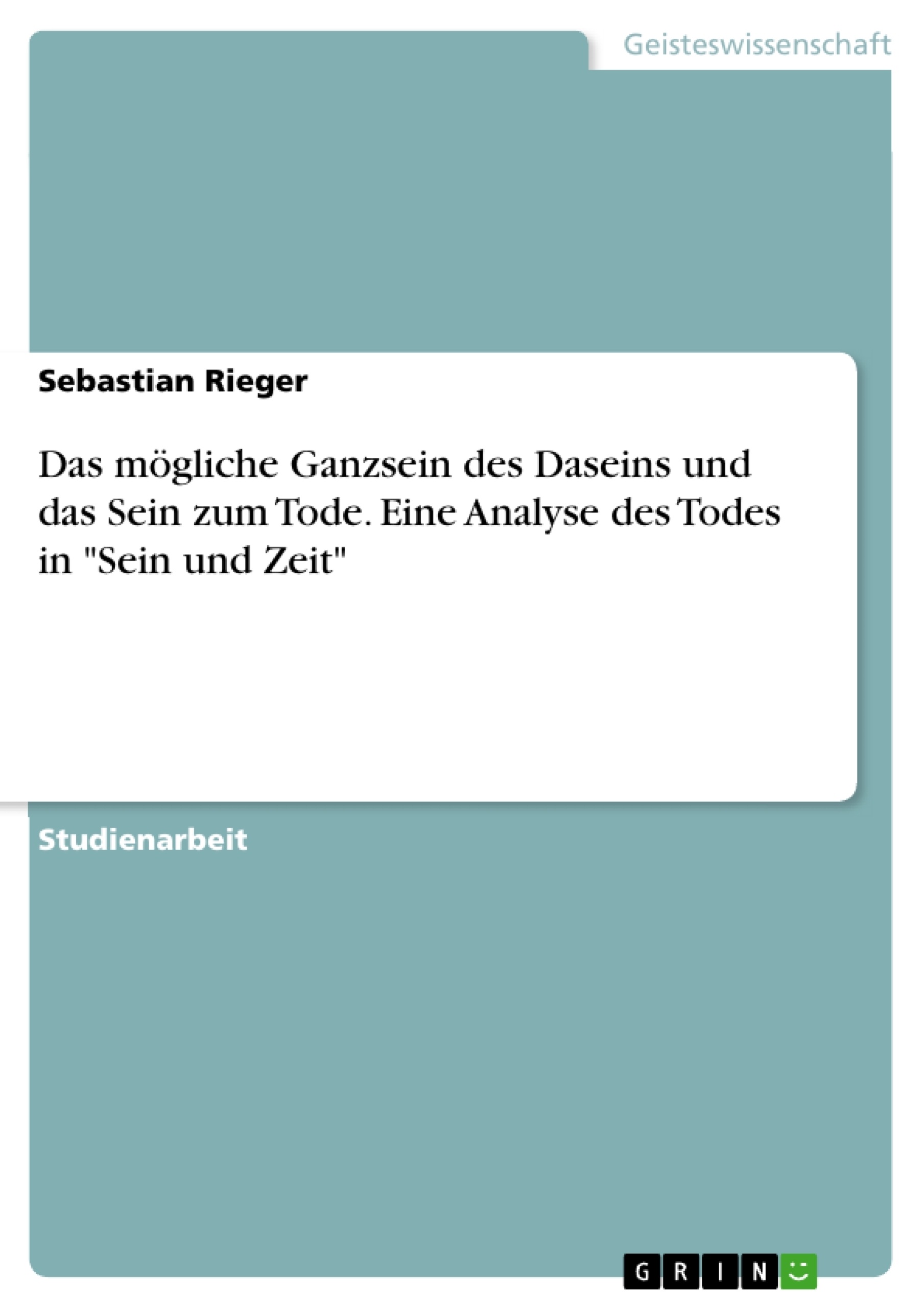Die Todesanalyse Heideggers findet sich im ersten Kapitel des zweiten Abschnitts von „Sein und Zeit“. Insofern kann ihr eine Scharnierfunktion zugesprochen werden: Sie nimmt einerseits Probleme, die im ersten Abschnitt auftauchen, auf und bereitet ihre Lösung vor. Andererseits ist die Analyse selbst von einiger Bedeutung, da sie einen neuartigen Blick auf den Tod liefert. Mit einer gewissen Berechtigung könnte behauptet werden, dass diese Analyse zwar eine Analyse des Todes ist, sie aber eigentlich als ein Zentralstück einer Philosophie des Lebens dienen könnte. Dies erklärt die Motivation für die vorliegende Arbeit. Da die Analyse des Todes sich in der Mitte von „Sein und Zeit“ findet, scheint eine kurze Zusammenfassung des ersten Teiles wie auch der Einleitung unumgänglich, um sie wirklich zu verstehen. Verschärft wird das Verständnisproblem noch dadurch, dass Heidegger Neologismen bildet, die sich häufig nicht von selbst verstehen. Insofern sei zunächst ein kurzer Abriss von „Sein und Zeit“ gegeben, in welchem die wichtigsten Begriffe in ihrem Gesamtzusammenhang vorgestellt werden. Heideggers zentrales Anliegen ist, die Frage nach dem Sinn von Sein zu stellen, d. h., eine neuartige Ontologie, die er Fundamentalontologie nennt, zu gründen. Die Frage nach dem Sinn von Sein könnte im ersten Moment als Frage: Was ist das Sein? verstanden werden. Gleichwohl verbietet sich dieses Verständnis, da „ist“ eine Konjugation des Infinitivs „sein“ ist. Folglich würde man eine petitio principii begehen, wenn die letztgenannte Frage gestellt würde. Sofern nun eine Frage gestellt wird, muss der Blick auf denjenigen gerichtet werden, welcher die Frage stellt, auch darum, weil derjenige, welcher die Frage stellt, natürlich über ein gewisses Vorverständnis des Fragebereichs verfügen muss. Der Fragesteller sind zunächst wir oder allgemeiner der Mensch. Heidegger spricht nun allerdings nicht vom Menschen, sondern stattdessen vom Dasein, vor allem, weil er vermeiden will, dass seine Schrift als Anthropologie verstanden wird. Wie schon gesagt, zeichnet sich das Dasein dadurch aus, dass es über ein Vorverständnis des Seins, was Heidegger auch durchschnittliches Seinsverständnis nennt, verfügt. Dieses Vorverständnis drückt sich darin aus, dass es dem Dasein in seinem Sein um sein Sein geht. Dem Dasein ist sein Sein nicht gleichgültig, es kümmert sich um sich.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 DER TOD IN SEIN UND ZEIT
- 2.1 DER TOD DER ANDEREN
- 2.2 DIE ANALYSE DES TODES AUS DER PERSPEKTIVE DER VERFALLENHEIT UND WAS VON EINER EXISTENZIALEN ANALYSE DES TODES NICHT ZU ERWARTEN IST
- 2.3 DIE EXISTENZIALE ANALYSE DES TODES
- 2.3.1 DER TOD IST DIE EIGENSTE MÖGLICHKEIT
- 2.3.2 DER Tod ist die UNBEZÜGLICHE MÖGLICHKEIT
- 2.3.3 DER TOD IST DIE UNÜBERHOLBARE MÖGLICHKEIT
- 2.3.4 DER TOD IST DIE GEWISSE MÖGLICHKEIT
- 2.3.5 DER TOD IST DIE UNBESTIMMTE MÖGLICHKEIT
- 3 RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Heideggers Todesanalyse in "Sein und Zeit". Ziel ist es, die Bedeutung dieser Analyse im Kontext des Gesamtwerks zu verstehen und ihren Beitrag zu einer Philosophie des eigentlichen Lebens herauszustellen. Die Arbeit berücksichtigt die komplexen Begriffe und den Kontext des ersten Abschnitts von "Sein und Zeit".
- Heideggers Konzept des Daseins und seine Beziehung zum Sein
- Die existenziale Analyse des Todes und ihre Bedeutung für das Verständnis des Daseins
- Die Unterscheidung zwischen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit des Daseins
- Die Rolle der Zeitlichkeit im Verständnis von Sein und Tod
- Die Relevanz von Heideggers Terminologie und deren Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung erläutert die zentrale Rolle von Heideggers Todesanalyse im zweiten Abschnitt von "Sein und Zeit". Sie beschreibt die Analyse als Scharnierpunkt, der Probleme des ersten Abschnitts aufgreift und für eine Philosophie des eigentlichen Lebens von Bedeutung ist. Die Einleitung begründet die Notwendigkeit einer kurzen Zusammenfassung des ersten Teils von "Sein und Zeit" aufgrund der komplexen Terminologie und des Kontextes der Todesanalyse. Sie skizziert Heideggers zentrales Anliegen, die Frage nach dem Sinn des Seins zu stellen und eine Fundamentalontologie zu gründen, sowie die Einführung des Begriffs "Dasein" um eine anthropologische Interpretation zu vermeiden.
2 DER TOD IN SEIN UND ZEIT: Dieses Kapitel taucht tief in Heideggers existenzielle Analyse des Todes ein. Es untersucht den Tod nicht als bloßes biologisches Ereignis, sondern als eine existenzielle Möglichkeit des Daseins. Die verschiedenen Unterkapitel beleuchten den Tod aus verschiedenen Perspektiven, beispielsweise als "eigenste Möglichkeit", "unbezügliche Möglichkeit" oder "gewisse Möglichkeit", um die einzigartige Beziehung des Daseins zum Tod zu ergründen. Die Analyse verwebt sich eng mit den Konzepten von Verfallenheit, Zeitlichkeit und der Unterscheidung zwischen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, um ein umfassendes Verständnis des Todes im Dasein zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf der ontologischen Bedeutung des Todes, nicht auf seiner phänomenologischen Beschreibung.
Schlüsselwörter
Sein und Zeit, Heidegger, Dasein, Tod, Existenzialontologie, Eigentlichkeit, Uneigentlichkeit, Zeitlichkeit, Verfallenheit, Sorge, Fundamentalontologie, Existenzial, Existenziell.
Heideggers Todesanalyse in "Sein und Zeit": Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Martin Heideggers existenzielle Analyse des Todes, wie sie in seinem Werk "Sein und Zeit" dargestellt wird. Der Fokus liegt auf der ontologischen Bedeutung des Todes und seiner Beziehung zum Dasein, nicht auf einer phänomenologischen Beschreibung.
Welche Aspekte von Heideggers "Sein und Zeit" werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den zweiten Abschnitt von "Sein und Zeit", der Heideggers Todesanalyse gewidmet ist. Sie behandelt zentrale Konzepte wie Dasein, Sein, Eigentlichkeit, Uneigentlichkeit, Zeitlichkeit und Verfallenheit. Ein kurzer Überblick über den ersten Abschnitt von "Sein und Zeit" wird gegeben, um den Kontext der Todesanalyse zu klären.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Heideggers Todesanalyse im Kontext seines Gesamtwerks zu verstehen und ihren Beitrag zu einer Philosophie des eigentlichen Lebens herauszustellen. Es soll die Bedeutung dieser Analyse für das Verständnis von Dasein und Sein aufgezeigt werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Heideggers Konzept des Daseins und seine Beziehung zum Sein; die existenzielle Analyse des Todes und ihre Bedeutung für das Verständnis des Daseins; die Unterscheidung zwischen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit des Daseins; die Rolle der Zeitlichkeit im Verständnis von Sein und Tod; und die Relevanz von Heideggers Terminologie und deren Interpretation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Der Tod in Sein und Zeit" mit Unterkapiteln zur Analyse des Todes aus verschiedenen Perspektiven) und ein Resümee. Die Einleitung erläutert die Bedeutung von Heideggers Todesanalyse und gibt einen kurzen Überblick über den ersten Abschnitt von "Sein und Zeit". Das Hauptkapitel untersucht die existenzielle Analyse des Todes detailliert. Das Resümee fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Sein und Zeit, Heidegger, Dasein, Tod, Existenzialontologie, Eigentlichkeit, Uneigentlichkeit, Zeitlichkeit, Verfallenheit, Sorge, Fundamentalontologie, Existenzial, Existenziell.
Wie wird der Tod in Heideggers Analyse verstanden?
Heidegger versteht den Tod nicht als ein bloßes biologisches Ereignis, sondern als eine existenzielle Möglichkeit des Daseins. Die Arbeit untersucht den Tod aus verschiedenen Perspektiven (z.B. als "eigenste Möglichkeit", "unbezügliche Möglichkeit", "gewisse Möglichkeit"), um die einzigartige Beziehung des Daseins zum Tod zu ergründen.
Welche Bedeutung hat die Todesanalyse für Heideggers Philosophie?
Heideggers Todesanalyse ist ein zentraler Punkt in seinem Werk und trägt maßgeblich zu seinem Verständnis von Dasein und Sein bei. Sie ist ein Scharnierpunkt, der Probleme des ersten Abschnitts von "Sein und Zeit" aufgreift und für eine Philosophie des eigentlichen Lebens von Bedeutung ist.
- Citar trabajo
- Sebastian Rieger (Autor), 2018, Das mögliche Ganzsein des Daseins und das Sein zum Tode. Eine Analyse des Todes in "Sein und Zeit", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/411967