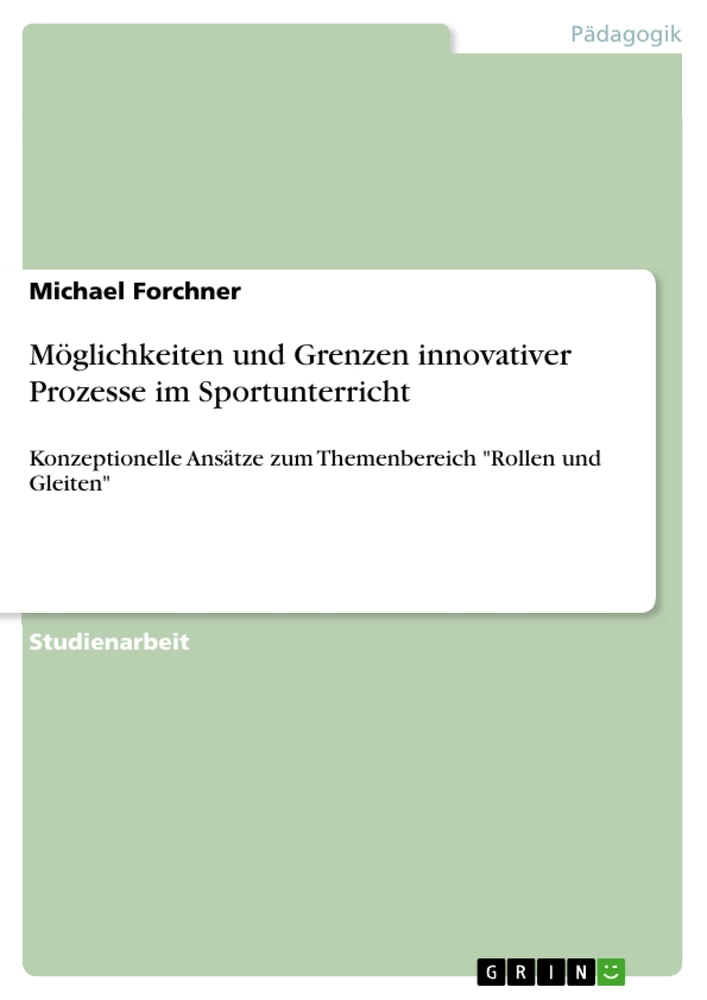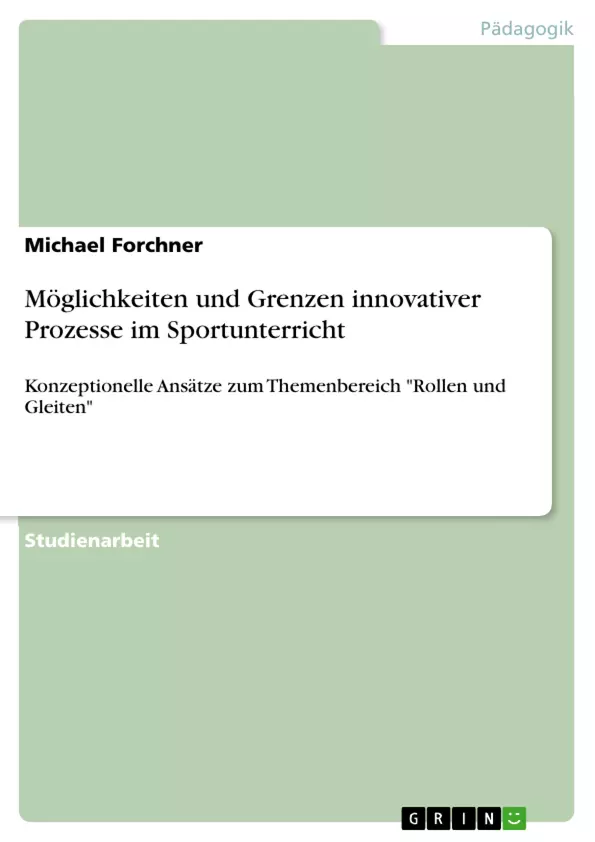In Zeiten der Globalisierung, Mediatisierung und des gesellschaftlichen Wandels im Allgemeinen machen die Wege des Umstrukturierens und Überdenkens ebenso wenig Halt vor pädagogisch-didaktischen Entscheidungen. Es waren Erziehungswissenschaftler und Lehrer wie Wolfgang Klafki, Paul Heimann oder Gunter Otto, die zur deutschen Bildungsreform Mitte des 20. Jahrhunderts beitrugen. Herkömmlicher, lehrerzentrierter Unterricht steht seither unter einer besonders kritischen Betrachtung und ist in den meisten neueren didaktischen Modellen eher die Ausnahme.
Die Entwicklung vollzieht sich vom ehemals stets frontal geführten hin zum geöffneten Unterricht. Schülerinnen und Schüler sollen sich Wissen und Werte möglichst handlungs- und problemorientiert anhand verschiedener Sozialformen aneignen, bestenfalls ohne Anleitung der Lehrkraft. Dies gilt ebenfalls für den Sportunterricht – wenngleich in abgewandelter Form im Vergleich zu anderen Fächern. Das Fördern und Fordern von Schülern im sportlichen Sinne bedarf jedoch einer gesonderten Perspektive, da sich diese sowohl kognitive und affektive als auch motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen sollten. In diesem Zusammenhang erscheint es wissenswert, einen Themenbereich des Sportunterrichts genauer in Augenschein zu nehmen, um so Möglichkeiten und Grenzen innovativen Unterrichts tiefgehender aufzeigen zu können.
Als Grundlage für die Überlegungen dienen unter anderem ein Referat sowie ein Interview, welche im Rahmen zweier absolvierter Fachdidaktik-Seminare des Sportstudiums getätigt beziehungsweise geführt wurden. Demgemäß konstituiert sich die Fragestellung am Beispiel des Themenbereichs 8 ‚Rollen und Gleiten‘ wie folgt: Was sind Möglichkeiten und Grenzen innovativer Unterrichtsprozesse?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Rollen und Gleiten - Innovatives Potenzial im Sportunterricht
- Themenbereich 8 - Rollen und Gleiten
- Innovativer Sportunterricht
- Vergleich herkömmlichen und innovativen Unterrichts
- Eigenverantwortliches Lernen im Sportunterricht
- Möglichkeiten und Grenzen innovativer Unterrichtsprozesse
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen innovativer Unterrichtsprozesse im Sportunterricht, insbesondere im Themenbereich "Rollen und Gleiten". Ziel ist es, die Einbettung des Themenbereichs im Lehrplan, die Definition von innovativem Sportunterricht und die Unterschiede zwischen herkömmlichem und innovativem Unterricht zu beleuchten. Darüber hinaus soll untersucht werden, wie eigenverantwortliches Lernen im Sportunterricht mit dem Konzept des innovativen Unterrichts vereinbar ist. Im Mittelpunkt stehen dabei konzeptionelle Ansätze zu Selbstbelehrung, Sicherheitsaspekten und Materialeinsatz im Themenbereich "Rollen und Gleiten".
- Einbettung des Themenbereichs "Rollen und Gleiten" im Lehrplan
- Definition von innovativem Sportunterricht
- Vergleich zwischen herkömmlichem und innovativem Unterricht
- Möglichkeiten und Grenzen von eigenverantwortlichem Lernen im Sportunterricht
- Konzeptionelle Ansätze zu Selbstbelehrung, Sicherheit und Materialeinsatz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung stellt den Kontext der Arbeit vor und beleuchtet die Bedeutung innovativer Unterrichtsformen im Sportunterricht. Kapitel 2 widmet sich dem Themenbereich "Rollen und Gleiten" und erörtert seine Bedeutung im Lehrplan, die Definition von innovativem Sportunterricht und den Vergleich mit herkömmlichen Unterrichtsformen. Kapitel 3 beleuchtet den Aspekt des eigenverantwortlichen Lernens im Sportunterricht. In Kapitel 4 werden Möglichkeiten und Grenzen innovativer Unterrichtsprozesse im Kontext des Themenbereichs "Rollen und Gleiten" erörtert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen "Rollen und Gleiten", "Innovativer Sportunterricht", "Eigenverantwortliches Lernen", "Selbstbelehrung", "Sicherheit" und "Materialeinsatz".
Häufig gestellte Fragen
Was ist innovativer Sportunterricht?
Innovativer Sportunterricht zeichnet sich durch eine Abkehr vom rein lehrerzentrierten Frontalunterricht hin zu handlungs- und problemorientierten Formen aus, bei denen Schüler eigenverantwortlich lernen.
Welche Bedeutung hat der Themenbereich „Rollen und Gleiten“ im Lehrplan?
Dieser Themenbereich (TB 8) bietet besonderes Potenzial für innovative Prozesse, da er motorische, kognitive und affektive Fähigkeiten durch den Umgang mit Materialien und Sicherheitsaspekten fördert.
Wie unterscheidet sich herkömmlicher von innovativem Unterricht?
Herkömmlicher Unterricht ist oft direktiv und frontal, während innovativer Unterricht die Selbstbelehrung der Schüler, differenzierte Sozialformen und problemorientiertes Handeln betont.
Wo liegen die Grenzen innovativer Prozesse im Sport?
Grenzen ergeben sich häufig aus Sicherheitsaspekten, dem verfügbaren Materialeinsatz sowie der notwendigen Balance zwischen Schülerfreiheit und pädagogischer Anleitung.
Was bedeutet eigenverantwortliches Lernen im Sport?
Es bedeutet, dass Schüler sich Wissen und Werte möglichst ohne direkte Anleitung der Lehrkraft aneignen, indem sie Aufgaben selbstständig lösen und reflektieren.
- Citation du texte
- Michael Forchner (Auteur), 2012, Möglichkeiten und Grenzen innovativer Prozesse im Sportunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/411968