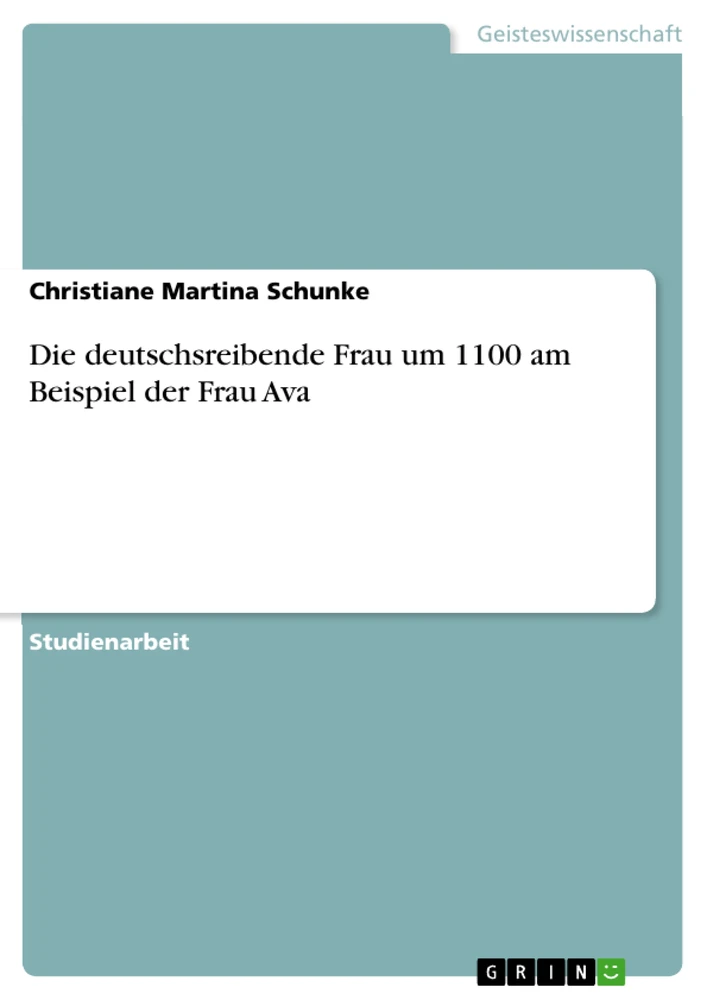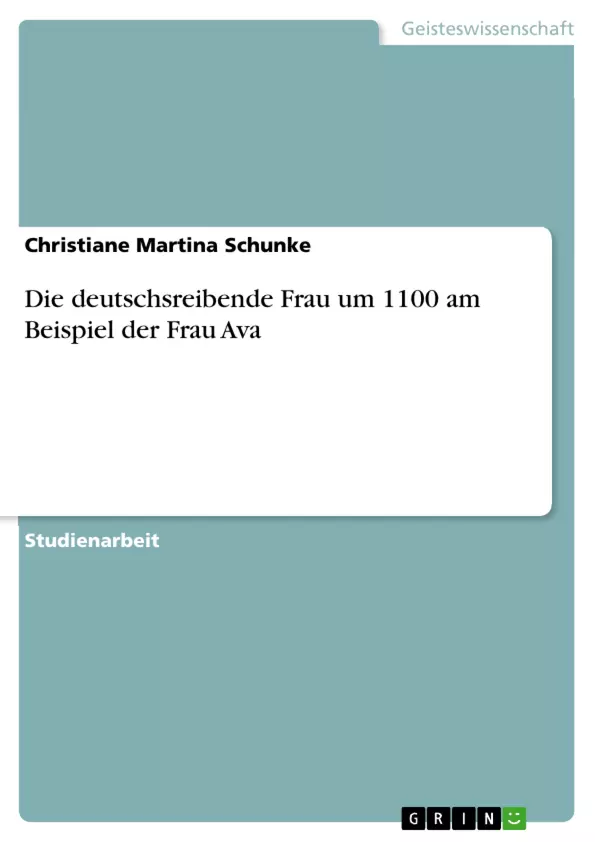Frau Ava gilt als die erste namentlich überlieferte Verfasserin von Gedichten in frühmittelhochdeutscher Sprache. Sie lebte wohl zwischen 1060 und 1127 im heutigen Niederösterreich, falls sie mit der Ava Inclusa übereinstimmt, deren Tod in den Annalen des Benediktinerklosters von Melk und anderen Klöstern in dessen Umgebung für das Jahr 1127 verzeichnet wird. Frau Ava werden insgesamt fünf epische Gedichte geistlichen Inhalts zugeschrieben, die in zwei Handschriften, der Vorauer Sammelhandschrift und einer späteren überlieferten Görlitzer Handschrift, die heute verschollen ist, übermittelt. Weitere Angaben sind bisher nicht bekannt. Dennoch ist die Forschung größtenteils der Auffassung, dass Frau Ava die fünf Gedichte verfasst hat.
Warum hält der überwiegende Teil der Forschung Frau Ava für die Autorin der fünf Gedichte? Konnte sie tatsächlich die Gedichte verfasst haben? Diese Hausarbeit zielt darauf ab, die Fragestellung zu beantworten. Das geschieht nach der deduktiven Methode, indem zunächst Antworten auf die folgenden Fragen hinsichtlich früh- und hochmittelalterlicher Schriftlichkeit gegeben werden: Ab welchem Zeitpunkt entwickelte sich in Kontinentaleuropa eine kontinuierliche volkssprachige Schriftlichkeit? Wer konnte zu der Zeit schreiben? Wie wurde damals geschrieben? Wer hatte geschrieben? Auf Basis dieser Antworten wird anschließend der Frage nachgegangen, weshalb die Forschung überwiegend davon ausgeht, dass Frau Ava die Verfasserin der fünf Gedichte gewesen war und ob sie tatsächlich als deren Autorin gelten kann. Im Hinblick auf die in der Hausarbeit verwendete Forschungsliteratur kann insbesondere auf die folgenden Arbeiten verwiesen werden: Zur Darstellung der Entwicklung einer volkssprachigen Schriftlichkeit auf dem europäischen Kontinent wird beispielsweise die Arbeit von Peter Stein, „Schriftkultur. Eine Geschichte des Schreibens und Lesens“, herangezogen, der zu dieser Thematik einen knappen und dennoch überzeugenden Überblick gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Schriftlichkeit im frühen und hohen Mittelalter
- Zur Entwicklung der volkssprachigen Schriftlichkeit
- Lese- und Schreibfertigkeiten im frühen und hohen Mittelalter
- Der Schreibprozess
- Zur Schriftlichkeit der Frauen
- Leben und Schreiben der Frau Ava
- Zur Biographie der Frau Ava
- Zu den Gedichten
- Zur Überlieferung der Gedichte
- Zur Schriftlichkeit der Frau Ava
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Frage nach der Autorschaft der fünf geistlichen Gedichte, die Frau Ava zugeschrieben werden. Sie analysiert, ob Frau Ava tatsächlich die Verfasserin dieser frühmittelhochdeutschen Texte war. Die Arbeit verwendet eine deduktive Methode, beginnend mit der Untersuchung der Schriftlichkeit im frühen und hohen Mittelalter, um die Bedingungen und Möglichkeiten weiblicher Schriftstellerei zu beleuchten.
- Entwicklung der volkssprachigen Schriftlichkeit im Hochmittelalter
- Lese- und Schreibkompetenzen im frühen und hohen Mittelalter
- Schreibpraktiken im Hochmittelalter
- Schriftlichkeit von Frauen im Hochmittelalter
- Biographie und literarisches Werk der Frau Ava
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Autorschaft der Frau Ava in Bezug auf fünf geistliche Gedichte in frühmittelhochdeutscher Sprache vor. Sie skizziert die methodische Vorgehensweise – eine deduktive Analyse der früh- und hochmittelalterlichen Schriftkultur – und nennt die wichtigsten Forschungsliteratur. Die Arbeit untersucht die Entstehung volkssprachiger Schriftlichkeit, die Lese- und Schreibfähigkeiten sowie die Schreibpraktiken dieser Zeit, um die Bedingungen für Frau Avas mögliche Autorschaft zu bewerten.
Zur Schriftlichkeit im frühen und hohen Mittelalter: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der volkssprachigen Schriftlichkeit in Kontinentaleuropa. Es zeigt, dass bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts lateinische Texte dominierten, bevor sich im 11. und 12. Jahrhundert eine kontinuierliche volkssprachige Schriftlichkeit entwickelte. Die Gründe hierfür werden in den Klosterreformen, dem Investiturstreit und dem wachsenden Interesse der Laienbevölkerung an schriftlich überlieferter Literatur gesehen. Das Kapitel legt den Fokus auf die Umstände, die die Verbreitung von Texten in Volkssprachen begünstigten, und bildet damit eine wichtige Grundlage für die spätere Analyse von Frau Avas Werk.
Leben und Schreiben der Frau Ava: Dieses Kapitel widmet sich der Biographie von Frau Ava und ihren zugeschriebenen Gedichten. Es untersucht die wenigen bekannten Fakten über ihr Leben, unter anderem die mögliche Identifizierung mit Ava Inclusa und den Todeszeitpunkt. Es analysiert die fünf geistlichen Gedichte, ihre Überlieferung in zwei Handschriften (Vorauer und Görlitzer Handschrift) und die Argumente der Forschung, die Frau Ava als Autorin identifizieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der vorhandenen Belege und der Diskussion der Beweise für und gegen ihre Autorschaft.
Schlüsselwörter
Frau Ava, Frühmittelhochdeutsch, Volkssprachige Schriftlichkeit, Mittelalterliche Schriftkultur, Geistliche Dichtung, Autorschaft, Lese- und Schreibkompetenz, Kloster, Handschrift, Forschungsliteratur.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Autorschaft der Gedichte der Frau Ava
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Frage nach der Autorschaft von fünf geistlichen Gedichten, die traditionell Frau Ava zugeschrieben werden. Sie analysiert, ob Frau Ava tatsächlich die Verfasserin dieser frühmittelhochdeutschen Texte war.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine deduktive Methode. Sie beginnt mit der Untersuchung der Schriftlichkeit im frühen und hohen Mittelalter, um die Bedingungen und Möglichkeiten weiblicher Schriftstellerei zu beleuchten und so die Frage nach Frau Avas Autorschaft zu beantworten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der volkssprachigen Schriftlichkeit im Hochmittelalter, den Lese- und Schreibkompetenzen dieser Zeit, den damaligen Schreibpraktiken, der weiblichen Schriftlichkeit im Hochmittelalter sowie der Biographie und dem literarischen Werk der Frau Ava.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Schriftlichkeit im frühen und hohen Mittelalter, ein Kapitel zum Leben und Schreiben der Frau Ava und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Methodik vor. Das erste Hauptkapitel analysiert den Kontext der mittelalterlichen Schriftkultur. Das zweite Hauptkapitel konzentriert sich auf die Biographie und die Gedichte der Frau Ava und diskutiert die Argumente für und gegen ihre Autorschaft.
Was wird im Kapitel "Zur Schriftlichkeit im frühen und hohen Mittelalter" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der volkssprachigen Schriftlichkeit in Kontinentaleuropa, den Übergang von lateinischen zu volkssprachigen Texten und die Faktoren, die diese Entwicklung begünstigten (z.B. Klosterreformen, Investiturstreit). Es liefert den Kontext für das Verständnis der Möglichkeiten weiblicher Schriftstellerei im Mittelalter.
Was wird im Kapitel "Leben und Schreiben der Frau Ava" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die Biographie von Frau Ava, soweit bekannt, inklusive der möglichen Identifizierung mit Ava Inclusa. Es analysiert ihre fünf zugeschriebenen geistlichen Gedichte, deren Überlieferung in den Vorauer und Görlitzer Handschriften, und diskutiert die bestehenden Argumente in der Forschung zu ihrer Autorschaft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frau Ava, Frühmittelhochdeutsch, Volkssprachige Schriftlichkeit, Mittelalterliche Schriftkultur, Geistliche Dichtung, Autorschaft, Lese- und Schreibkompetenz, Kloster, Handschrift, Forschungsliteratur.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit nennt in der Einleitung die wichtigsten Forschungsliteratur, die für die Analyse herangezogen wurde. Der genaue Umfang der Quellenangaben ist aus dieser Zusammenfassung nicht ersichtlich.
- Citation du texte
- Christiane Martina Schunke (Auteur), 2015, Die deutschsreibende Frau um 1100 am Beispiel der Frau Ava, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412077