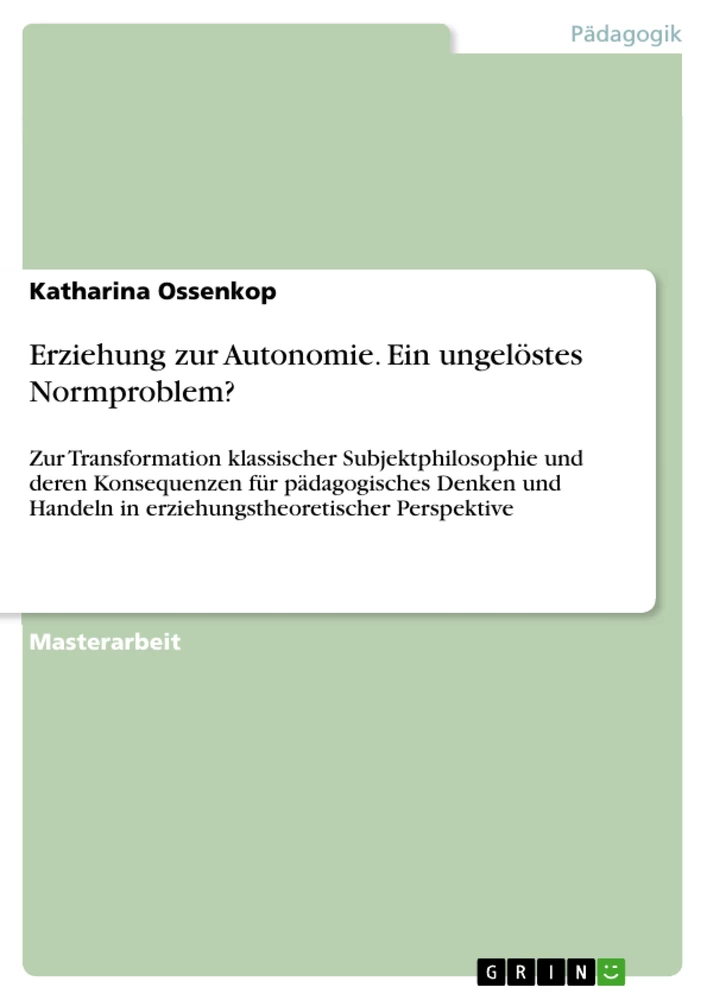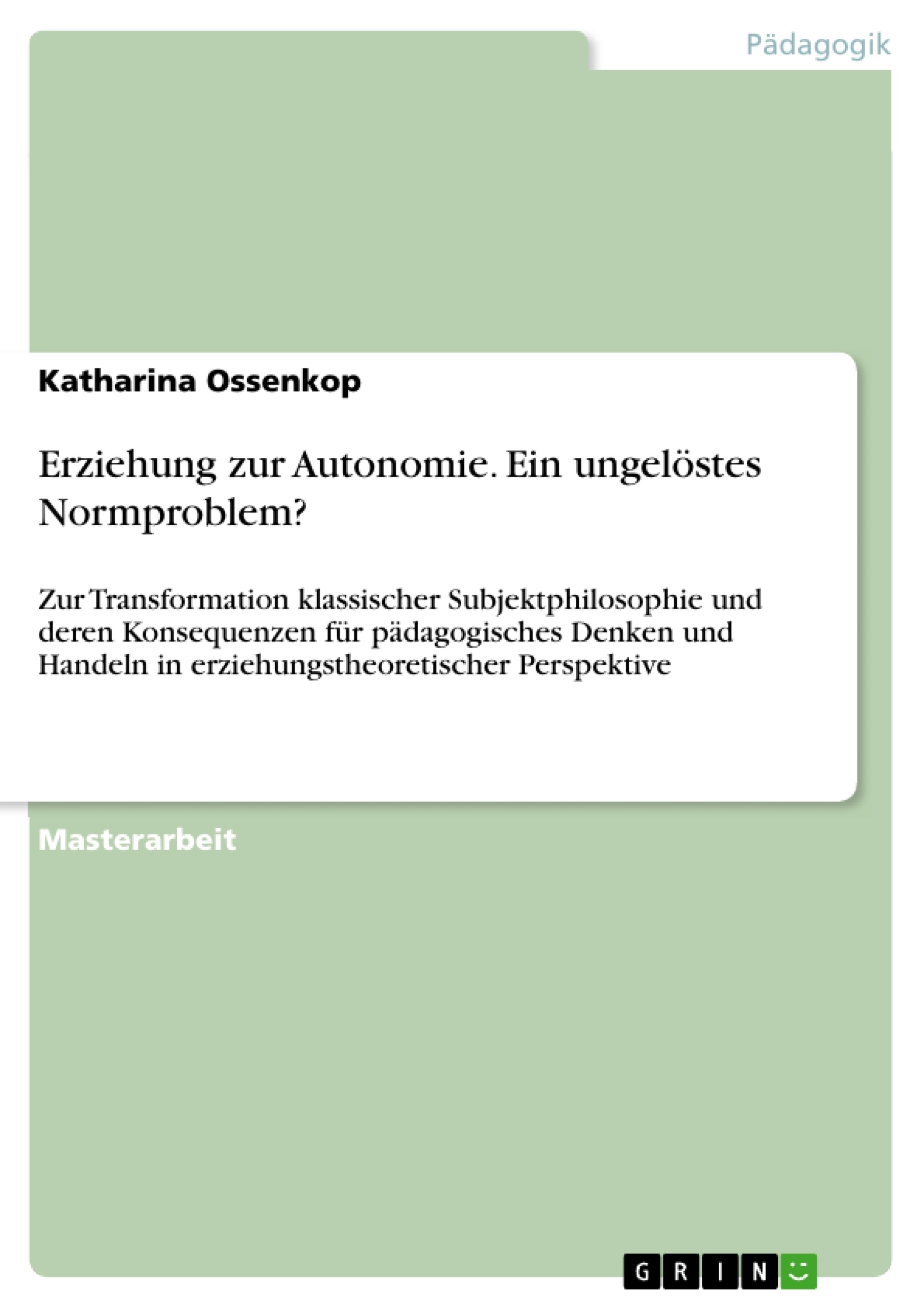Es wird ein Erziehungsverständnis erarbeitet, das nicht ausschließt, weiterführend in theoretische Richtungen von Erziehung zu beantworten, wie eine Erziehung zur Autonomie, die sich unter Maßgabe der Beförderung autonomer Subjektivität versteht, umzusetzen wäre. Unter Bezug auf Rousseaus dargelegtes konstitutives Prinzip einer „negativen Erziehung“ sowie erziehungstheoretische Grundlagen in „Emile oder über die Erziehung“ (1762) wird anschließend aus Sicht klassischer Subjektphilosophie im Hinblick auf seine Vorstellung vom „Naturmensch“ versucht, die Kehrseite des Traums der Vervollkommnung des Menschen hinsichtlich der Entfaltung pädagogischer Macht- und Disziplinierungstechniken zu enttarnen, sodass danach kontrastiv die in den Bänden der „Akademieausgabe von Kants gesammelten Werken“ moralphilosophische Begründung und die darin angelegte Abhängigkeit des vernünftigen Menschen von der Wirkungs- und Legitimationsproblematik, nicht nur auf die im pädagogischen Handeln integrierten Antinomien der pädagogischen Moderne hin kritisch befragt werden können, sondern zudem die mit der Erziehung intendierte pädagogische Zivilisierung, um im zusammenfassenden Kapitel die Frage nach der Aufgabe der Erziehung, der Möglichkeit einer Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft, aufzuwerfen (vgl. Helsper 2007, S. 26-27), die die Grundlegungsproblematik (vgl. Riefling 2013, S. 14) klassischer Subjektphilosophie nicht unberücksichtigt lässt und an die das poststrukturalistische Denken aufgrund der nietzscheanischen Interpretation des moralischen Subjekts (vgl. Keller, Schneider & Viehöver 2012, S. 12) kritisch anknüpft. Aus diesem Grund stehen neben Rousseau und Kant, Foucault und Butler im Zentrum der Betrachtung, die über das problematisierte Verhältnis von Freiheit und Macht hinaus eröffnen, Erziehung über Denkfiguren der Dezentrierung des Subjekts in ihrer Option für Autonomie machttheoretisch zu analysieren. So wird versucht, die Rezeption klassischer Subjektphilosophie angesichts postmodernen Denkens neuen Zugängen pädagogischer Selbstkritik zu öffnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in die Thematik – Problem, Zielsetzung und Vorgehen
- 2. Methodischer Zugang
- 2.1 Pädagogische Hermeneutik
- 2.2 Methodische Umsetzung – Der hermeneutische Ansatz
- 2.3 Reflexion, Grenzen und Probleme
- 3. Erziehung als Gegenstand der Pädagogik - Aufgabe und Begriffsbestimmungen
- 3.1 Vorbemerkungen zu den Begriffsbestimmungen von Erziehung
- 3.2 Theoretische Grundlagen und Definitionen
- 4. Klassische Subjektphilosophie – Erziehung zwischen Autonomie und Zwang
- 4.1 Jean-Jacques Rousseau – Über Erziehung und die Entdeckung der Kindheit
- 4.1.1 Erziehung zum Menschen - Rousseaus „Naturmensch“
- 4.1.2 Überlegungen zur Möglichkeit von Erziehung
- 4.1.3 Die Negation des Machtproblems
- 4.2 Immanuel Kant – Erziehung zur Freiheit
- 4.2.1 Über Kants Grundlage der Moral, Erziehung und Freiheit
- 4.2.2 Kants Richtlinien der Erziehung – Rechtfertigung seiner Erziehungslehre
- 4.3 Das pädagogische Jahrhundert – Erziehung zur Autonomie als Disziplinierung
- 4.1 Jean-Jacques Rousseau – Über Erziehung und die Entdeckung der Kindheit
- 5. Zur Transformation klassischer Subjektphilosophie
- 5.1 Michel Foucault – Ethik, Kritik und Aufklärung
- 5.1.1 Die Grundlegung der Pädagogik und das Subjekt der Moderne
- 5.1.2 Subjekt, Macht und Erziehung – Die Figur des Widerstands bei Foucault
- 5.1.3 Gouvernementalität, Macht und Selbsttechniken – Ein Subjekt ohne Subjekt?
- 5.2 Judith Butler – Das postsouveräne Subjekt
- 5.2.1 Kein Subjekt ohne Subjektivation
- 5.2.2 Das Scheitern von Subjektivierung als notwendiges Moment zur Integration von Freiheit, Widerstand und Unterwerfung
- 5.2.3 Das reflexive Selbst und seine unzureichende Bestimmung
- 5.3 Über das Ethos der Moderne und postmodernen Denkens
- 5.1 Michel Foucault – Ethik, Kritik und Aufklärung
- 6. Das Paradoxieproblem in der Pädagogik als Grundlage pädagogischen Handelns
- 6.1 Alfred Schäfer - Pädagogische Theorien und das Problem der Legitimation beanspruchter Macht
- 6.1.1 Grenze des eigenen Wissens über die Andersheit des Anderen
- 6.1.2 Das pädagogische Legitimationsproblem und seine Notwendigkeit
- 6.2 Käte Meyer-Drawe - Das doppeldeutige Subjekt
- 6.2.1 Die Dekonstruktion des souveränen Subjekts
- 6.2.2 Erziehung zwischen „Autonomie und Heteronomie
- 6.1 Alfred Schäfer - Pädagogische Theorien und das Problem der Legitimation beanspruchter Macht
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht das Normproblem der Erziehung zur Autonomie. Sie analysiert die Transformation klassischer Subjektphilosophien und deren Konsequenzen für pädagogisches Denken und Handeln. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Paradoxien, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen Autonomie und Macht in der Erziehung ergeben.
- Die Transformation klassischer Subjektphilosophien im Kontext der Erziehung
- Das Spannungsfeld zwischen Autonomie und Macht in der Erziehung
- Das Paradoxieproblem in der Pädagogik und dessen Auswirkungen auf pädagogisches Handeln
- Die Legitimation von Macht in der Erziehung
- Reflexion des Erziehungsziels eines autonomen Subjekts in der Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung in die Thematik – Problem, Zielsetzung und Vorgehen: Die Einleitung stellt das zentrale Problem der Arbeit dar: die Diskrepanz zwischen dem angestrebten Ziel der Erziehung zur Autonomie und den oft bestehenden Machtverhältnissen in erzieherischen Kontexten. Sie skizziert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz, der die hermeneutische Methode nutzt, um verschiedene pädagogische Theorien zu analysieren und deren Implikationen für die Praxis zu untersuchen. Die Arbeit greift aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auf, die die Bedeutung des Themas unterstreichen, insbesondere den Wandel des Selbstverständnisses Jugendlicher.
2. Methodischer Zugang: Dieses Kapitel beschreibt den methodischen Rahmen der Arbeit. Der Fokus liegt auf der pädagogischen Hermeneutik als gewähltem Forschungsansatz. Es wird detailliert erläutert, wie der hermeneutische Ansatz in der Arbeit umgesetzt wird und welche Reflexionen bezüglich der Grenzen und Probleme dieser Methode vorgenommen werden. Die methodische Fundierung der Arbeit wird hier transparent gemacht.
3. Erziehung als Gegenstand der Pädagogik - Aufgabe und Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Erziehung und legt die theoretischen Grundlagen für die weitere Untersuchung dar. Es analysiert verschiedene Begriffsbestimmungen von Erziehung und verdeutlicht den komplexen Charakter dieses Begriffs. Die Kapitel beschreibt, wie der Begriff "Erziehung" innerhalb der Arbeit verwendet und verstanden werden soll.
4. Klassische Subjektphilosophie – Erziehung zwischen Autonomie und Zwang: Das vierte Kapitel analysiert die Konzepte von Rousseau und Kant bezüglich Erziehung und Autonomie. Es untersucht Rousseaus Vorstellung des „Naturmenschen“ und dessen Implikationen für die Erziehung. Kants Konzept der Erziehung zur Freiheit wird ebenfalls detailliert dargestellt, inklusive seiner moralphilosophischen Grundlagen. Schließlich wird der Einfluss dieser klassischen Ansätze auf das Verständnis von Autonomie in der Pädagogik des 20. Jahrhunderts beleuchtet.
5. Zur Transformation klassischer Subjektphilosophie: Dieses Kapitel untersucht die Transformation des Verständnisses von Subjekt und Autonomie in der Moderne, in Auseinandersetzung mit den Theorien von Michel Foucault und Judith Butler. Es analysiert Foucaults Konzept von Macht, Gouvernementalität und Selbsttechniken im Kontext von Erziehung. Butlers Theorie des postsouveränen Subjekts wird präsentiert und dessen Bedeutung für ein Verständnis von Autonomie und Widerstand diskutiert.
6. Das Paradoxieproblem in der Pädagogik als Grundlage pädagogischen Handelns: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Paradox, dass Erziehung zur Autonomie immer auch Macht impliziert. Es analysiert die Beiträge von Alfred Schäfer und Käte Meyer-Drawe zu diesem Thema. Schäfers Auseinandersetzung mit dem Legitimationsproblem pädagogischer Macht und Meyer-Drawes Konzept des doppeldeutigen Subjekts werden im Detail dargestellt und ihre Relevanz für die Praxis der Erziehung diskutiert. Die Kapitel untersucht, wie dieses Paradox in der pädagogischen Praxis zu bewältigen ist.
Schlüsselwörter
Erziehung zur Autonomie, Subjektphilosophie, Pädagogische Hermeneutik, Macht, Autonomie, Heteronomie, Paradoxie, Legitimation, Moderne, Postmoderne, Foucault, Butler, Rousseau, Kant, Reflexivität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Erziehung zur Autonomie
Was ist das zentrale Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht das Normproblem der Erziehung zur Autonomie. Sie analysiert die Transformation klassischer Subjektphilosophien und deren Konsequenzen für pädagogisches Denken und Handeln. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Spannungsfeld zwischen Autonomie und Macht in der Erziehung und den damit verbundenen Paradoxien.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Paradoxien, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen Autonomie und Macht in der Erziehung ergeben. Sie untersucht, wie das angestrebte Ziel der Erziehung zur Autonomie mit den oft bestehenden Machtverhältnissen in erzieherischen Kontexten in Einklang gebracht werden kann.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet die pädagogische Hermeneutik als methodischen Ansatz. Dieser Ansatz ermöglicht die detaillierte Analyse verschiedener pädagogischer Theorien und deren Implikationen für die Praxis.
Welche klassischen Subjektphilosophien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Konzepte von Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant zur Erziehung und Autonomie. Rousseaus Vorstellung des „Naturmenschen“ und Kants Konzept der Erziehung zur Freiheit werden im Detail dargestellt und kritisch beleuchtet.
Wie werden moderne und postmoderne Perspektiven berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht die Transformation des Verständnisses von Subjekt und Autonomie in der Moderne anhand der Theorien von Michel Foucault und Judith Butler. Foucaults Konzept von Macht, Gouvernementalität und Selbsttechniken sowie Butlers Theorie des postsouveränen Subjekts werden analysiert und in Bezug zur Erziehung diskutiert.
Welches Paradox wird in der Arbeit besonders hervorgehoben?
Ein zentrales Thema ist das Paradox, dass Erziehung zur Autonomie immer auch Macht impliziert. Die Arbeit analysiert, wie dieses Paradox in der pädagogischen Praxis zu bewältigen ist.
Welche Autoren werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Theorien von Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Michel Foucault, Judith Butler, Alfred Schäfer und Käte Meyer-Drawe.
Welche Schlüsselthemen werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselthemen sind: Erziehung zur Autonomie, Subjektphilosophie, Pädagogische Hermeneutik, Macht, Autonomie, Heteronomie, Paradoxie, Legitimation, Moderne, Postmoderne, Reflexivität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Methodischer Zugang, Erziehung als Gegenstand der Pädagogik, Klassische Subjektphilosophie, Transformation klassischer Subjektphilosophie, Das Paradoxieproblem in der Pädagogik und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche gesellschaftlichen Entwicklungen werden in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit greift aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auf, die die Bedeutung des Themas unterstreichen, insbesondere den Wandel des Selbstverständnisses Jugendlicher.
- Quote paper
- Katharina Ossenkop (Author), 2016, Erziehung zur Autonomie. Ein ungelöstes Normproblem?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412653