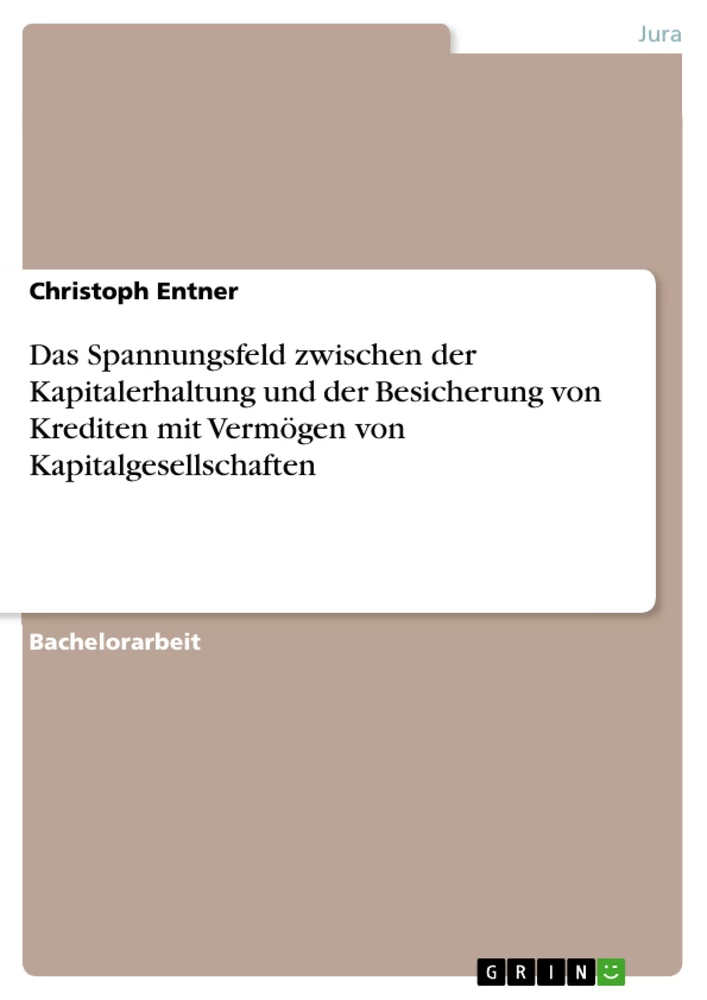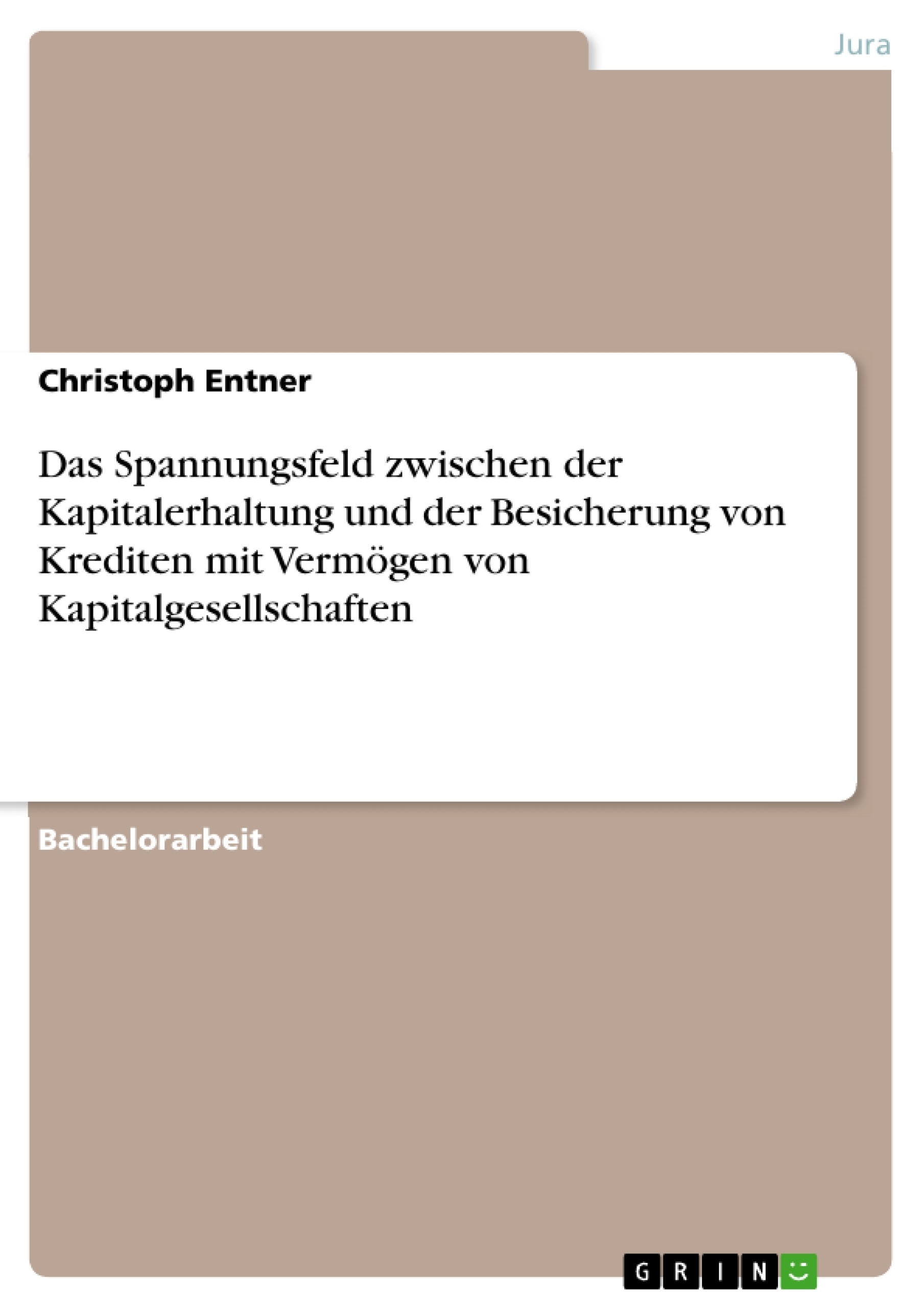Die nachfolgende Arbeit thematisiert das Spannungsfeld zwischen dem Kapitalerhaltungsrecht und der Besicherung von Gesellschafterkrediten durch Vermögen von Kapitalgesellschaften. Ursache dafür ist § 82 GmbHG. Diese Norm untersagt grundsätzlich jeglichen Vermögensabfluss von der Gesellschaft an Gesellschafter, der keine Gewinnverwendung darstellt. Um dieses Spannungsfeld in seiner Grundkonzeption verständlich zu machen widmeten sich die Einführungskapitel dieses Werks daher der detaillierten Beleuchtung des Problems. Nach einer inhaltlichen Bezugnahme auf eine für die gegenständliche Thematik wesentliche OGH-Entscheidung wurden im Anschluss daran die Kriterien beleuchtet, anhand derer die Prüfung, ob ein Verstoß gegen § 82 GmbHG vorliegt, erfolgt. Die beiden wesentlichen Kriterien sind hier die Frage, ob die Gesellschaft für die Bestellung der Sicherheit ein angemessenes Entgelt erhalten hat oder ob eine betriebliche Rechtfertigung dafür vorliegt. Hier existieren hinsichtlich der Wertigkeit dieser beiden Kriterien in der Rechtsprechung wie in der Lehre stark divergierende Meinungen. Nachdem in weiterer Folge die Rechtsfolgen, die ein Verstoß gegen § 82 GmbHG zur Folge hat, skizziert wurden, wurde anschließend auf die Situation der Bank als Sicherheitennehmerin eingegangen. Dabei wurde umrissen, unter welchen Umständen auch sie von der Nichtigkeitssanktion betroffen sein kann, was wiederum maßgeblich davon abhängt, ob die Bank ihre Sorgfaltspflichten bei der Prüfung der Kreditsicherheit wahrnimmt. Die Unterschiede in den Rechtsmeinungen des OGH zu diesen Sorgfaltspflichten erwiesen sich dabei als erheblich. So erfuhren die genannten Pflichten gerade durch die im Vorjahr ergangene Conwert-Entscheidung eine wesentliche Verschärfung. Nach dem aktuellen Stand der Rechtsprechung ist etwa die Bank nun stets zu einer Nachforschung angehalten, sofern sie nicht Kenntnis von einer betrieblichen Rechtfertigung als Motiv für die Kreditbesicherung hat. Im Abschlusskapitel dieser Arbeit erfolgte schließlich ein kurzer Umriss des Haftungsausmaßes, das ein kapitalerhaltungsrechtlicher Verstoß zur Folge hat.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Abstract
- Einleitung
- Vorwort
- Problemstellung/Ausgangslage
- Zielsetzung
- Konzeptionelle Vorgehensweise
- Das Kapitalerhaltungsrecht als wesentlicher Bestandteil des GmbH-Rechts
- Verhältnis zwischen Kapitalerhaltungsrecht und Einlagenrückgewährverbot
- Rechtliche Verankerung des Einlagenrückgewährverbots
- Regelungscharakter des § 82 GmbHG
- Normadressaten
- Gegenstand des Verbotstatbestandes
- Normzweck von § 82 GmbHG
- Anwendung des Kapitalerhaltungsrechts auf kapitalistische Personengesellschaften
- Aufriss des Grundproblems
- Wesen der Sicherheitenbestellung aus Gesellschaftsvermögen
- Konflikt zum Kapitalerhaltungsrecht
- Stellvertretungsrechtliche Aspekte
- Konzerninterne Besicherungen und LbO bzw. MbO-Transaktionen
- Konflikt zum Kapitalerhaltungsrecht
- Inhalt der Fehringer-Entscheidung
- Primäre Kriterien für das Vorliegen einer Einlagenrückgewähr
- Risikobeurteilung und Rückgriffsanspruch
- Die Avalprovision als „angemessene Gegenleistung“
- Exkurs: Maßstab des Drittvergleichs
- Betriebliche Rechtfertigung als sekundäres Kriterium
- Wesen und Auffassung des Konzepts in der Lehre
- Betriebliche Rechtfertigung in der Judikatur
- Gegenstand einer betrieblichen Rechtfertigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen dem Kapitalerhaltungsrecht und der Besicherung von Gesellschafterkrediten durch Vermögen von Kapitalgesellschaften. Sie analysiert insbesondere die Anwendung des § 82 GmbHG auf diese Situation und beleuchtet die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen diese Norm.
- Das Kapitalerhaltungsrecht und seine Bedeutung für die Stabilität von Kapitalgesellschaften
- Die Besicherung von Gesellschafterkrediten durch Gesellschaftsvermögen und die potenziellen Konflikte mit dem Kapitalerhaltungsrecht
- Die Kriterien für die Beurteilung eines Verstoßes gegen § 82 GmbHG, insbesondere die „angemessene Gegenleistung“ und die „betriebliche Rechtfertigung“
- Die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen § 82 GmbHG für die Gesellschaft und die Bank als Sicherheitennehmerin
- Die Sorgfaltspflichten der Bank bei der Prüfung der Kreditsicherheit und die Auswirkungen der Conwert-Entscheidung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Spannungsfeld zwischen Kapitalerhaltungsrecht und Gesellschafterkreditbesicherung dar und gibt einen Überblick über die Zielsetzung und die Vorgehensweise der Arbeit.
- Kapitel 2 erläutert das Kapitalerhaltungsrecht als wesentlichen Bestandteil des GmbH-Rechts, insbesondere das Verbot der Einlagenrückgewähr und seine rechtliche Verankerung in § 82 GmbHG.
- Kapitel 3 analysiert das Wesen der Sicherheitenbestellung aus Gesellschaftsvermögen und den Konflikt mit dem Kapitalerhaltungsrecht. Dabei werden auch stellvertretungsrechtliche Aspekte berücksichtigt.
- Kapitel 4 beleuchtet die Situation bei konzerninternen Besicherungen und LbO bzw. MbO-Transaktionen und analysiert den Konflikt mit dem Kapitalerhaltungsrecht.
- Kapitel 5 beschreibt die Kriterien für das Vorliegen einer Einlagenrückgewähr, insbesondere die Risikobeurteilung und den Rückgriffsanspruch, sowie die Avalprovision als „angemessene Gegenleistung“.
- Kapitel 6 behandelt das Konzept der betrieblichen Rechtfertigung als sekundäres Kriterium für die Beurteilung eines Verstoßes gegen § 82 GmbHG.
Schlüsselwörter
Kapitalerhaltungsrecht, Einlagenrückgewährverbot, § 82 GmbHG, Gesellschafterkredit, Besicherung, Kreditrisiko, angemessene Gegenleistung, betriebliche Rechtfertigung, Sorgfaltspflichten, Conwert-Entscheidung.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt § 82 GmbHG zum Kapitalerhalt?
§ 82 GmbHG verbietet grundsätzlich die Rückgewähr von Einlagen an Gesellschafter außerhalb der Gewinnverwendung, um das Gesellschaftsvermögen zu schützen.
Wann ist die Besicherung von Gesellschafterkrediten problematisch?
Es entsteht ein Konflikt, wenn Gesellschaftsvermögen zur Besicherung privater Kredite der Gesellschafter genutzt wird, da dies einen unzulässigen Vermögensabfluss darstellen kann.
Was versteht man unter „betrieblicher Rechtfertigung“?
Eine Besicherung ist zulässig, wenn sie im eigenbetrieblichen Interesse der Gesellschaft liegt und nicht nur dem privaten Vorteil des Gesellschafters dient.
Welche Sorgfaltspflichten haben Banken bei Kreditsicherheiten?
Banken müssen prüfen, ob eine Besicherung aus Gesellschaftsvermögen kapitalerhaltungsrechtlich zulässig ist. Die Rechtsprechung (z.B. Conwert-Entscheidung) hat diese Prüfpflichten verschärft.
Was sind die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen das Einlagenrückgewährverbot?
Ein Verstoß führt zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts und kann Rückerstattungsansprüche der Gesellschaft sowie Haftungen der Geschäftsführer auslösen.
- Quote paper
- Christoph Entner (Author), 2012, Das Spannungsfeld zwischen der Kapitalerhaltung und der Besicherung von Krediten mit Vermögen von Kapitalgesellschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412667