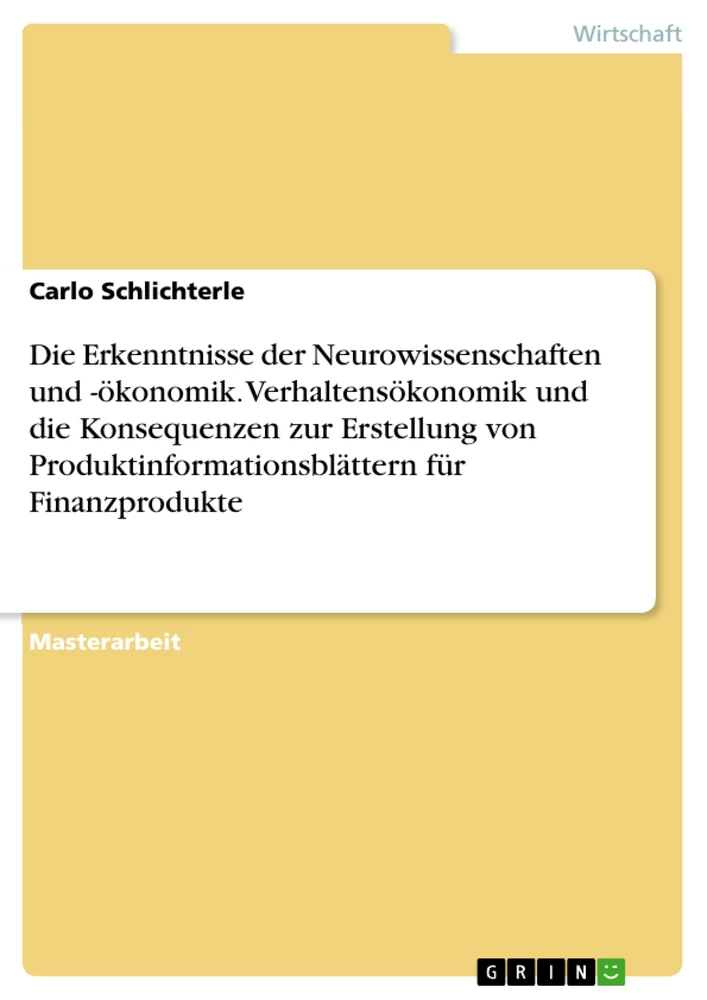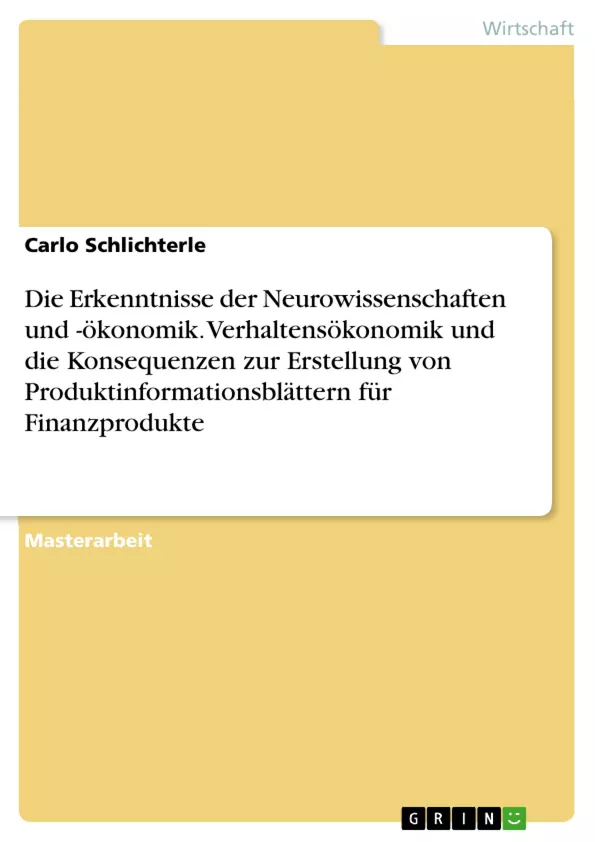Die Menschen handeln nicht, weil sie gedacht haben, sondern sie denken, weil sie gehandelt haben. Die Worte von Vilfredo Pareto sind auch heute noch aktuell. Schon frühe Aufklärer wie Leibniz hatten den Verdacht, der denkende Mensch sei nicht „Steuermann“ seiner Handlungen, sondern würde umgekehrt getrieben von unbewussten Vorgängen. Somit wäre die Fähigkeit des Menschen zur rationalen Bearbeitung von Problemen in Zweifel gezogen, die sich auch in den diversen Finanzmarktkrisen widerspiegelt. Noch immer aber unterstellen mehrheitlich Wissenschaft wie Praxis, also Politik und Verbraucherschutz, dass Mängel im Marktgeschehen auf fehlende Informationen zurückzuführen seien.
Die Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise, die in den USA ihren Ursprung hat, lassen den deutschen Bankenmarkt nicht unberührt und haben dazu geführt, dass die Entwicklungen in diesem Wirtschaftsbereich zunehmend im gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen sind und dass Banken skeptischer betrachtet werden. Für die Anlageberatung sind seit dem 1. Juli 2011 gemäß § 31 Abs. 3a WpHG zwei- bis dreiseitige PIBs vorgeschrieben. Das Thema „Falschberatung und Provisionsorientierung in der Finanzberatung“ ist insbesondere durch die Insolvenz von Lehman Brothers an die Öffentlichkeit gelangt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Forschungsfragen
- Methode
- Definitorische Grundlagen
- Theoretische Grundlagen
- Neurowissenschaftliche Grundlagen
- Der Aufbau des menschlichen Gehirns
- Kognitive Prozesse
- Neuroökonomische Grundlagen
- Methoden der Neuroökonomie/-wissenschaft
- Prinzipien der experimentellen Wirtschaftsforschung
- Verhaltensökonomische Grundlagen
- Kritik am Homo oeconomicus
- Grundlagen der Behavioral Finance (Biases und Heuristiken)
- Tiefenpsychologische Ergänzungen
- Neurowissenschaftliche Grundlagen
- Erkenntnisse zur besseren Gestaltung von PIBS
- PIB-Entwicklung und derzeitiger Stand
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Erkenntnisse zur besseren Gestaltung
- Anforderung 1: übersichtliche und leicht verständliche Informationsvermittlung
- Anforderung 2: Risiko
- Anforderung 3: Rendite und Kosten
- Anforderung 4: Transparenz und Vergleichbarkeit
- Konsolidierung der Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht, wie Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft, Neuroökonomie und Verhaltensökonomie die Gestaltung von Produktinformationsblättern (PIBs) aus Verbraucher- und Vertriebsperspektive verbessern können. Die Arbeit analysiert den derzeitigen Stand der PIB-Gestaltung und beleuchtet, welche Chancen und Grenzen sich durch die Einbeziehung neuroökonomischer und verhaltensökonomischer Erkenntnisse für eine effektivere Informationsvermittlung ergeben.
- Der Einfluss kognitiver Prozesse auf die Entscheidungsfindung von Anlegern
- Die Kritik am Modell des Homo oeconomicus und die Bedeutung von Biases und Heuristiken
- Die Anwendung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für eine optimierte Gestaltung von PIBs
- Die Analyse rechtlicher Rahmenbedingungen und derzeitiger PIB-Entwicklungen
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten, PIBs verständlicher, transparenter und vergleichbarer zu gestalten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung: Diese Einleitung beschreibt die Problemstellung, die Zielsetzung und Forschungsfragen der Arbeit. Sie erläutert die Methodik und definiert wichtige Begriffe im Kontext der PIB-Gestaltung.
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die relevanten Grundlagen aus den Bereichen Neurowissenschaft, Neuroökonomie und Verhaltensökonomie. Es analysiert den Aufbau des menschlichen Gehirns, kognitive Prozesse, Methoden der Neuroökonomie sowie Prinzipien der experimentellen Wirtschaftsforschung. Darüber hinaus wird die Kritik am Modell des Homo oeconomicus und die Bedeutung von Biases und Heuristiken in der Finanzwelt thematisiert.
- Kapitel 3: Erkenntnisse zur besseren Gestaltung von PIBS: In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus Kapitel 2 im Kontext der PIB-Gestaltung zusammengefasst. Es werden die Anforderungen an eine übersichtliche und verständliche Informationsvermittlung, die Darstellung von Risiko, Rendite und Kosten sowie die Bedeutung von Transparenz und Vergleichbarkeit beleuchtet.
- Kapitel 4: Konsolidierung der Erkenntnisse: Dieses Kapitel führt die Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln zusammen und analysiert deren Relevanz für die Gestaltung von PIBs. Es werden die Herausforderungen und Möglichkeiten diskutiert, die sich aus der Einbeziehung neurowissenschaftlicher und verhaltensökonomischer Erkenntnisse ergeben.
Schlüsselwörter
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Neurowissenschaft, Neuroökonomie und Verhaltensökonomie im Kontext der Finanzkommunikation. Insbesondere werden die Konzepte von kognitiven Prozessen, Biases und Heuristiken sowie die Kritik am Modell des Homo oeconomicus im Hinblick auf die Gestaltung von Produktinformationsblättern analysiert. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss dieser Erkenntnisse auf die Verständlichkeit, Transparenz und Vergleichbarkeit von PIBs und untersucht die Möglichkeiten zur Verbesserung der Finanzkommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein PIB im Finanzbereich?
Ein PIB ist ein Produktinformationsblatt. Seit Juli 2011 sind diese zwei- bis dreiseitigen Blätter für die Anlageberatung gesetzlich vorgeschrieben, um Transparenz zu schaffen.
Warum kritisiert die Verhaltensökonomik das Modell des „Homo oeconomicus“?
Die Verhaltensökonomik zeigt auf, dass Menschen nicht rein rational handeln, sondern durch unbewusste Vorgänge, Biases (Verzerrungen) und Heuristiken (Faustregeln) beeinflusst werden.
Welche Rolle spielt die Neuroökonomie in dieser Arbeit?
Die Neuroökonomie untersucht die biologischen und kognitiven Prozesse im Gehirn bei wirtschaftlichen Entscheidungen, um die Gestaltung von Informationen wie PIBs zu optimieren.
Wie können PIBs durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse verbessert werden?
Durch eine übersichtlichere Gestaltung, leicht verständliche Vermittlung von Risiko und Rendite sowie eine bessere Vergleichbarkeit, die den tatsächlichen kognitiven Prozessen der Anleger entspricht.
Was war der Anlass für die stärkere Regulierung der Anlageberatung in Deutschland?
Insbesondere die Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise und Fälle von Falschberatung (z. B. im Kontext der Lehman-Brothers-Insolvenz) führten zu strengeren Vorschriften.
Welche Anforderungen müssen moderne Produktinformationsblätter erfüllen?
Sie müssen Informationen zu Risiko, Rendite, Kosten und Transparenz so aufbereiten, dass sie für den Verbraucher tatsächlich nutzbar und vergleichbar sind.
- Quote paper
- Carlo Schlichterle (Author), 2012, Die Erkenntnisse der Neurowissenschaften und -ökonomik. Verhaltensökonomik und die Konsequenzen zur Erstellung von Produktinformationsblättern für Finanzprodukte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412728