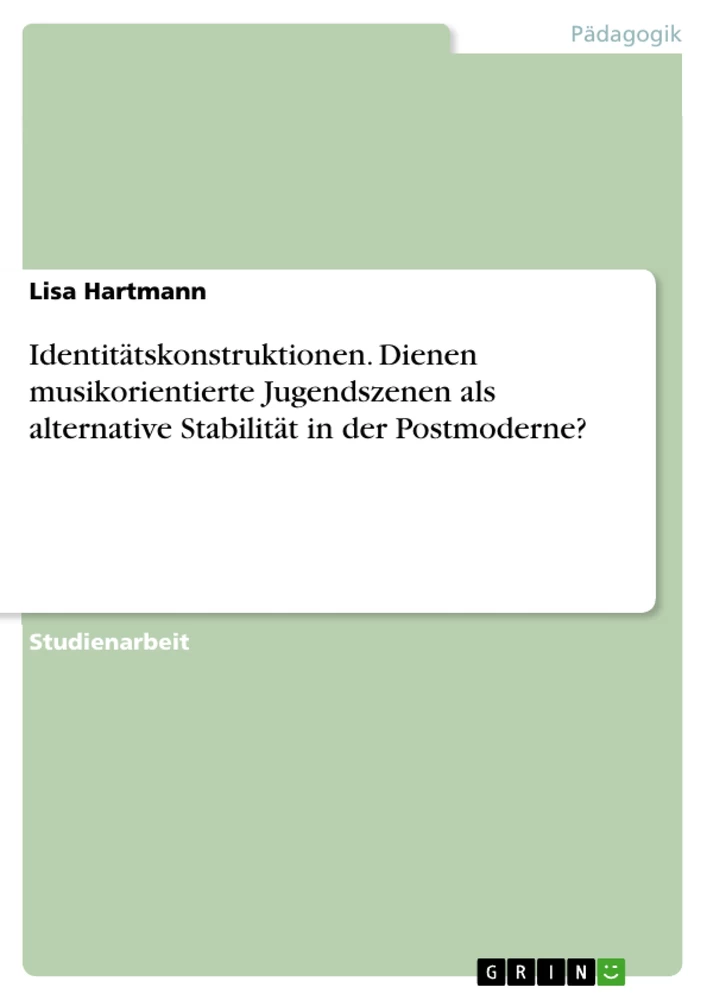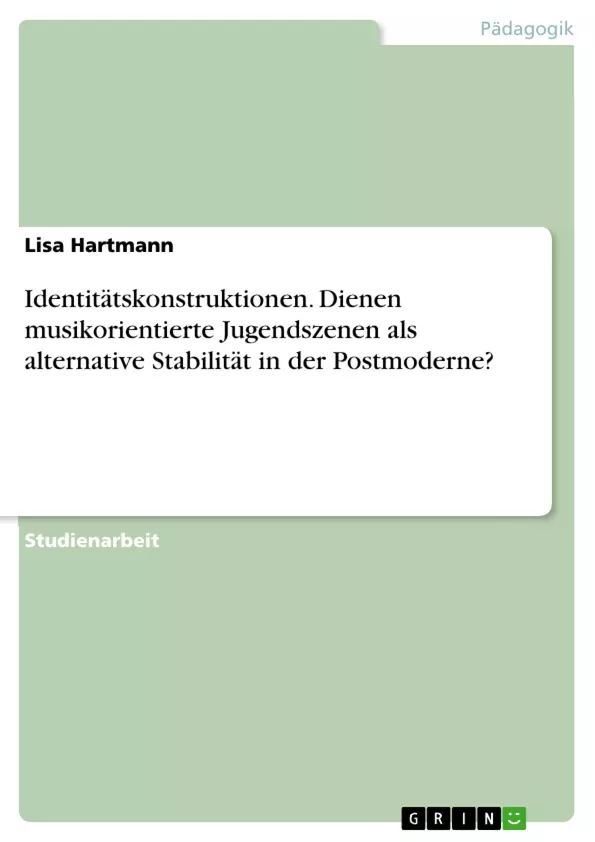Die Anforderung Welschs, dass jedes Individuum seine Hybridität entdecken und wertschätzen soll, um mit der transkulturellen Gesellschaft besser zurecht zu kommen, steckt hohe Ziele und möglicherweise zu hohe Ansprüche. Transkulturalität als solche zu erkennen und ausleben zu können, sich bewusst zu sein, dass sie frei ausgelebt werden kann, erfordert von jedem Individuum einen eigenständigen, vernunftbetonten Zugang. Diese Aufgabe ist möglicherweise von manchen Teilen der Bevölkerung nicht zu bewältigen. Denn die schwindende Rolle der Nationalkultur kann zur Entgrenzung der kulturellen Identität eines Individuums führen. Auch Klaus P. Hansen sieht die Anzeichen für die Einschränkung der nationalen Ebenen (vgl. Hansen), doch betont er, dass sie „politische Kräftefelder und internationale Ordnungsmuster“ (Hansen) darstellen, welche aktuell von Wichtigkeit für die Individuen und die gesellschaftliche Struktur sind. Wenn die Individuen nicht in der Lage sind sich über eine „nationale Identität“ oder deutsche, chinesische, französische „Leitkultur“ zu definieren, könnten sie sich verloren oder haltlos fühlen. So besteht für manche die Gefahr sich in politisch fanatische und extreme Richtungen zu flüchten, um Sicherheit bezüglich ihrer Identität zu erlangen.
Es soll herausgearbeitet werden, ob die kulturelle Entgrenzung der Identität, welche Jugendliche erfahren könnten, mit alternativen Mitteln, genauer mit dem Anschluss an musikorientierte Jugendkulturen, ausgeglichen werden kann.
Um die Rahmenbedingungen besser erfassen zu können, soll versucht werden die Begriffe der Postmoderne und der Globalisierung näher zu erläutern, um aus diesen heraus die kulturelle Entbettung der Individuen zu erklären. Daraufhin soll die besondere Situation Jugendlicher skizziert werden. Hiernach folgen eine Abgrenzung der Gegensubkulturen von den Teilsubkulturen und die Einordnung der musikorientierten Jugendszenen. Im Anschluss daran sollen gewählte Beispiele dieser musikorientierten Jugendszenen schlaglichtartig vorgestellt werden. An den von Herder festgelegten Merkmalen des traditionellen Kulturmodells wird daraufhin überprüft, ob diese Szenen ebenso eine vermeintliche Stabilität und Sicherheit bieten wie das traditionelle Kulturmodell und ob sie einen Beitrag zur Identitätskonstruktion leisten können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Gedanken
- Umgestaltete Welt
- Postmoderne
- Globalisierung
- Die jugendliche Suche nach Identität
- Ein Jugendlicher- Was ist das?
- Subkulturen: Die Differenz zwischen Gegenkultur und Teilkultur
- Die Szene als Kulturersatz
- Gewählte Beispiele musikorientierter Szenen…
- Black Metal
- Gothic
- Hip-Hop
- Indie
- Existieren Merkmale des traditionellen Kulturmodells in Musikszenen?
- Die Szenen als Beitrag zu Identitätskonstruktionen Jugendlicher
- Gewählte Beispiele musikorientierter Szenen…
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Frage, ob musikorientierte Jugendszenen als alternative Stabilität in der Postmoderne dienen können, indem sie die kulturelle Entgrenzung der Identität, die Jugendliche in der heutigen Welt erleben, kompensieren können.
- Die Auswirkungen der Postmoderne und Globalisierung auf die kulturelle Identität
- Die Rolle von Subkulturen und Jugendszenen bei der Identitätsfindung
- Die Frage, ob musikorientierte Jugendszenen Merkmale des traditionellen Kulturmodells aufweisen
- Die Bedeutung von Musik für die Identitätskonstruktion von Jugendlichen
- Die Potenziale und Grenzen von musikorientierten Jugendszenen als alternative Stabilität
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und zeigt die Herausforderungen der kulturellen Entgrenzung in der heutigen Zeit auf.
- Kapitel 2 erläutert die Konzepte der Postmoderne und Globalisierung und deren Auswirkungen auf die kulturelle Identität.
- Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Suche nach Identität in der Jugend und grenzt Gegenkulturen von Teilkulturen ab.
- Kapitel 4 analysiert die Rolle von musikorientierten Jugendszenen als Kulturersatz und untersucht, ob diese Merkmale des traditionellen Kulturmodells aufweisen.
Schlüsselwörter
Postmoderne, Globalisierung, Jugendkultur, Subkultur, Identitätskonstruktion, Musik, Transkulturalität, Hybridität, Leitkultur, Black Metal, Gothic, Hip-Hop, Indie.
Häufig gestellte Fragen
Dienen musikorientierte Jugendszenen als Identitätsersatz in der Postmoderne?
Ja, die Arbeit untersucht, ob Szenen wie Black Metal, Gothic oder Hip-Hop die kulturelle Entgrenzung und den Verlust nationaler Identität kompensieren können, indem sie Stabilität und Sicherheit bieten.
Was bedeutet „kulturelle Entgrenzung“ für Jugendliche?
Durch Globalisierung und Postmoderne verlieren traditionelle Leitkulturen an Bedeutung. Jugendliche fühlen sich oft haltlos und suchen in Subkulturen nach neuen Zugehörigkeiten und Werten.
Was ist der Unterschied zwischen Gegenkultur und Teilkultur?
Gegenkulturen lehnen die Mehrheitsgesellschaft aktiv ab, während Teilkulturen (Subkulturen) spezifische Nischen besetzen, ohne zwingend im totalen Widerspruch zur Gesamtstruktur zu stehen.
Welche Musikszenen werden in der Arbeit als Beispiele genannt?
Die Arbeit analysiert schlaglichtartig die Szenen Black Metal, Gothic, Hip-Hop und Indie im Hinblick auf ihre stabilisierende Wirkung für die Identitätskonstruktion.
Bieten moderne Jugendszenen ähnliche Strukturen wie traditionelle Kulturen?
Die Arbeit überprüft die Szenen anhand von Herders Merkmalen des traditionellen Kulturmodells, um festzustellen, ob sie vergleichbare Sicherheit und Identifikationsmerkmale liefern.
Was ist Transkulturalität nach Welsch?
Transkulturalität beschreibt die Entdeckung der eigenen Hybridität in einer globalisierten Welt. Die Arbeit hinterfragt, ob dieser Anspruch für alle Individuen ohne alternative Stabilitätsanker erfüllbar ist.
- Quote paper
- Diplom Pädagogin Lisa Hartmann (Author), 2013, Identitätskonstruktionen. Dienen musikorientierte Jugendszenen als alternative Stabilität in der Postmoderne?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412892