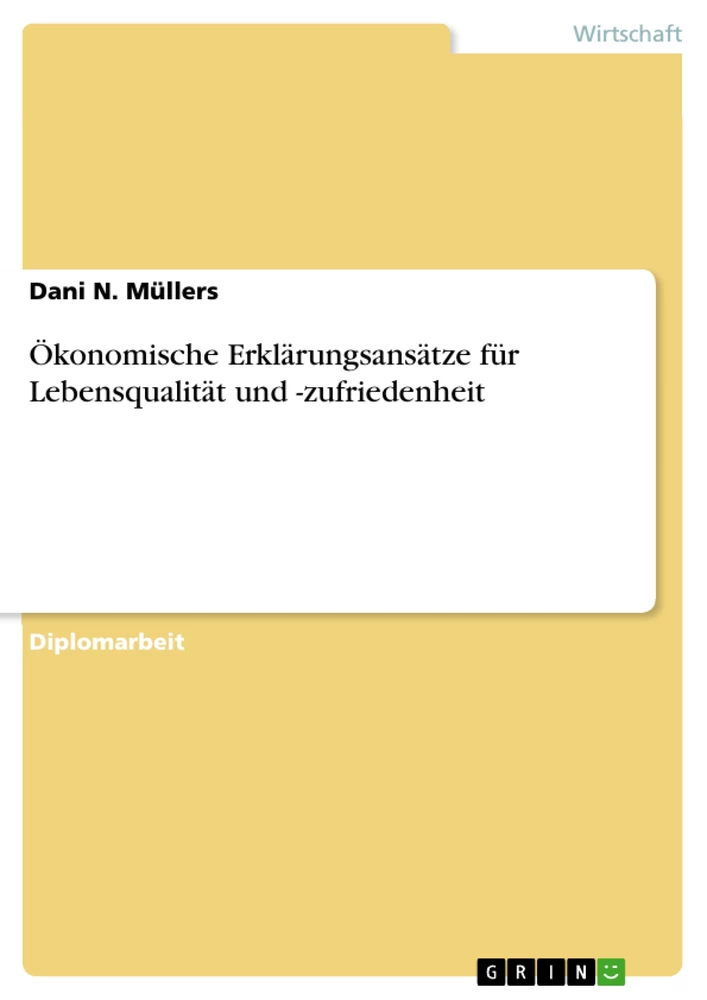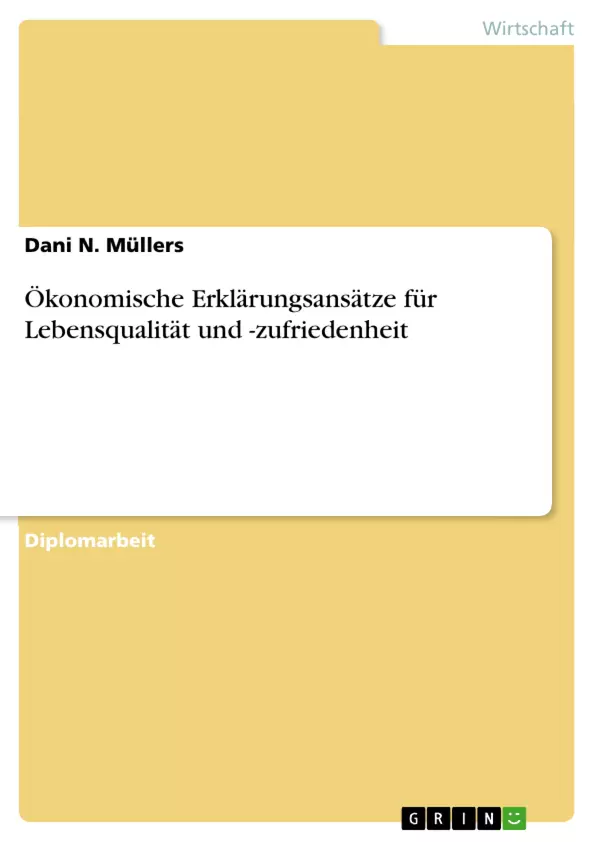Die Beschäftigung mit dem Thema des Glücks, der Lebensqualität und -zufriedenheit sowie dem subjektives Wohlbefinden hat in der ökonomischen Forschungsliteratur in den letzten Jahren einen deutlichen Auftrieb erlebt. Sie ist dabei zu einem bedeutenden Untersuchungsgebiet in der Ökonomik herangewachsen. So nahm die Anzahl der in EconLit verzeichneten Zeitschriftenartikel, die die Begriffe „Happiness“, „Lebenszufriedenheit“ oder „subjektives Wohlbefinden“ im Titel oder Abstract enthalten, in den letzten Jahren, vor allem nach der Jahrtausendwende, deutlich zu. Waren es zwischen 1960 und 1989 noch 57 Artikel, verdoppelte sich diese Zahl in den 1990er Jahren nahezu auf insgesamt 112 Zeitschriftenaufsätze. In den darauf folgenden Jahren 2000 bis 2003 setzte sich dieser Trend weiter fort und konnten 148 Einträge, sowie allein für das Jahr 2011 wiederum 146 Artikel verzeichnet werden.
Dass sich die Ökonomik mit dem Thema des Glücks, subjektiven Wohlbefindens, der Lebenszufriedenheit und Lebensqualität des Menschen auseinandersetzt, mag auf den ersten Blick überraschend oder ungewohnt erscheinen. Sind Fragestellungen und die Analyse dessen, was Glück, Lebenszufriedenheit, Lebensqualität und subjektives Wohlbefinden eigentlich sind und ausmachen, wie und wodurch sie entstehen sowie ob und wie sie erreicht werden können, doch ein zentraler Gegenstand der Philosophie, der Psychologie und weiterer sozial- und geisteswissenschaftlicher Disziplinen.
Jedoch wird seitens einiger Autoren argumentiert, dass die Auseinandersetzung mit dieser Thematik auch für die Ökonomik von Relevanz sei, da das Ziel und der Zweck wirtschaftlichen Handelns letztendlich in der Erhöhung menschlicher Wohlfahrt liege, und ökonomisches Handeln sowie der Kauf und Besitz von Gütern die Aufgabe und Intension in sich trage, zum individuellen, menschlichen Wohlbefinden beizutragen. Dies findet sich auch in der Mikroökonomik in der zentralen Bedeutung des Nutzenkonzepts und der individuellen Nutzenmaximierung in gewisser Weise wieder.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Zu den Begriffen – Inhaltliche Bestimmung und Abgrenzungen
- 2.2 Interdisziplinarität und theoretische Erklärungsansätze
- 2.3 Historischer Abriss aus ökonomischer Perspektive
- 2.4 Objektivistischer versus subjektivistischer Ansatz
- 2.5 Zusammenfassung
- 3 Messung und Erhebung subjektiven Wohlbefindens
- 3.1 Mess- und Erhebungsansätze
- 3.1.1 Selbsteinschätzung durch Befragung
- 3.1.2 Weitere Ansätze
- 3.1.3 Gegenüberstellung der verschiedenen Messansätze
- 3.2 Zur Aussagekraft und interkulturellen Vergleichbarkeit der Messung subjektiven Wohlbefindens
- 3.2.1 Gütekriterien und bestätigende Indikatoren
- 3.2.2 Interpersonelle und intertemporale Vergleichbarkeit
- 3.2.3 Formate und Termini der Befragung
- 3.2.4 Effekte des Antwortformats
- 3.2.5 Soziale Erwünschtheit und Kontexteffekte
- 3.2.6 Unterschiede in der Teilnahmebereitschaft
- 3.2.7 Vergleichbarkeit zwischen Ländern, Kulturen und Sprachen
- 3.3 Fazit zur Messung und Erhebung subjektiven Wohlbefindens
- 4 Überblick zur Bedeutung ökonomischer, institutioneller und nicht-ökonomischer Einflussgrößen für das subjektive Wohlbefinden
- 4.1 Systematisierung der Einflussgrößen
- 4.2 Der ökonometrische Modell- und Schätzansatz
- 4.2.1 Darstellung des Modell- und Schätzansatzes
- 4.2.2 Schwierigkeiten und Lösungsansätze
- 4.3 Individuelles und nationales Einkommen
- 4.3.1 Theoretische Erklärungsansätze
- 4.3.2 Empirische Befunde - Individuelles Einkommen
- 4.3.3 Empirische Befunde - Nationales Einkommen im Ländervergleich
- 4.3.4 Empirische Befunde - Nationales Einkommen im Zeitverlauf
- 4.3.5 Easterlin-Paradox und psychologische Erklärungsansätze
- 4.3.6 Fazit und kritische Anmerkungen
- 4.4 Konsum
- 4.4.1 Erklärung des Easterlin-Paradox mittels des Konsums von Positionsgütern
- 4.4.2 Abweichungen von der Theorie rationaler Entscheidungen
- 4.5 Einkommensungleichheit
- 4.6 Sozialstaatliche und institutionelle Rahmenbedingungen
- 4.6.1 Sozialstaatliche Absicherung
- 4.6.2 Politische Institutionen
- 4.7 Weitere ökonomische Einflussgrößen
- 4.7.1 Inflationsrate
- 4.7.2 Ausbildungsgrad
- 4.8 Weitere nicht-ökonomische Einflussgrößen
- 4.8.1 Alter
- 4.8.2 Geschlecht
- 4.8.3 Persönliche Anlagen
- 4.8.4 Gesundheit
- 4.8.5 Soziale Kontakte und Beziehungen
- 4.8.6 Religiosität
- 4.9 Weitere diskutierte Einflussgrößen
- 5 Bedeutung arbeitsbezogener Größen für das subjektive Wohlbefinden
- 5.1 Individuelle Arbeitslosigkeit
- 5.1.1 Theoretische Erklärungsansätze
- 5.1.2 Empirische Befunde
- 5.1.3 Fazit
- 5.2 Allgemeine Arbeitslosigkeit
- 5.2.1 Theoretische Erklärungsansätze
- 5.2.2 Empirische Befunde und Fazit
- 5.3 Zielkonflikt zwischen Inflationsrate und Arbeitslosenquote
- 5.4 Weitere arbeitsbezogene Einflussgrößen
- 5.4.1 Vollzeit- versus Teilzeit-Erwerbsbeschäftigung
- 5.4.2 Selbständige Erwerbstätigkeit versus abhängige Beschäftigung
- 5.4.3 Ruhestand
- 5.4.4 Weitere arbeitsbezogene Aktivitäten
- 6 Zusammenführung der empirischen Ergebnisse und weitere relevante Aspekte bezüglich der Bestimmung von Einflussgrößen auf das subjektive Wohlbefinden
- 6.1 Zusammenführung der empirischen Ergebnisse
- 6.2 Psychologische Setpoint-Theorie und bereichsspezifische Gewöhnungseffekte
- 6.3 Methodische Aspekte und Anmerkungen
- 7 Politische Schlussfolgerungen
- 7.1 Wohlwollender Diktator versus konstitutioneller und prozeduraler Ansatz
- 7.2 Politische Handlungsempfehlungen
- 7.2.1 Einkommen und Konsum
- 7.2.2 Einkommensungleichheit sowie sozialstaatliche und institutionelle Rahmenbedingungen
- 7.2.3 Individuelle und allgemeine Arbeitslosigkeit sowie weitere arbeitsbezogene Größen
- 7.2.4 Inflationsrate und Ausbildungsgrad
- 7.2.5 Gesundheit sowie Soziale Kontakte und Beziehungen
- 7.2.6 Zusammenfassung
- 7.3 Informationsbereitstellung an politische Entscheidungsträger
- 7.3.1 Bemessung des Nutzenwerts öffentlicher Güter
- 7.3.2 Aggregierte Wohlfahrtsindizes und -indikatoren auf Basis von Angaben zum subjektiven Wohlbefinden
- 7.3.3 Zusammenfassung
- 7.4 Kritische Anmerkungen und offene Punkte hinsichtlich der Bestimmung politischer Schlussfolgerungen
- 7.5 Zusammenfassung
- 8 Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, wie sich ökonomische Faktoren auf die Lebensqualität und -zufriedenheit auswirken. Sie verfolgt das Ziel, verschiedene ökonomische Erklärungsansätze für subjektives Wohlbefinden zu analysieren und die empirischen Befunde zu bewerten.
- Messung und Erhebung subjektiven Wohlbefindens
- Ökonomische Einflussfaktoren auf subjektives Wohlbefinden
- Bedeutung arbeitsbezogener Größen für das subjektive Wohlbefinden
- Politische Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen
- Methodische Aspekte und kritische Anmerkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einführung in die Thematik und stellt die Forschungsfrage sowie die Zielsetzung der Arbeit vor. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Konzepts der Lebensqualität und -zufriedenheit und diskutiert verschiedene ökonomische Erklärungsansätze. Kapitel 3 befasst sich mit der Messung und Erhebung subjektiven Wohlbefindens, einschließlich der verschiedenen Messansätze, der Gütekriterien und der interkulturellen Vergleichbarkeit. In Kapitel 4 werden die wichtigsten ökonomischen, institutionellen und nicht-ökonomischen Einflussfaktoren auf das subjektive Wohlbefinden systematisiert und ihre Bedeutung anhand empirischer Befunde beleuchtet. Kapitel 5 untersucht die Bedeutung arbeitsbezogener Größen wie Arbeitslosigkeit, Erwerbstätigkeit und Arbeitsbedingungen für das subjektive Wohlbefinden. Kapitel 6 führt die empirischen Ergebnisse zusammen und diskutiert weitere relevante Aspekte bezüglich der Bestimmung von Einflussgrößen auf das subjektive Wohlbefinden. Kapitel 7 leitet aus den empirischen Ergebnissen politische Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen ab, wobei sowohl die Rolle des Staates als auch die Informationsbereitstellung an politische Entscheidungsträger betrachtet werden. Schließlich bietet Kapitel 8 ein Resümee der Ergebnisse und einen Ausblick auf zukünftige Forschungsbedarfe.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Lebensqualität, Lebenszufriedenheit, subjektives Wohlbefinden, ökonomische Erklärungsansätze, Messung, Erhebung, Einflussfaktoren, Arbeitslosigkeit, Einkommensungleichheit, Sozialstaat, politische Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum beschäftigt sich die Ökonomik mit dem Thema Glück?
Weil das Ziel wirtschaftlichen Handelns letztlich die Erhöhung der menschlichen Wohlfahrt und des individuellen Wohlbefindens ist, was über das reine Nutzenkonzept hinausgeht.
Was ist das Easterlin-Paradox?
Es beschreibt den Befund, dass ein höheres nationales Einkommen ab einem gewissen Punkt nicht mehr zu einer weiteren Steigerung der durchschnittlichen Lebenszufriedenheit führt.
Wie wird subjektives Wohlbefinden in Studien gemessen?
Meist erfolgt die Messung durch großangelegte Befragungen zur Selbsteinschätzung der Lebenszufriedenheit auf einer numerischen Skala.
Welchen Einfluss hat Arbeitslosigkeit auf die Lebenszufriedenheit?
Individuelle Arbeitslosigkeit hat einen massiven negativen Effekt auf das Wohlbefinden, der weit über den reinen Einkommensverlust hinausgeht (psychische Belastung).
Spielen nicht-ökonomische Faktoren wie Gesundheit eine Rolle?
Ja, Faktoren wie Gesundheit, soziale Kontakte, Alter und Religiosität sind wesentliche Einflussgrößen für das subjektive Wohlbefinden.
- Citar trabajo
- Dani N. Müllers (Autor), 2017, Ökonomische Erklärungsansätze für Lebensqualität und -zufriedenheit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412956