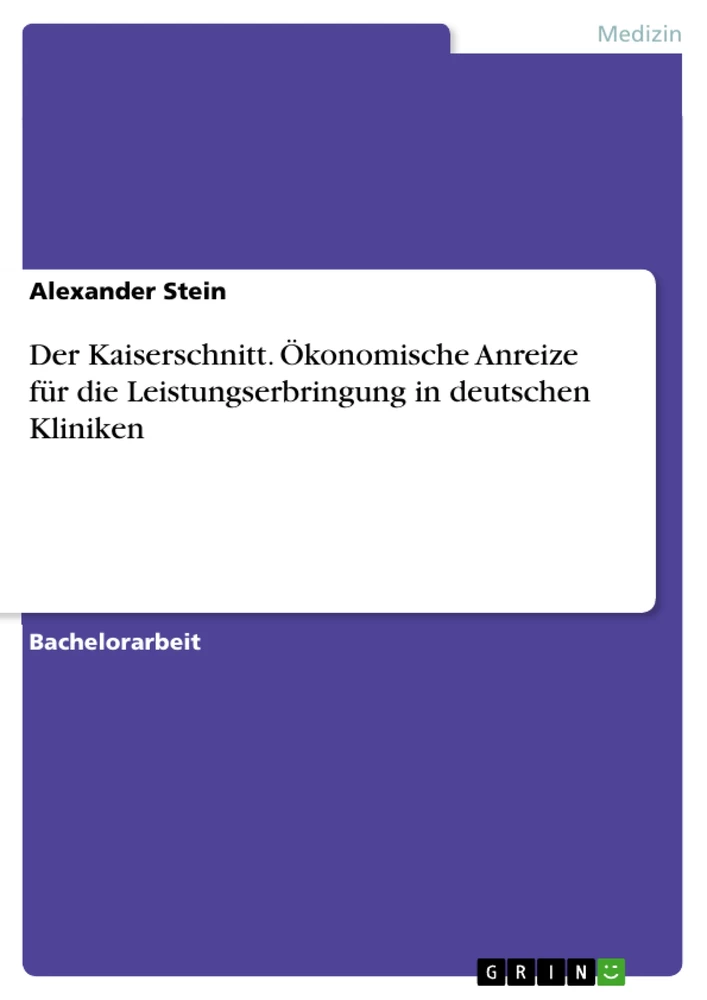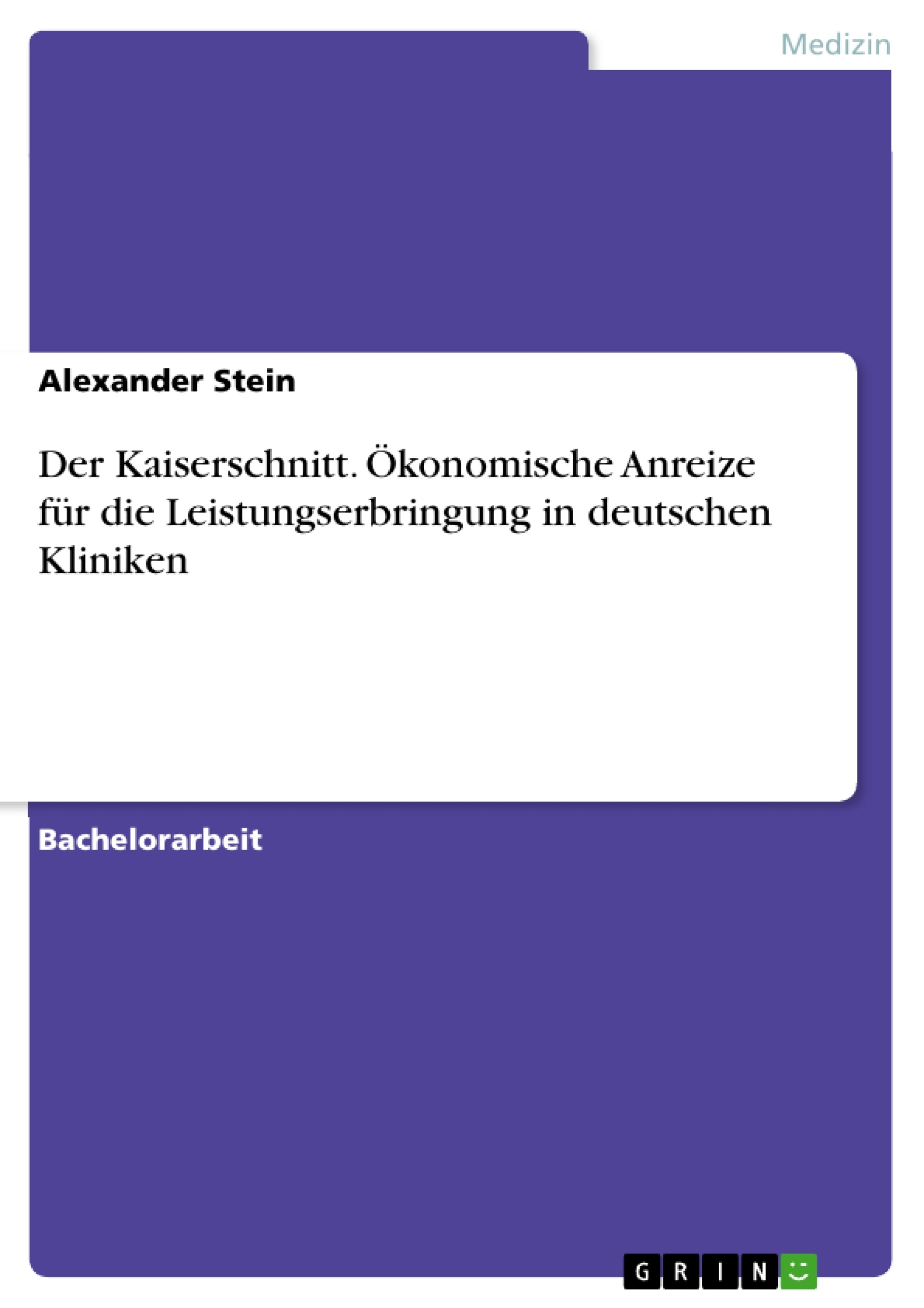Der Kaiserschnitt wurde und wird auch heute noch als Segen des medizinischen Fortschritts angesehen, mit dem der Legende nach auch schon der römische Kaiser Julias Cäsar entbunden wurde und dessen Namensgeber er ist (Sectio caesarea). Nicht nur im Industrieland Deutschland, sondern vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern mit teilweise prekärer medizinischer Versorgung, ist der Kaiserschnitt zu einer unverzichtbaren lebensrettenden Maßnahme für Kind und Mutter geworden.
In medizinischen Fachkreisen werden die kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen eines Kaiserschnitts intensiv diskutiert. Im Rahmen dieser Diskussion werden neben den medizinischen Auswirkungen für Kind und Mutter zunehmend auch die volkswirtschaftlichen Folgen für das Gesundheitssystem untersucht. Wegen der betriebswirtschaftlichen Herausforderungen und des enormen Kostendrucks der deutschen Kliniken werden häufig Instrumente eingesetzt, die unter wirtschaftlichen und medizinischen Aspekten sinnvoll sind. Allerdings werden dabei auch Instrumente eingesetzt, die unter eben diesen Aspekten fragwürdig erscheinen. Die Leistungserbringer stehen somit in einem dauerhaften Loyalitätskonflikt, bei dem einerseits die wirtschaftlichen Interessen des Arbeitsgebers bzw. des Krankenhauses befriedigt werden sollen, andererseits aber auch die optimale Behandlung des Patienten angestrebt werden soll. In der öffentlichen Diskussion steht deshalb immer wieder die Frage im Raum, ob manche Operationen medizinisch überhaupt notwendig sind oder ob die Leistungserbringer nicht primär wirtschaftliche Interessen verfolgen. Bereits im Jahr 2016 wurde in Deutschland fast jedes dritte Kind per Kaiserschnitt entbunden - in der Türkei sogar jedes zweite. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass lediglich nur jeder zehnte Kaiserschnitt medizinisch überhaupt notwendig ist.
Ziel dieser Arbeit ist es, die einzelnen Aspekte und besonders die ökonomischen Anreize aufzuzeigen und diese dabei kritisch zu examinieren. Es soll am Beispiel der Sectio aufgezeigt werden, welche Aspekte die Entscheidungsfindung zur Durchführung einer bestimmten Maßnahme beeinflussen und mit welcher Begründung diese in den deutschen Kliniken durchgeführt werden. Es wird dabei untersucht, inwiefern besonders ökonomische Anreize für die Leistungserbringung in den deutschen Kliniken bei der Entscheidung zur Durchführung eines Kaiserschnitts ausschlaggebend sind und inwiefern diese für die Entwicklung der Sectioraten verantwortlich sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung, Zielsetzung, Forschungsfrage
- Vorgehensweise
- Gestation und Entbindung
- Sectio caesarea
- Absolute Indikation
- Relative Indikation
- Primäre und sekundäre Sectio caesarea
- Ethische Aspekte und rechtliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung der Sectioraten
- Medizinscher Fortschritt
- Räumliche, demografische und sozioökonomische Unterschiede
- Aus- und Weiterbildung
- Haftungsrechtliche Aspekte
- Ökonomische Anreize
- Klinikorganisatorische Gründe
- Ressourceneinsatz innerhalb des Klinikbetriebes
- Belegfachabteilungen
- Vergütungsanreize durch das DRG-Abrechnungssystem
- Grundlagen
- Vereinheitlichung, Rechengrößen und Berechnung
- Betriebswirtschaftliche Aspekte
- Volkswirtschaftliche Aspekte
- Internationaler Kontext
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die ökonomischen Anreize für die Leistungserbringung in deutschen Kliniken am Beispiel der Sectio caesarea. Sie analysiert die Gründe für den stetigen Anstieg der Sectioraten in Deutschland und beleuchtet die Rolle des DRG-Systems in diesem Kontext.
- Analyse der ökonomischen Anreize bei der Entscheidung für eine Sectio caesarea
- Bedeutung des DRG-Systems für die Entwicklung der Sectioraten
- Untersuchung der Auswirkungen von Klinikorganisation und Ressourceneinsatz auf die Entscheidung für eine Sectio caesarea
- Diskussion der ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Sectio caesarea
- Einbezug des internationalen Kontexts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der ökonomischen Anreize bei der Leistungserbringung in deutschen Kliniken am Beispiel der Sectio caesarea ein. Sie stellt die Problemstellung, die Zielsetzung und die Forschungsfrage vor.
Das zweite Kapitel beleuchtet die medizinischen Grundlagen der Gestation und Entbindung, insbesondere die verschiedenen Indikationen für eine Sectio caesarea sowie die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen.
Das dritte Kapitel untersucht die Entwicklung der Sectioraten in Deutschland und analysiert die verschiedenen Einflussfaktoren, darunter der medizinische Fortschritt, räumliche, demografische und sozioökonomische Unterschiede sowie Aus- und Weiterbildungs- und haftungsrechtliche Aspekte.
Das vierte Kapitel analysiert die ökonomischen Anreize im Detail, einschließlich der klinikorganisatorischen Gründe, der Vergütungsanreize durch das DRG-Abrechnungssystem und der volkswirtschaftlichen Aspekte.
Schlüsselwörter
Sectio caesarea, Kaiserschnitt, ökonomische Anreize, DRG-System, Klinikorganisation, Ressourceneinsatz, Vergütung, Gesundheitsökonomie, Sectiorate, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Deutschland, internationaler Kontext, ethische Aspekte, rechtliche Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum steigen die Kaiserschnittraten in Deutschland so stark an?
Neben medizinischem Fortschritt spielen vor allem ökonomische Anreize, klinikorganisatorische Gründe und das DRG-Abrechnungssystem eine entscheidende Rolle.
Welchen Einfluss hat das DRG-System auf die Sectiorate?
Das DRG-Abrechnungssystem schafft Vergütungsanreize, die eine operative Entbindung finanziell attraktiver machen können als eine natürliche Geburt.
Was ist der Unterschied zwischen absoluter und relativer Indikation?
Eine absolute Indikation macht den Kaiserschnitt medizinisch zwingend lebensrettend, während eine relative Indikation Ermessensspielräume lässt, die oft ökonomisch beeinflusst werden.
Welche Rolle spielen haftungsrechtliche Aspekte?
Die Angst vor rechtlichen Konsequenzen bei Komplikationen während einer natürlichen Geburt führt oft zur Entscheidung für einen vermeintlich „sichereren“ Kaiserschnitt.
Wie viele Kaiserschnitte sind medizinisch wirklich notwendig?
Schätzungen zufolge ist lediglich jeder zehnte Kaiserschnitt medizinisch absolut notwendig, obwohl fast jedes dritte Kind operativ entbunden wird.
Was ist der „Loyalitätskonflikt“ der Leistungserbringer?
Ärzte stehen oft zwischen den wirtschaftlichen Interessen des Krankenhauses und der medizinisch optimalen Behandlung der Patientin.
- Citation du texte
- Alexander Stein (Auteur), 2018, Der Kaiserschnitt. Ökonomische Anreize für die Leistungserbringung in deutschen Kliniken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413186