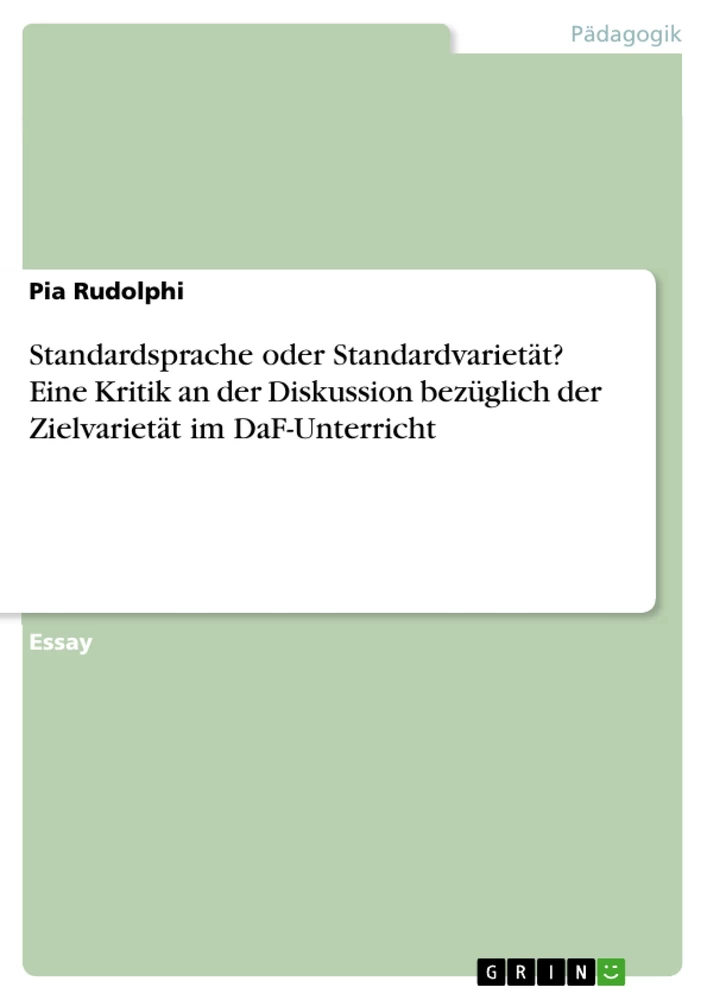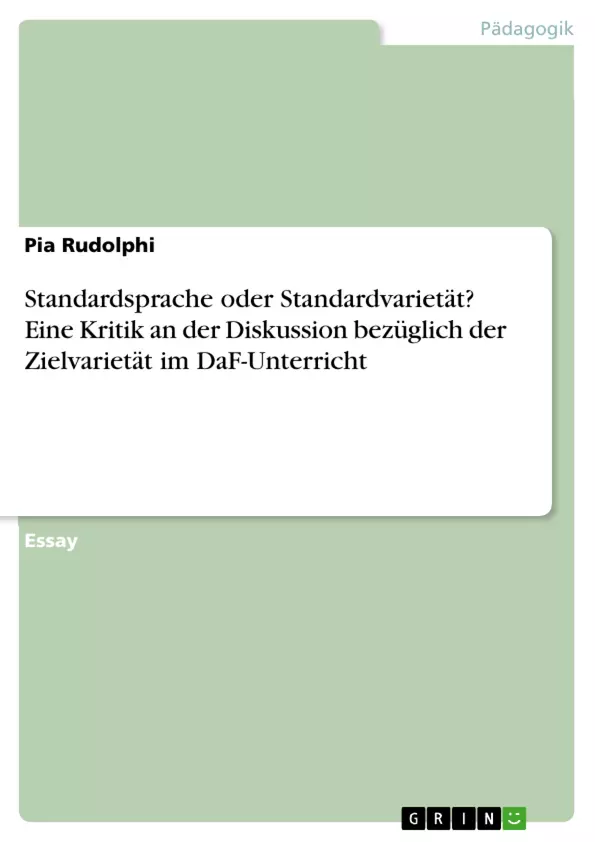Man könnte annehmen, dass es ein leichtes sei, die deutsche Sprache als Fremdsprache zu unterrichten und zu erlernen. Als Orientierung der Schriftlichkeit dienen die deutsche Rechtschreibung sowie die Grammatik. Im sprechsprachlichen Bereich kann man sich an den orthographischen Vorgaben für die Standardsprache orientieren, wie man sie in Wörterbüchern oder Aussprachewörterbüchern findet. Wie kann es dann dennoch zu Problemen im Sprachkontakt kommen?
Bis Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts war es kaum problematisch, sich für eine angemessene Sprache zu entscheiden. Aufgrund des damaligen diglossischen Verhältnisses von Standardsprache auf der einen und den Dialekten auf der anderen Seite. Diese Diglossie durchlief jedoch in den letzten Jahrzehnten einige Veränderungen.
Die bekannteste Veränderung ist wohl der Rückgang des Gebrauches verschiedener Dialekte (Dialektabbau). Doch die sprachliche Entwicklung zeigte nicht nur auf dialektaler Ebene einen Rückgang, sondern auch eine Abkehr der Sprecher von standardsprachlichen Normen (Standardabbau). Bellmann (1983) benannte die Veränderungen in der deutschen Sprache schon in den 80er Jahren als den „Neuen Substandard“: eine Sprachvarietät, die sich sowohl standardsprachlicher als auch dialektaler Elemente bedient.
Inhaltsverzeichnis
- Standardsprache oder Standardvarietät?
- Standardsprache: Konstrukt vs. Ideologie
- Ideologie vs. Realität: Die Folgen für den DaF-Lerner
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Kritik an der Fokussierung auf die Standardsprache im Deutsch als Fremdsprache (DaF)-Unterricht. Er hinterfragt die Annahme, dass die Standardsprache das alleinige Ziel des Spracherwerbs sein sollte.
- Der Wandel der deutschen Sprache und der Rückgang der Standardsprache
- Die Rolle der regionalen Varietäten im DaF-Unterricht
- Die ideologischen Aspekte der Standardsprache im DaF-Unterricht
- Die Konsequenzen der Fokussierung auf die Standardsprache für DaF-Lerner
- Analyse von DaF-Lehrmaterialien im Hinblick auf die Verwendung regionaler Varietäten
Zusammenfassung der Kapitel
Standardsprache oder Standardvarietät?: Der Essay beginnt mit der Feststellung, dass DaF-Lerner oft Schwierigkeiten haben, außerhalb des Unterrichts mit Muttersprachlern zu kommunizieren, die nicht die Standardsprache verwenden. Dies wird im Kontext des historischen Wandels der deutschen Sprache erläutert, der den Rückgang von Dialekten und eine Abkehr von standardsprachlichen Normen umfasst, was zu einer Vielzahl von Sprachvarietäten geführt hat. Das Modell von Baßler/Spiekermann (2001) veranschaulicht die Vielfalt regionaler Standards und Regionalsprachen, die im modernen Sprachgebrauch weit verbreitet sind. Die zentrale Frage ist, ob die Standardsprache angesichts dieser Entwicklung noch als alleiniges Ziel im DaF-Unterricht dienen sollte.
Standardsprache: Konstrukt vs. Ideologie: Dieses Kapitel argumentiert, dass die Standardsprache eher ein Konstrukt als eine tatsächlich angewandte Sprache ist. Die Behauptung, dass selbst geschulte Sprecher keinen variationsfreien Standard artikulieren können, wird angeführt. Die zunehmende Akzeptanz der Einbindung regionaler Varietäten im DaF-Unterricht wird beleuchtet, gestützt durch Umfragen unter Lehrern und Lernenden. Trotzdem hält ein Teil der DaF-Experten an der Standardsprache als alleinigem Spracherwerbsziel fest, was auf sprachliche Ideologien zurückgeführt wird, die auf Überzeugungen und nicht auf rationaler Erkenntnis basieren. Die weit verbreitete Vorstellung, dass das Erlernen und Verwenden der Standardsprache das elementare Interesse jedes Sprechers sei, wird als ideologische Annahme dargestellt.
Ideologie vs. Realität: Die Folgen für den DaF-Lerner: Das Kapitel beschreibt die Folgen der Diskrepanz zwischen der im DaF-Unterricht gelehrten Standardsprache und der tatsächlichen Sprachrealität für DaF-Lerner. Die daraus resultierenden Kommunikations- und Verständnisprobleme sowie die Irritation bei beiden Kommunikationspartnern werden angesprochen. Es wird gezeigt, dass trotz des seit den 1970er Jahren bestehenden Anspruchs auf eine „verständliche“ Aussprache, DaF-Lehrmaterialien weiterhin die Standardsprache priorisieren und regionale Varietäten vernachlässigen. Am Beispiel des Lehrwerks „Aussichten A1“ wird demonstriert, wie trotz anfänglicher Hinweise auf regionale Varietäten, der Fokus im weiteren Verlauf wieder auf standardsprachlichen Ausdrücken liegt, die im alltäglichen Sprachgebrauch weniger gebräuchlich sind.
Schlüsselwörter
Standardsprache, Standardvarietät, Dialekt, Regionalsprache, Deutsch als Fremdsprache (DaF), Spracherwerb, Sprachvariation, Sprachideologie, DaF-Unterricht, Lehrmaterialien, Kommunikationsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen zum Essay: Standardsprache im DaF-Unterricht
Was ist der Gegenstand des Essays?
Der Essay untersucht kritisch die ausschließliche Fokussierung auf die Standardsprache im Deutsch als Fremdsprache (DaF)-Unterricht. Er hinterfragt, ob die Standardsprache tatsächlich das alleinige Ziel des Spracherwerbs sein sollte und beleuchtet die Folgen einer solchen Fokussierung für DaF-Lerner.
Welche Themen werden im Essay behandelt?
Der Essay behandelt den Wandel der deutschen Sprache und den Rückgang der Standardsprache, die Rolle regionaler Varietäten im DaF-Unterricht, die ideologischen Aspekte der Standardsprache, die Konsequenzen der Fokussierung auf die Standardsprache für DaF-Lerner und die Analyse von DaF-Lehrmaterialien hinsichtlich der Verwendung regionaler Varietäten.
Welche Kapitel umfasst der Essay?
Der Essay besteht aus drei Hauptkapiteln: "Standardsprache oder Standardvarietät?", "Standardsprache: Konstrukt vs. Ideologie" und "Ideologie vs. Realität: Die Folgen für den DaF-Lerner". Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der kritischen Auseinandersetzung mit der Standardsprache im DaF-Unterricht.
Was ist die zentrale These des Essays?
Die zentrale These des Essays ist, dass die ausschließliche Fokussierung auf die Standardsprache im DaF-Unterricht unrealistisch und schädlich für DaF-Lerner ist. Die Standardsprache wird als Konstrukt dargestellt, das von der tatsächlichen Sprachrealität abweicht und zu Kommunikationsproblemen führen kann. Der Essay plädiert für eine stärkere Berücksichtigung regionaler Varietäten im Unterricht.
Welche Probleme werden durch die Fokussierung auf die Standardsprache aufgezeigt?
Die Fokussierung auf die Standardsprache führt laut dem Essay zu Kommunikations- und Verständnisproblemen zwischen DaF-Lernenden und Muttersprachlern, die regionale Varietäten verwenden. Die Diskrepanz zwischen der im Unterricht gelehrten Standardsprache und der tatsächlichen Sprachrealität irritiert beide Kommunikationspartner. DaF-Lehrmaterialien werden kritisiert, weil sie trotz des Anspruchs auf verständliche Aussprache oft die Standardsprache priorisieren und regionale Varietäten vernachlässigen.
Wie wird die Standardsprache im Essay charakterisiert?
Die Standardsprache wird im Essay als Konstrukt und nicht als natürlich angewandte Sprache dargestellt. Es wird argumentiert, dass selbst geschulte Sprecher keinen variationsfreien Standard artikulieren können. Die Beibehaltung der Standardsprache als alleiniges Ziel im DaF-Unterricht wird auf sprachliche Ideologien zurückgeführt, die auf Überzeugungen und nicht auf rationaler Erkenntnis basieren.
Welche Rolle spielen regionale Varietäten im Essay?
Regionale Varietäten spielen eine zentrale Rolle im Essay. Der Essay argumentiert für ihre Einbeziehung in den DaF-Unterricht, um die Lernenden auf die tatsächliche Sprachrealität vorzubereiten und ihre Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. Die Analyse von DaF-Lehrmaterialien zeigt jedoch, dass regionale Varietäten oft vernachlässigt werden.
Welche Schlüsselwörter sind für den Essay relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Standardsprache, Standardvarietät, Dialekt, Regionalsprache, Deutsch als Fremdsprache (DaF), Spracherwerb, Sprachvariation, Sprachideologie, DaF-Unterricht, Lehrmaterialien, Kommunikationsfähigkeit.
- Citar trabajo
- Pia Rudolphi (Autor), 2017, Standardsprache oder Standardvarietät? Eine Kritik an der Diskussion bezüglich der Zielvarietät im DaF-Unterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414018