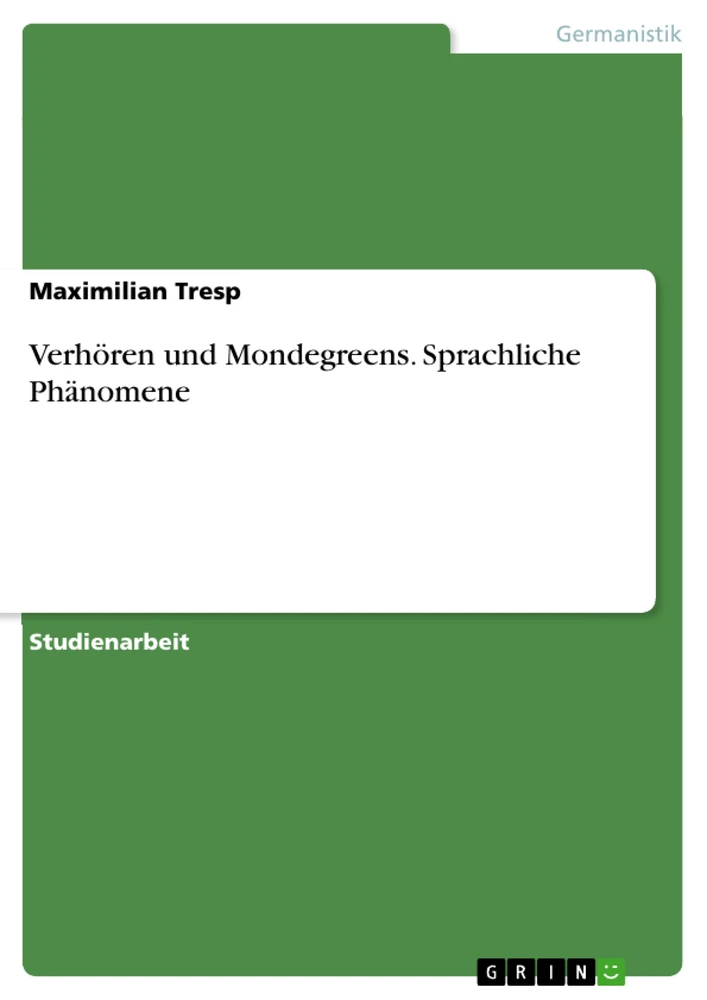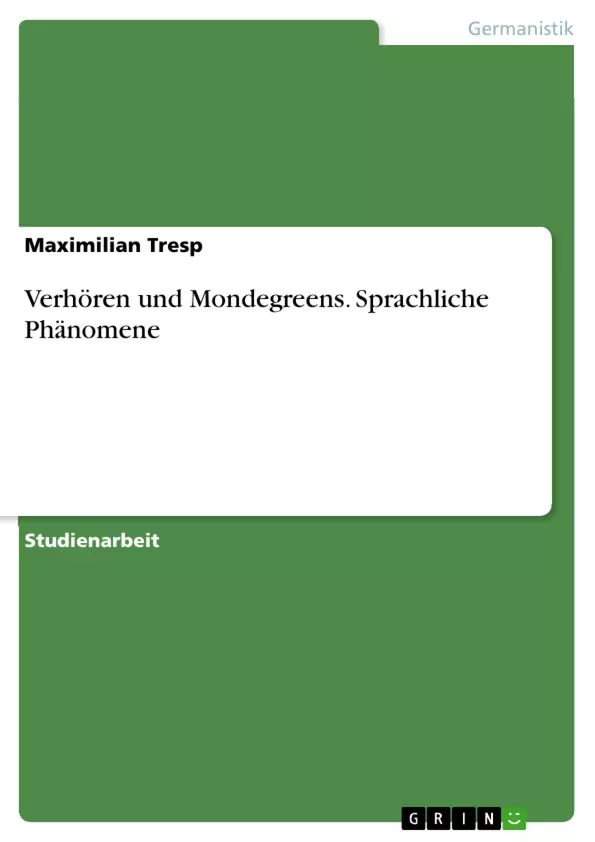Mit großer Sicherheit hat schon jeder Mensch erlebt, dass er etwas ganz anderes verstanden hat, als das, was gesagt wurde. Die meisten rechtfertigen das Missverständnis mit „da hab ich mich verhört“ und nur wenige mit „das hab ich falsch verstanden“. Letzteres impliziert (vielleicht für viele auch nur unbewusst) eine eigene kognitive Fehlleistung, nämlich das fehlerhafte Rekonstruieren und Analysieren des Gehörten. „Ich habe mich verhört“ beschreibt hingegen eine akustische Störung und zweifelt nicht an der eigenen kognitiven Leistung. Dennoch übt das Feld des Verhörens einen besonderen Reiz auf Menschen aus, sei es, weil sie selbst sich „verhörten“ und dadurch peinlich berührt sind, oder weil das Malheur einer anderen Person für Amüsement ihrerseits führt. Der Verfasser entschied sich für diese Thematik, da er selbst als Kind in der Grundschule zum „Opfer“ des Missverstandenen – eines Verhörers (im folgenden Mondegreen genannt) – wurde. Der Verfasser sollte als Drittklässler in der Vorweihnachtszeit ein Bild der Christfamilie malen. So kam es, dass sich auf dem Bild der Stall, Ochs und Esel, Maria, Josef, das Jesus Kindlein und ein dicker Mann, welcher lauthals lachte, wiederfanden. Als die Lehrerin den Verfasser fragte, um wen es sich auf dem Bild handle, entgegnete dieser selbstsicher „das ist der Obi“. Er hatte nämlich bei „Stille Nacht“ den Text falsch verstanden und so wurde aus „Gottes Sohn, O! Wie lacht“, „Gottes Sohn, Obi lacht“, weshalb dieser unbedingt Teil des Bildes werden musste. Somit weckte die Themenvergabe das Interesse daran, herauszufinden, wodurch eine derartige Fehlinformation für so richtig erachtet werden konnte, obwohl es sich auch noch um die eigene Muttersprache handelt.
Dieses Phänomen wird in dieser Arbeit wie folgt behandelt:
Beginnend führt der Verfasser in die Thematik sowie die Methodik zur Behandlung der Mondegreens ein. Im Anschluss daran folgt eine Definition von Mondegreens und inwiefern sich diese von anderen sprachlichen Phänomenen unterscheiden. Im weiteren Verlauf der Arbeit geht der Verfasser auf die Beschaffenheit der zu behandelnden Mondegreens ein und die arbeitet diese methodisch ab. Die Arbeit wird schließlich durch einen Vergleich der Mondegreens untereinander abgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Thematik und Methodik
- Volksetymologie
- Mondegreens und andere sprachliche Phänomene
- Vergleichskriterien und Untersuchungsschema
- Praxisteil
- Gott der Herr hat sieben Zähne
- Alfred hat nun ein Ende
- Sterben auf Ratten
- Dies Kind soll unser letztes sein
- Bei Bier und Torten
- Kurt sei Dank!
- Olive the other reindeer
- Gladly, the cross-eyed bear
- John Virgin
- Holger, Knabe im lockigen Haar
- Maria, du bist voll der Knaben
- Hoch droben schwebt Josef den Engeln was vor
- Beethovens Stall
- Hallo Julia
- Geht auf allen Vieren mit uns ein und aus
- Kein Auge hat sie und konnte seh'n
- Still schweigt Kummer und Darm
- Wie auch wir vergeben unserem Schuldi gern
- Forgive us our christmasses
- Oh Tannenbaum, wie grinsen deine Blätter. Du grinst nicht nur zur Sommerzeit
- Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Mondegreens, einer Form des Verhörens, die zu fehlerhaften Interpretationen von Texten führt. Ziel der Arbeit ist es, die Entstehung von Mondegreens anhand verschiedener Beispiele zu analysieren und ein Schema zu entwickeln, das die Abwandlungsprozesse dieser sprachlichen Phänomene erklärt.
- Definition und Abgrenzung von Mondegreens von anderen sprachlichen Phänomenen
- Analyse der strukturellen Merkmale von Mondegreens
- Entwicklung eines Abwandlungsschemas für Mondegreens
- Vergleich verschiedener Mondegreens
- Einordnung von Mondegreens in den Kontext der Volksetymologie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Mondegreens ein und erläutert die Forschungsmethodik. Sie stellt das Phänomen des Verhörens als Ausgangspunkt für die Arbeit dar und beschreibt den Entstehungshintergrund der Studie.
Das erste Kapitel befasst sich mit Volksetymologie und definiert das Konzept. Es untersucht, wie sich Volksetymologie von anderen sprachlichen Phänomenen unterscheidet und zeigt die Rolle von Volksetymologie bei der Entstehung von Mondegreens auf.
Das zweite Kapitel stellt verschiedene Beispiele für Mondegreens vor und analysiert diese anhand des entwickelten Abwandlungsschemas. Dieses Schema soll die Entstehungsprozesse der Mondegreens erklären und die verschiedenen Faktoren, die zu ihrer Entstehung führen, herausarbeiten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Mondegreens, Volksetymologie, sprachliche Phänomene, Verhören, Missverständnisse, Abwandlungsprozesse, Textinterpretation, Sprachwissenschaft, Analyse, Schemaentwicklung, Abwandlungsschema.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein "Mondegreen"?
Ein Mondegreen ist ein sprachliches Phänomen des Verhörens, bei dem eine lautliche Ähnlichkeit zu einer fehlerhaften, aber oft sinnvoll erscheinenden Neuinterpretation eines Textes führt.
Wie unterscheiden sich "Verhören" und "Falschverstehen"?
"Verhören" wird oft als akustische Störung wahrgenommen, während "Falschverstehen" eine kognitive Fehlleistung beim Rekonstruieren des Gehörten impliziert.
Was hat Volksetymologie mit Mondegreens zu tun?
Beide Phänomene versuchen, Unbekanntes oder Unverständliches durch klanglich ähnliche, vertraute Begriffe zu ersetzen (z.B. "Obi lacht" statt "O wie lacht").
Welche Beispiele für Mondegreens werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit untersucht Klassiker wie "Der Herr hat sieben Zähne" (statt "sieben Söhne") oder "Holger, Knabe im lockigen Haar" (statt "holder Knabe").
Warum sind Mondegreens für die Sprachwissenschaft interessant?
Sie geben Aufschluss darüber, wie unser Gehirn Sprache verarbeitet, analysiert und bei Lücken oder Unklarheiten fehlende Informationen kreativ ergänzt.
Gibt es Mondegreens auch in anderen Sprachen?
Ja, die Arbeit führt auch englische Beispiele an, wie "Olive the other reindeer" (statt "all of the other reindeer") oder "Gladly, the cross-eyed bear" (statt "Gladly the cross I'd bear").
- Quote paper
- Maximilian Tresp (Author), 2014, Verhören und Mondegreens. Sprachliche Phänomene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414551