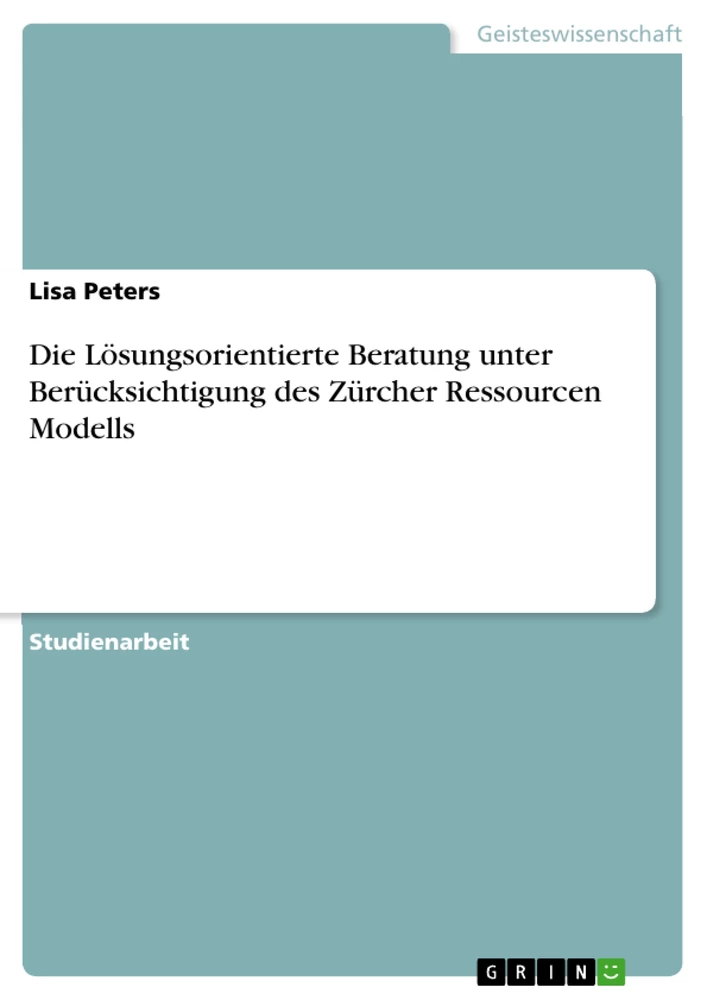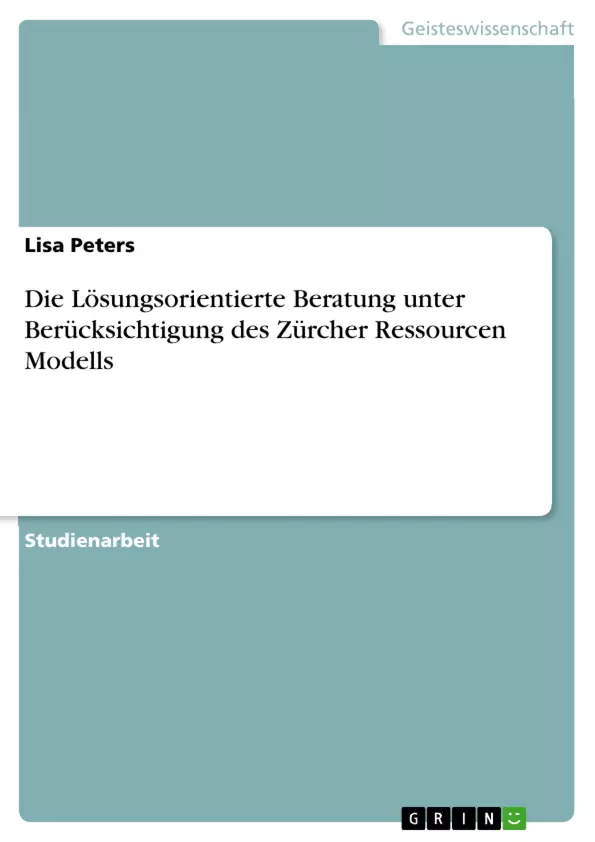Die Lösungsorientierte Beratung betrachtet jede Krise als Möglichkeit des persönlichen Wachstums und der Weiterentwicklung. Daher fokussieren sich Berater und Klient auf vorhandene Ressourcen, die Lösung und die Zukunft, anstatt wie in vielen anderen gängigen Beratungsformen der Sozialen Arbeit, Vergangenes zu analysieren. Das Zürcher-Ressourcen-Modell -kurz ZRM -, welches auf das Training für gelingendes Selbstmanagement baut und sich dabei auf die Neurologie beruft, scheint ähnliche Grundgedanken wie die Lösungsorientierte Beratung zu verfolgen. Welche Ansätze der Lösungsorientierten Beratung lassen sich tatsächlich im Zürcher-Ressourcen-Modell wiederfinden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Lösungsorientierte Beratung
- 2.1 Die Entstehung der Lösungsorientierten Beratung
- 2.2 Die Lösungsorientierte Beratung samt Methoden und Techniken
- 3. Das Zürcher Ressourcen Modell
- 3.1 Neurobiologische Grundlagen
- 3.2 Der Rubikon-Prozess
- 3.3 Die 5 Phasen des ZRM-Trainings
- 4. Gemeinsamkeiten und Unterschiede des ZRM-Trainings zur Lösungsorientierten Beratung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen lösungsorientierter Beratung und dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM). Ziel ist es, die jeweiligen Ansätze zu beschreiben und ihre Überlappungen im Hinblick auf die Nutzung von Ressourcen in der Sozialen Arbeit zu analysieren.
- Entstehung und Entwicklung der lösungsorientierten Beratung
- Methoden und Techniken der lösungsorientierten Beratung
- Neurobiologische Grundlagen und Phasen des Zürcher Ressourcen Modells
- Vergleich der beiden Ansätze bezüglich Ressourcenorientierung
- Anwendbarkeit der Konzepte in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Beratung ein und hebt die Unterschiede zwischen traditionellen problemorientierten und der lösungsorientierten Beratung hervor. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Gemeinsamkeiten zwischen lösungsorientierter Beratung und dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf dem ressourcenorientierten Ansatz beider Modelle.
2. Die Lösungsorientierte Beratung: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der lösungsorientierten Beratung im Kontext des systemischen Denkens und der Kurztherapie. Es wird die Abkehr von einer rein problemzentrierten Betrachtungsweise hin zu einem lösungsfokussierten Ansatz dargestellt. Die Entstehung der lösungsorientierten Beratung wird in Verbindung mit der systemischen Bewegung und wichtigen Persönlichkeiten wie Milton Erickson gebracht. Der Text beschreibt die Bedeutung des Lebenskontextes und des Netzwerkes des Klienten für die Ressourcenfindung.
3. Das Zürcher Ressourcen Modell: Dieses Kapitel widmet sich dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM). Es erläutert die neurobiologischen Grundlagen des ZRM, die auf dem Verständnis des Gehirns als Überlebensorgan und der Bedeutung neuronaler Erregungsmuster basieren. Der Rubikon-Prozess wird detailliert beschrieben, der die verschiedenen Phasen von der Bedürfnisentstehung bis zur Handlung umfasst. Die fünf Phasen des ZRM-Trainings werden vorgestellt, mit besonderem Fokus auf die Ressourcenfindung, Zielformulierung und -sicherung. Die Rolle von Bildern und Methoden in der Arbeit mit Klienten wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Lösungsorientierte Beratung, Zürcher Ressourcen Modell (ZRM), Kurztherapie, Systemisches Denken, Ressourcenorientierung, Neurobiologie, Ressourcenaktivierung, Selbstmanagement, Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Lösungsorientierte Beratung vs. Zürcher Ressourcen Modell (ZRM)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Lösungsorientierte Beratung und das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM). Sie beschreibt beide Ansätze detailliert, analysiert ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von Ressourcen in der Sozialen Arbeit. Der Text beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zur Lösungsorientierten Beratung und zum ZRM, einen Vergleich beider Modelle und ein Fazit. Zusätzlich findet man ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Was sind die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der lösungsorientierten Beratung und dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM). Das Ziel ist die Beschreibung beider Ansätze und die Analyse ihrer Überlappungen bezüglich der Ressourcenorientierung in der Sozialen Arbeit. Schwerpunkte sind die Entstehung und Entwicklung der Lösungsorientierten Beratung, deren Methoden und Techniken, die neurobiologischen Grundlagen und Phasen des ZRM, der Vergleich der Ressourcenorientierung beider Modelle und deren Anwendbarkeit in der Sozialen Arbeit.
Was wird in der Lösungsorientierten Beratung behandelt?
Das Kapitel zur Lösungsorientierten Beratung beleuchtet deren Entstehung im Kontext des systemischen Denkens und der Kurztherapie. Es beschreibt die Abkehr von einer problemzentrierten hin zu einer lösungsfokussierten Betrachtungsweise, die Verbindung zur systemischen Bewegung und wichtigen Persönlichkeiten wie Milton Erickson. Die Bedeutung des Lebenskontextes und des Netzwerkes des Klienten für die Ressourcenfindung wird ebenfalls thematisiert.
Was wird im Kapitel zum Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) erläutert?
Das Kapitel zum ZRM erläutert die neurobiologischen Grundlagen, die auf dem Verständnis des Gehirns als Überlebensorgan und der Bedeutung neuronaler Erregungsmuster basieren. Der Rubikon-Prozess mit seinen Phasen von der Bedürfnisentstehung bis zur Handlung wird detailliert beschrieben. Die fünf Phasen des ZRM-Trainings, mit Fokus auf Ressourcenfindung, Zielformulierung und -sicherung, werden vorgestellt. Die Rolle von Bildern und Methoden in der Arbeit mit Klienten wird ebenfalls beleuchtet.
Wie werden die Lösungsorientierte Beratung und das ZRM verglichen?
Die Arbeit vergleicht beide Ansätze im Hinblick auf ihre Ressourcenorientierung. Es wird untersucht, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der praktischen Anwendung und der theoretischen Grundlage bestehen. Der Fokus liegt auf der Nutzung von Ressourcen zur Erreichung von Zielen und der Übertragbarkeit der Konzepte auf die Soziale Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lösungsorientierte Beratung, Zürcher Ressourcen Modell (ZRM), Kurztherapie, Systemisches Denken, Ressourcenorientierung, Neurobiologie, Ressourcenaktivierung, Selbstmanagement, Soziale Arbeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Lösungsorientierten Beratung, ein Kapitel zum Zürcher Ressourcen Modell (ZRM), ein Kapitel zum Vergleich beider Ansätze und ein Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der jeweiligen Methode und deren Anwendung.
- Arbeit zitieren
- Lisa Peters (Autor:in), 2016, Die Lösungsorientierte Beratung unter Berücksichtigung des Zürcher Ressourcen Modells, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/415464