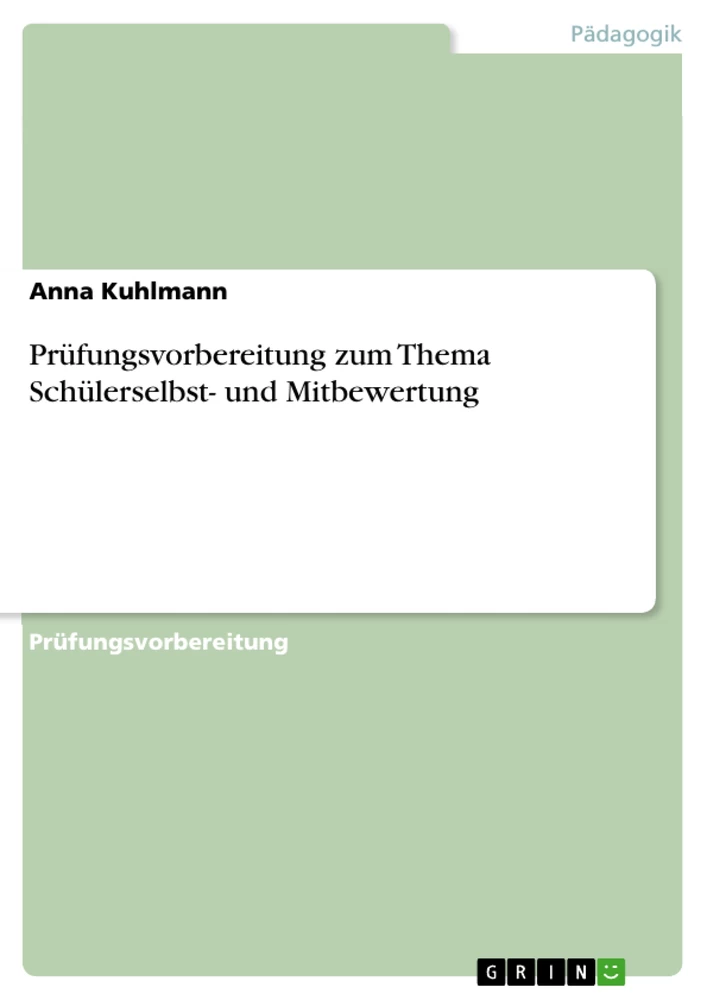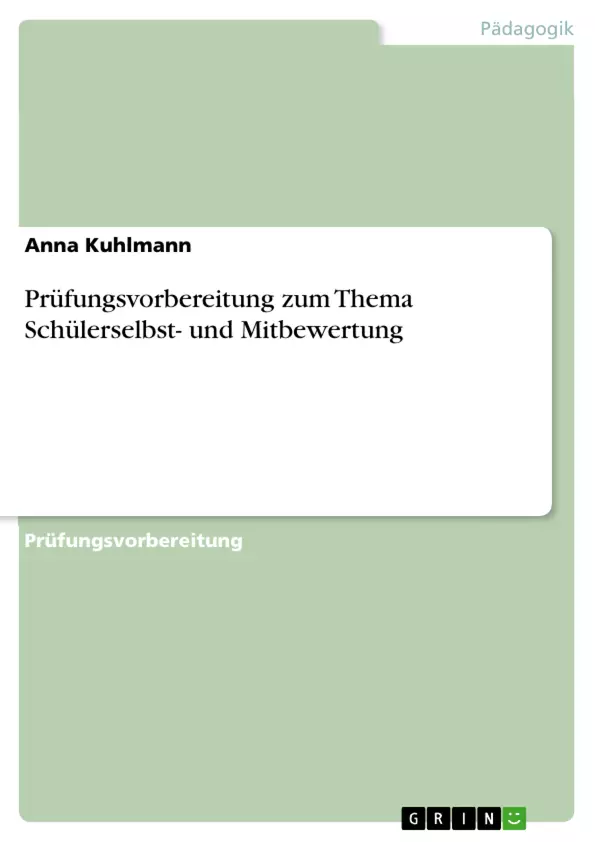Dieses Skript zur Prüfungsvorbereitung beinhaltet zum einen die Grundlagen der Leistungsbewertung, das heißt Gütekriterien, Funktionen von Zensurengebung und Merkmale guten Unterrichts. Zum anderen werden Definition, Geschichte und Ziele von Schülerselbst- und Mitbewertung besprochen. Außerdem Methoden für die Bewertung in der Didaktik und deren Nachteile, Vorzüge und mögliche Kompromisse. Auch rechtliche Grundlagen werden thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung Schülerselbst- und Mitbewertung
- Grundlagen der Leistungsbewertung
- Tradierter und erweiterter pädagogischer Leistungsbegriff
- Funktionen der Zensurengebung
- Gütekriterien der Leistungsmessung
- Bezugsnormen
- Merkmale guten Unterrichts
- Definition
- Geschichte
- Methode
- Verfahren
- Selbstbewertung
- Mitbewertung/Gruppenbewertung
- Beurteilung von Projektarbeit
- Bewertung in der Didaktik
- Chancen und Perspektiven
- Einwände
- wichtige Tipps/Kompromiss
- Rechtliche Vorgaben
- Zeugnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit dem Konzept der Schülerselbst- und Mitbewertung in der Schule. Er analysiert die Grundlagen der Leistungsbewertung, untersucht die Geschichte und die Methoden der Selbst- und Mitbewertung und beleuchtet Chancen und Perspektiven sowie Einwände und wichtige Tipps für die praktische Umsetzung.
- Grundlagen der Leistungsbewertung und ihre Funktionen
- Konzepte der Selbst- und Mitbewertung im Unterricht
- Chancen und Herausforderungen der Schülerselbst- und Mitbewertung
- Rechtliche Vorgaben und praktische Umsetzung in der Schule
- Die Rolle der Zeugnisse in der Leistungsbewertung
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil des Textes behandelt die Grundlagen der Leistungsbewertung. Er analysiert den traditionellen und den erweiterten pädagogischen Leistungsbegriff und beleuchtet die Funktionen der Zensurengebung. Anschließend werden die Gütekriterien der Leistungsmessung, die Bezugsnormen und die Merkmale guten Unterrichts erörtert.
Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Selbst- und Mitbewertung definiert und ihre Geschichte beleuchtet. Dabei wird der reformpädagogische Ursprung und die konstruktivistische Lernperspektive hervorgehoben. Der Fokus liegt auf dem Ziel, den persönlichen Lernstand zu reflektieren und selbstgesetzte Lernfortschritte zu beurteilen.
Im dritten Kapitel werden verschiedene Verfahren der Selbst- und Mitbewertung vorgestellt. Hierzu gehören die Selbstbewertung anhand von Portfolios, Lerntagebüchern und Checklisten sowie die Mitbewertung in Gruppenarbeiten und Projekten.
Der vierte Teil des Textes beleuchtet Chancen und Perspektiven der Schülerselbst- und Mitbewertung. Es werden die Stärken dieser Methoden in Bezug auf Transparenz, Akzeptanz, Reflexion und Lernklima hervorgehoben.
Im fünften Kapitel werden kritische Einwände und wichtige Tipps für die praktische Umsetzung der Selbst- und Mitbewertung behandelt. Die Wichtigkeit einer gezielten Anwendung, einer entspannten Atmosphäre und einer transparenten Fehleranalyse wird betont.
Schlüsselwörter
Schülerselbstbewertung, Mitbewertung, Leistungsbewertung, pädagogischer Leistungsbegriff, Zensurengebung, Gütekriterien, Bezugsnormen, Merkmale guten Unterrichts, Portfolio, Lerntagebuch, Gruppenarbeit, Projektarbeit, Chancen, Perspektiven, Einwände, Tipps, Rechtliche Vorgaben, Zeugnisse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Schülerselbst- und Mitbewertung?
Selbstbewertung bezieht sich auf die Einschätzung der eigenen Leistung durch den Schüler, während Mitbewertung (oder Peer-Assessment) die Beurteilung der Leistung von Mitschülern umfasst.
Welche Gütekriterien gelten für die Leistungsmessung?
Die klassischen Gütekriterien sind Objektivität (Unabhängigkeit vom Prüfer), Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit der Messung).
Welche Methoden eignen sich für die Selbstbewertung?
Häufig genutzte Methoden sind Portfolios, Lerntagebücher, Checklisten und Reflexionsbögen, die den individuellen Lernfortschritt dokumentieren.
Was sind die Vorteile von Schülermitbewertung?
Sie fördert die Transparenz von Bewertungskriterien, steigert die Akzeptanz von Noten, verbessert das Lernklima und schult die Reflexionsfähigkeit der Schüler.
Gibt es rechtliche Bedenken bei der Schülerbewertung?
Ja, die Arbeit thematisiert rechtliche Vorgaben, da die endgültige Notengebungshoheit beim Lehrer liegen muss und Schülerbewertungen meist nur ergänzenden Charakter haben dürfen.
- Citar trabajo
- Anna Kuhlmann (Autor), 2016, Prüfungsvorbereitung zum Thema Schülerselbst- und Mitbewertung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416087