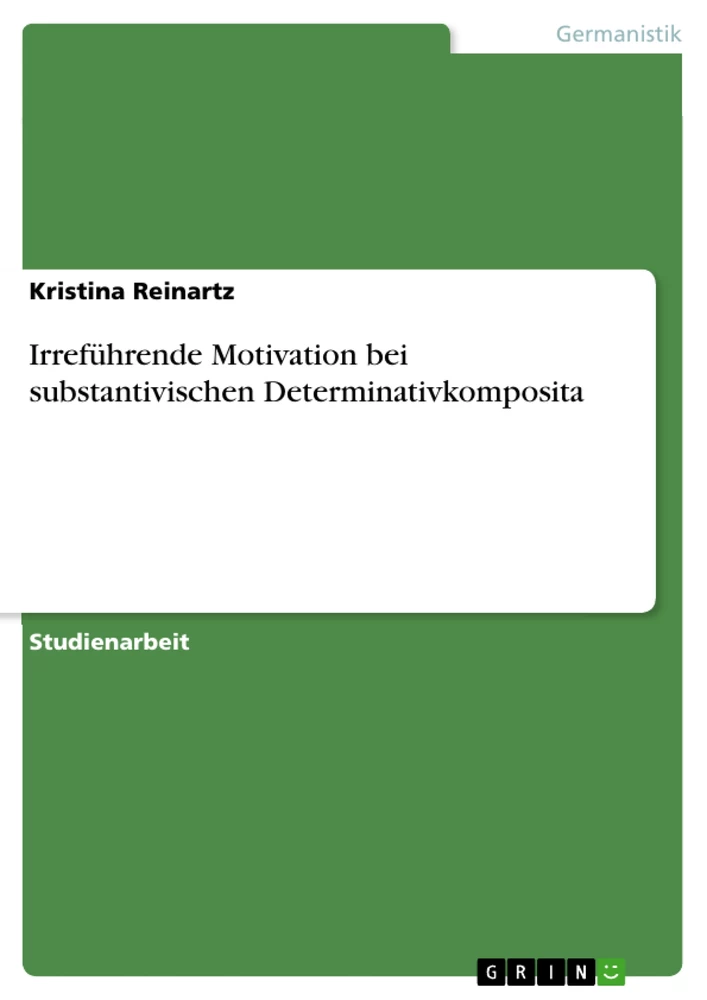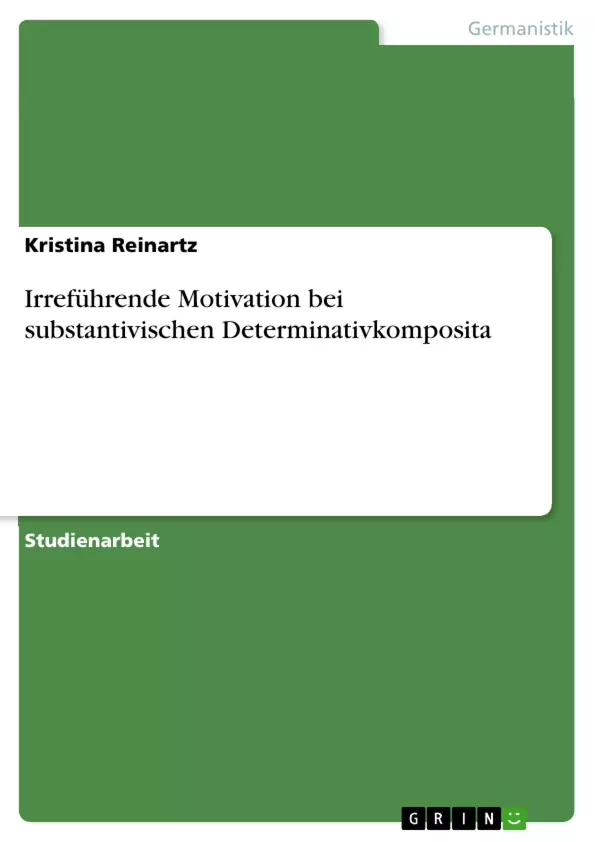„Der Maulwurf wirft die Erde mit Hilfe seiner Schnauze über die Erdoberfläche“. Antworten dieser Art häufen sich, wenn es darum geht, zu erklären, weshalb der Maulwurf als solcher bezeichnet wird. Doch bereits bei einem Erklärungsversuch gerät man im Deutschen als Nicht-Sprachwissenschaftler schnell ins Zögern, da sich Begriffe wie Maulwurf mit scheinbar eindeutig motivierten Bausteinen eben doch nicht zu hundert Prozent durch ihre heutigen Bestandteile erklären lassen. Man spricht in solchen Fällen von irreführender Motivation, welche es in dieser Arbeit historisch genauer zu untersuchen gilt. Folgende Fragestellung bildet die Grundlage dieser Arbeit, um spezifische Phänomene genauer betrachten zu können:
Ab wann kann man im Kontext einzelner Beispiele von einer irreführenden Motivation sprechen? Anhand der genannten Fragestellung soll untersucht werden, ob sich mittels der analysierten Beispiele Gemeinsamkeiten finden lassen, die eine irreführende Motivation bedingen.
Möglicherweise lässt sich mit einer Untersuchung einer kleinen Auswahl irreführender Motivationen eine Regel oder gewisse Tendenzen herleiten, die Prognosen für den Verlauf der Entwicklung entsprechender aktueller Wörter in der Sprachwissenschaft ermöglichen. Zunächst müssen einige Begriffe genauer definiert werden, um eindeutige Aussagen gewährleisten zu können. Darüber hinaus werden mit diesen Definitionen einige Schwierigkeiten angesprochen, die sich durch den Gebrauch der Begrifflichkeiten in der Sprachwissenschaft ergeben. Anschließend wird der Fokus auf konkrete Beispiele gelenkt, welche zwar in der Sekundärliteratur bereits ausführlich dargestellt sind, jedoch bisher nicht auf gemeinsame Wortbildungs– und Wandelprozesse hin untersucht wurden. Mit Hilfe eines Umfrageverfahrens wird das heutige etymologische Verständnis dieser Wörter aufgezeigt und anschließend historisch untersucht. Das Fazit gibt darüber Auskunft, ob spezifische Prozesse konsequent beobachtet wurden, die eine irreführende Motivation bedingen. Diesbezüglich soll auch die Ausgangsfrage geklärt werden, ab wann überhaupt von einer irreführenden Motivation die Rede sein kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1 Determinativkompositum
- 2.2 Motivation
- 2.3 Volksetymologie/ Sekundäre Motivation
- 2.3.1 Diachronie
- 2.3.2 Isolation
- 3. Zu Ausgewählten Beispielen
- 3.1 Aufbau und Durchführung der Umfrage
- 3.2 Problematik
- 3.3 Auswertung
- 3.3.1 Elfenbein
- 3.3.2 Armbrust
- 3.3.3 Maulwurf
- 3.3.4 Murmeltier
- 3.3.5 Leinwand
- 3.3.6 Pleitegeier
- 3.3.7 Rosenmontag
- 3.3.8 Schnapsdrossel
- 3.4 Historische Betrachtung
- 3.4.1 Elfenbein
- 3.4.2 Armbrust
- 3.4.3 Maulwurf
- 3.4.4 Murmeltier
- 3.4.5 Leinwand
- 3.4.6 Pleitegeier
- 3.4.7 Rosenmontag und Schnapsdrossel
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Phänomen der irreführenden Motivation bei substantivischen Determinativkomposita. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Ab wann kann man von einer irreführenden Motivation sprechen? Die Arbeit analysiert ausgewählte Beispiele, um Gemeinsamkeiten zu identifizieren, die eine irreführende Motivation bedingen. Ziel ist es, anhand der Untersuchung dieser Beispiele mögliche Regelmäßigkeiten oder Tendenzen aufzuzeigen, die Prognosen für die Entwicklung entsprechender Wörter ermöglichen.
- Definition und Abgrenzung von Determinativkomposita und Motivation
- Analyse der irreführenden Motivation anhand ausgewählter Beispiele
- Untersuchung des heutigen etymologischen Verständnisses mittels einer Umfrage
- Historische Betrachtung der Wortentwicklung der ausgewählten Beispiele
- Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Tendenzen bei der irreführenden Motivation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der irreführenden Motivation bei Determinativkomposita ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Zeitpunkt, ab dem von einer solchen Motivation gesprochen werden kann. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit: Zuerst werden zentrale Begriffe definiert, danach werden konkrete Beispiele analysiert, die mittels einer Umfrage auf ihr heutiges etymologisches Verständnis hin untersucht und historisch betrachtet werden. Das Fazit soll dann die Ausgangsfrage beantworten.
2. Definitionen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „Determinativkompositum“ und „Motivation“. Es erklärt zunächst den Begriff des Kompositums im Allgemeinen und leitet dann den Begriff des Determinativkompositums aus seinen lateinischen Bestandteilen her. Die Definition wird durch die Erklärung der Struktur des Determinativkompositums aus Bestimmungswort (Determinans) und Grundwort (Determinatum) ergänzt. Schwierigkeiten im Umgang mit diesen Termini in der Sprachwissenschaft werden angesprochen. Der Fokus liegt auf substantivischen Determinativkomposita, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden.
3. Zu Ausgewählten Beispielen: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse ausgewählter Beispiele von Determinativkomposita mit irreführender Motivation. Es beginnt mit der Beschreibung des Aufbaus und der Durchführung einer Umfrage, die das heutige etymologische Verständnis dieser Wörter aufzeigen soll. Die Problematik der irreführenden Motivation wird erörtert, bevor die Auswertung der Umfrageergebnisse und eine historische Betrachtung der jeweiligen Wörter folgen. Die einzelnen Abschnitte (3.3.1-3.3.8 und 3.4.1-3.4.7) untersuchen jedes Beispiel im Detail, beleuchten die etymologische Entwicklung und den Wandel der Bedeutung im Laufe der Zeit, und analysieren, wie diese Entwicklung zu der heute wahrgenommenen irreführenden Motivation beiträgt. Der Vergleich der einzelnen Beispiele soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Wortbildungs- und Wandelprozessen aufdecken.
Schlüsselwörter
Irreführende Motivation, Determinativkompositum, Volksetymologie, Wortbildung, Sprachwandel, Etymologie, Semantik, Komposition, Substantiv, historische Sprachwissenschaft, Umfrage, Beispielanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Irreführende Motivation bei substantivischen Determinativkomposita
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht das Phänomen der irreführenden Motivation bei substantivischen Determinativkomposita. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Ab wann kann man von einer irreführenden Motivation sprechen? Die Arbeit analysiert ausgewählte Beispiele, um Gemeinsamkeiten zu identifizieren, die eine irreführende Motivation bedingen. Ziel ist es, anhand der Untersuchung dieser Beispiele mögliche Regelmäßigkeiten oder Tendenzen aufzuzeigen, die Prognosen für die Entwicklung entsprechender Wörter ermöglichen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Determinativkomposita und Motivation; Analyse der irreführenden Motivation anhand ausgewählter Beispiele; Untersuchung des heutigen etymologischen Verständnisses mittels einer Umfrage; Historische Betrachtung der Wortentwicklung der ausgewählten Beispiele; Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Tendenzen bei der irreführenden Motivation.
Welche Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert folgende Beispiele für Determinativkomposita mit irreführender Motivation: Elfenbein, Armbrust, Maulwurf, Murmeltier, Leinwand, Pleitegeier, Rosenmontag und Schnapsdrossel. Jedes Beispiel wird sowohl im Hinblick auf das heutige etymologische Verständnis (durch eine Umfrage ermittelt) als auch historisch betrachtet.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 (Definitionen) klärt die zentralen Begriffe. Kapitel 3 (Zu ausgewählten Beispielen) präsentiert die detaillierte Analyse der ausgewählten Komposita, inklusive der Beschreibung der Umfrage, der Auswertung und der historischen Betrachtung. Kapitel 4 (Fazit) beantwortet die Forschungsfrage.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet sowohl qualitative als auch quantitative Methoden. Die qualitative Methode besteht in der Analyse ausgewählter Beispiele und deren historischer Entwicklung. Die quantitative Methode besteht in der Durchführung einer Umfrage, um das heutige etymologische Verständnis der ausgewählten Wörter zu erfassen.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit?
Die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit sollen Gemeinsamkeiten und Tendenzen bei der irreführenden Motivation von substantivischen Determinativkomposita aufzeigen. Das Fazit soll die Ausgangsfrage beantworten, ab wann von einer irreführenden Motivation gesprochen werden kann.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Irreführende Motivation, Determinativkompositum, Volksetymologie, Wortbildung, Sprachwandel, Etymologie, Semantik, Komposition, Substantiv, historische Sprachwissenschaft, Umfrage, Beispielanalyse.
Wie ist der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: Einleitung; Definitionen (inkl. Unterpunkten zu Determinativkompositum, Motivation und Volksetymologie/Sekundäre Motivation mit Unterpunkten Diachronie und Isolation); Zu ausgewählten Beispielen (inkl. Unterpunkten zu Aufbau und Durchführung der Umfrage, Problematik, Auswertung der einzelnen Beispiele und Historische Betrachtung der einzelnen Beispiele); Fazit.
- Citar trabajo
- Kristina Reinartz (Autor), 2016, Irreführende Motivation bei substantivischen Determinativkomposita, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419364